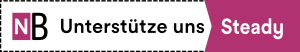Ferdinand Netzer (*Name geändert) ist Anfang Fünfzig, steht mitten im Berufsleben als Unternehmer und engagierter Zeitgenosse. Er freut sich an Vielem, liebt die Natur ebenso sehr wie seine erwachsenen Kinder und die Begegnungen mit guten Freunden. Netzer ist schon immer ein umtriebiger, freundlicher und mit gutem Humor gesegneter Mensch. Nichts kann seine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben ohne weiteres erschüttern, aber dann geschieht es: Zunächst fühlt es sich an wie eine Erschöpfung, die jeder in Netzers Umfeld schon lange erwartet hätte. Die Symptome nehmen aber stetig zu. Schließlich folgt die Diagnose vom fast vollständigen Verlust der Nierenfunktion und es ereignet sich der Zusammenbruch. Schließlich wird Netzer auf die Warteliste für eine Nierentransplantation aufgenommen. Irgendwo wird es – vielleicht bald, vielleicht erst viel später – einmal einen Menschen geben, von dem ihm ein Organ transplantiert werden wird….
Plötzlich wird im Leben alles anders
Peter Krause: Beginnen wir mit dem Moment, in dem du verstanden hast, dass dein bisherige Leben zu Ende war und etwas ganz anderes, neues kommen würde. Wie lange ist das her?
Ferdinand Netzer: Das ist jetzt fünf Jahre her.
Dir ging es irgendwie schlecht, so schlecht, dass du einen Arzt aufgesucht hast. Was war los, was waren deine Beschwerden? Beschreibe das bitte mal ein bisschen.
Ich hatte sozusagen das Gefühl, eine Kappe über dem Kopf zu haben. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass die Kräfte schwinden und einfach alles immer anstrengender werden würde. Dieses Gefühl, eine Kappe über dem Kopf zu haben, ließ mich fühlen, dass ich von der Außenwelt irgendwie abgeschnitten war. Diese Erfahrungen gaben den äußeren Anlass dafür, dass ich meinen Hausarzt aufgesucht habe. Der wiederum empfahl mir, mich von einem Facharzt für Nierenerkrankungen untersuchen zu lassen.
Und dort hast du schließlich erfahren, wie schlecht es um dich steht?

Das hat dieser Arzt mir sehr klar und drastisch gesagt. Das habe ich wie einen Boxhieb erlebt. Mir wurde deutlich gemacht, was für Einschränkungen in der Lebensführung nun auf mich zukommen würden. Ich habe mir bis dahin niemals vorstellen können, dass mir das so passieren könnte.
Die Dialyse wurde mir erklärt, ich wurde mit all den Gedanken konfrontiert, die man sich so macht, wenn plötzlich alles anders wird. Für mich war die wesentliche Empfindung, dass das Leben, so wie ich es bisher geführt habe sich vollkommen verändern würde.
Hast du in diesem Augenblick auch an den Tod gedacht? Ich meine, wenn man damit konfrontiert wird, das ein lebenswichtiges Organ nicht mehr oder fast nicht mehr funktioniert, dann kommen doch auch solche Gedanken.
Der Arzt sprach darüber nicht direkt, aber er sprach so, dass ich es selbst erkennen musste. Und ich habe es auch erkannt.
Den gewohnten Halt im Leben verlieren
Wenn du von dem ausgehst was du heute weißt, wirst du möglicherweise sagen, dass dir das Themenfeld, mit dem du damals konfrontiert wurdest, völlig neu war.
In erster Linie ist das zunächst eine ganz konfuse Situation, weil der Mensch binnen kürzester Zeit von dem ausgehend, was er eben nicht weiß, oder nur sehr rudimentär weiß – Standardwissen über Dialyse, über Organtransplantation usw. – damit beginnt, alles an Fluch und Segen nur auf sich selbst zu beziehen. Ich habe mir ganz plastisch vorgestellt, was mit meinem Körper passiert…
…passiert und passieren wird?
Die Situation in der ich mich nun befand, war mir noch nicht voll bewusst. Natürlich, ich fühlte mich körperlich überhaupt nicht gut und die Konsequenzen – die nicht mehr nur „möglichen“, sondern die mittlerweile „sehr wahrscheinlichen“ – brachten mich immer wieder vollkommen aus der Spur.
Ich konnte einfach nicht aufhören zu grübeln, habe mir alle möglichen Szenarien vorgestellt, von denen ich noch gar nichts konkretes wusste. Ich reimte mir alles Mögliche zusammen. Ich fühlte mich wie an einer Linie, die mein bisheriges „normales“ Leben von dem trennte, was nicht mehr normal sein würde, was mich aber erwartete. Meine Zukunft stellte ich mir damals überhaupt nicht mehr als schön, erbaulich oder konstruktiv vor.
Die Betroffenheit der Mitmenschen
Wie hat deine Umgebung reagiert? Was kam dir aus dem Kreis der Verwandten, Freunde und Bekannten entgegen? Du hast doch sicherlich bald mit den Menschen in deinem Umkreis über die für dich veränderte Situation gesprochen.
Die Menschen in meinem Umfeld reagierten mit einer ungeheuren Betroffenheit. Diese Intensität der Reaktion habe ich vorher noch nie erfahren, weil es eine solche Situation ja auch nie zuvor gegeben hatte. Neben der Betroffenheit und dem guten Zureden gab es dann auch von nicht wenigen Menschen Bemühungen, mich in eine Situation zu bringen, die mich mental wieder stark sein lassen konnte. Das war wirkliches Mitfühlen. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Erfahrung der Ohnmacht der Anderen.
Waren die Reaktionen in deinem beruflichen Umfeld identisch?
Im beruflichen Umfeld hat man es natürlich noch mit einer ganz anderen Ebene zu tun. Neben dem Zwischenmenschlichen geht es da auch um das Funktionieren. So ergab sich für mich beruflich die Situation, dass man versuchte, alles so einzurichten, dass ich angesichts dessen, was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen konnte schon mal in ein angemessen verändertes Umfeld komme. Die Dinge, die Abläufe wurden so gestaltet, dass ich auch weiterhin tätig sein konnte.
Man ist dir also auch im beruflichen Umfeld mit Verständnis begegnet. Trotzdem du das alles jetzt, also im Rückblick relativ klar sortiert und aneinandergereiht erzählst, war das alles in Wirklichkeit ein massiver Zusammenbruch.
Ja, das stimmt absolut! Über einen Zeitraum, den ich auch heute noch als sehr lang empfinde, versuchte ich dann wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Das waren gut zwei Jahre, die das gedauert hat.
Der Beginn der Dialyse als Wendepunkt

Beschreibe doch bitte mal den Moment, als es mit der Dialyse anfing.
Das erste Mal war es ein ganz erschreckender Moment. Ich rede jetzt über eine Maschinendialyse, also über eine Dialyse, die man so aus den Medien kennt. Es war eine ganz düstere Situation für mich, als ich mir vorstellte, dass ich von dieser aufwändigen Technik in Zukunft am Leben erhalten werden soll.
Bitte beschreibe es genauer. Wie läuft so etwas ganz konkret ab?
Zuerst wird man als Patient, ich sage es mal so, technisch anschlussfähig gemacht, damit man an die Maschine angeschlossen werden kann. Da läuft man plötzlich mit so einer Art Adapter an der Schulter herum, was ein ganz anderes Körpergefühl erzeugt.
Zur Dialyse kam ich in einen Raum, in dem sechs Patienten waren. Man sieht die Maschinen, die so ein bisschen aussehen, wie diese alten Computerbänder. Diese Maschinen beherrschen den Raum. Man weiß in diesem Moment, dass man sich dann für eine bestimmte Zeit nicht frei bewegen kann, weil eben die Maschine das tun wird, was zu tun ist. Bei mir waren das dreimal die Woche fünf Stunden.
Bei der Dialyse bist du auch vielen anderen betroffenen Menschen begegnet. Wie war das?
Die Leute kommen miteinander ins Gespräch, wobei ich damals erst mal zurückhaltend war, denn mir war das alles ja noch komplett neu. Ich wollte mich über meine Krankheit auch nicht austauschen, denn das empfand ich als demotivierend. Viele Menschen haben den Drang, sich über ihre Krankheit mitzuteilen. Ich empfand den Ausblick darauf als ungeheuer störend, mich dreimal die Woche für fünf Stunden über meine Erkrankung unterhalten zu sollen. Darum habe ich mich in diesen Gesprächen zurückgehalten. Was in der Dialyse passiert, ist, dass Maschinen das Blut reinigen. Die Arbeit der Nieren, die Reinigung des Blutes, wird von einer Maschine übernommen. Das ist eine Entgiftung.
Gedanken an eine Organspende und -transplantation
Nun wäre eine Transplantation für dich hilfreich und befreiend. Diese Möglichkeit, diesen Ausblick hat man dir ja dann auch bald eröffnet.
Ich bin ganz außerordentlich dankbar dafür, wie mich meine Ärztin da heran geführt hat. Man könnte sich ja vorstellen, dass es ein Gespräch gibt, in dem einem gesagt wird, dass die Chance besteht, durch eine Transplantation einen guten Weg zu einem neuen Leben einzuschlagen. Das war bei mir nicht so direkt, die Ärztin hatte ein sehr gutes Gespür für meine Befindlichkeit. Sie hat mich sehr vorsichtig und behutsam auf dieses Thema vorbereitet, was über mehrere Monate hinweg andauerte.
Trotzdem ist es ja irgendwann so gewesen, dass dir klar war, dass die Qualität in deinem Leben wieder eine andere, bessere werden könnte, wenn man ein Organ eines anderen Menschen in deinen Leib transplantieren würde. Da fragt man sich als Außenstehender, wie sich das anfühlt.

Das war ein Erkenntnisprozess, von dem ich vorher nicht gedacht hätte, das er so komplex und schwierig sein würde. Man könnte sagen, „Okay, deine Chance ist, eine Niere transplantiert zu bekommen und darauf bereitest du dich ab jetzt vor“, aber so einfach ist das nicht. Es war sogar ganz das Gegenteil der Fall.
Es geht bei dem Ganzen ja nicht nur um mich, sondern zum Beispiel auch darum, dass irgendjemand ganz bewusst entscheidet, seine Organe zur Verfügung zu stellen. So ein Mensch entscheidet sich dafür, unmittelbar vor seinem sicheren Tod noch ein ungeheuer großes Geschenk zu machen. Wenn jemand einen Organspendeausweis hat, dann hat er entschieden, in einem Augenblick, in dem er für sein eigenes Leben nichts mehr tun kann, etwas ganz Besonderes für das Leben eines anderen Menschen zu tun.
Entscheidungen an der Grenze des Lebens
Zum Thema der Transplantation muss ich eine Position beziehen, denn ich bin ja selbst Betroffener. Ich will nicht übertreiben, aber ich muss ja damit rechnen, dass ich in einem Moment in eine unmittelbare Todesnähe kommen kann. Ja, und darauf bezogen habe ich ein klares ethisches Bild gewonnen, das mir vorher so nicht zur Verfügung stand, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt hatte. Ich habe die Problematik nicht unmittelbar verspürt.
Was ist das für ein ganz klares ethisches Bild?
Ich kämpfe ernsthaft und täglich ums Überleben, aber ich weiß mittlerweile ganz klar, was ich dafür tun würde, um mein biologisches Leben wieder in eine fast normale Bahn zu bekommen – und eben auch, was ich nicht dafür tun würde.
Wie denkst du heute über den Spenderausweis?
Bevor man einen Spenderausweis hat, setzt man sich mit dem Thema auseinander. Dann trifft man eine Entscheidung, indem man sich einen solchen Spenderausweis besorgt und ihn bei sich trägt. Darin sehe ich eine ganz außerordentliche Leistung. So ein Ausweis hat ja zunächst einen anonymen Aspekt. Man ist bereit, Organe zu spenden, aber man weiß nicht für wen. Das ist sehr, sehr wertvoll, denn es geht ja nicht um einen Verwandten oder irgendwie nahestehenden Menschen, sondern schlicht darum, dass man in Zukunft möglicherweise jemandem das größte Geschenk machen wird, das man sich nur denken kann.
Traurige Nachricht zum Abschluss: Kurz nach dem Interview ist Ferdinand Netzer gestorben – für ihn gab es keine Spender-Niere.
Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:
Moderne Medizin: Heute vor 70 Jahren erfolgte die erste erfolgreiche Nierentransplantation
Über 8.000 schwerkranke Patient:innen warten bundesweit auf eine Transplantation
SERIE (3. und letzter Teil): Organspenden retten Leben – doch wie kann ihre Zahl erhöht werden?
Die moderne Medizin kann Leben retten: Organspende – dieses Thema geht alle an!