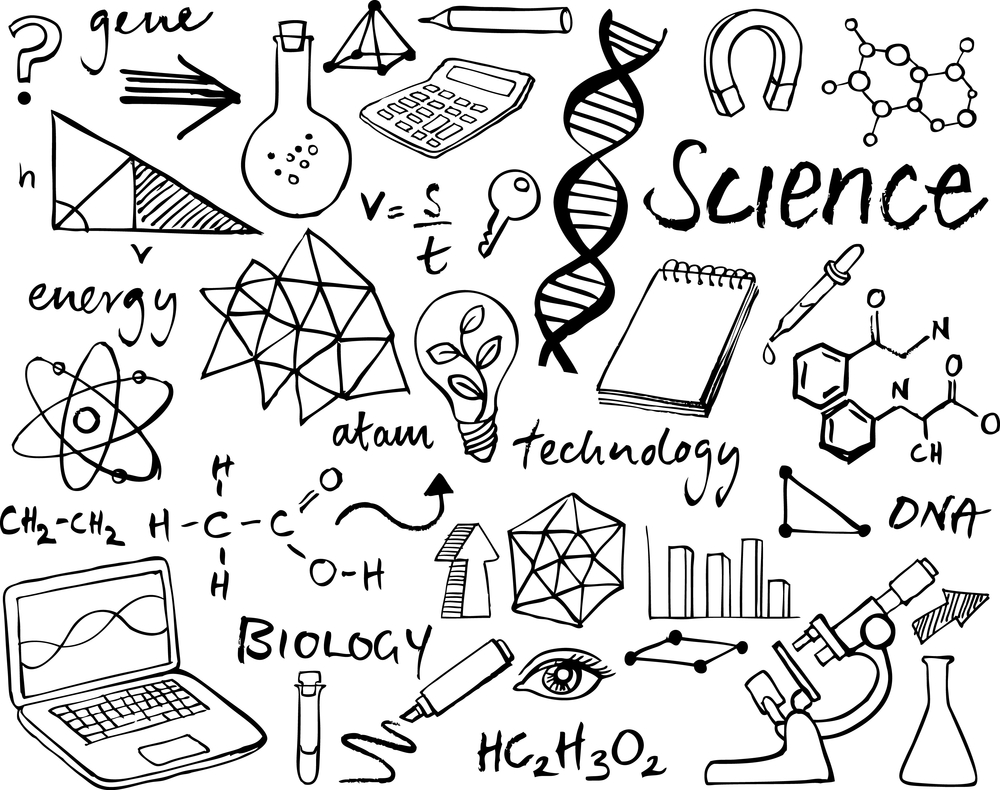
In dieser Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.
Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir, den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Wer: Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Informatik
Was: IT-Workshops für Jugendliche
Wann: Freitag, 15. März 2024, 9 bis 16 Uhr
Wo: Emil-Figge-Straße 42, 44227 Dortmund
Anmeldung: bis Sonntag, 10. März 2024
Eine eigene Smartphone-App entwickeln? Eine LED-Lampe zum Leuchten bringen? Oder spielerisch ein professionelles Warenwirtschaftssystem kennenlernen? Jugendliche ab der 9. Klasse sind eingeladen, am „Day of IT!“ (DoIT!) mit einem Workshop ihrer Wahl ganz praktisch in die Welt der Informatik einzutauchen.
Insgesamt fünf Workshops bietet der Fachbereich Informatik der Fachhochschule Dortmund zeitgleich am Freitag, 15. März 2024, von 9 bis 16 Uhr an. Darin geht es um sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche, beispielsweise auch um eine Ampelsteuerung im Internet der Dinge oder um 3D-Welten in der Medizinischen Informatik.
Interessierte können sich bis spätestens Sonntag, 10. März 2024, für einen der kostenlosen Workshops anmelden. Die mögliche Teilnahmezahl ist begrenzt.
Weitere Infos und Anmeldung:
www.fh-dortmund.de/doit
Bildzeile: Am „Day of IT“ (DoIT!) lassen sich auch LED-Lampen per Smartphone steuern.
Foto: Daniel Hofberg für die FH Dortmund

Einmal studieren, doppelt abschließen: In zwei Master-Studiengängen profitieren Studierende am Fachbereich Informatik der Fachhochschule Dortmund künftig von einer Kooperationsvereinbarung mit der angesehenen belgischen KU Leuven.
Die Vereinbarung ermöglicht einen sogenannten „Double Degree“: Wer an der FH Dortmund „Digital Transformation“ oder „Embedded Systems Engineering“ studiert und für ein Jahr an die KU Leuven wechselt, kann neben dem Dortmunder Master-Abschluss zusätzlich wahlweise den Abschluss „Master of Electronics & ICT“ oder „Master of Electromechanical Engineering“ erreichen. Gleiches gilt im Gegenzug für die Studierenden der KU Leuven.
„Ein Doppelabschluss-Abkommen für gleich zwei Master-Studiengänge mit der weltweit renommierten und in der EU regelmäßig in den Top-10 gerankten KU Leuven ist für die Fachhochschule Dortmund ein besonderes Ereignis“, kommentierte Prof. Dr. Stephan Weyers, Prorektor für Lehre und Studium. „Es ist zugleich das Ergebnis einer seit mehr als zehn Jahren währenden intensiven Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten. Die Studierenden bekommen eine tolle Chance.“ Die ersten Dortmunder wechseln voraussichtlich im Wintersemester 2024/25 nach Leuven.
Bildzeile: Unterzeichneten das Doppelabschluss-Abkommen: Prof. Dr. Stephan Weyers (links), Prorektor für Lehre und Studium an der Fachhochschule Dortmund, und Prof. Dr. Bert Lauwers, Dekan der Faculty of Engineering Technology an der KU Leuven.
Foto: KU Leuven

Die Dortmunder Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann ist in das Kuratorium des Max-Planck-Instituts (MPI) für molekulare Physiologie berufen worden. Hauptaufgabe des 12-köpfigen Gremiums ist es, das Institut in wissenschaftspolitischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen zu beraten und den Austausch zur Stadt sowie zur Region zu fördern.
Im Dortmunder MPI wird Grundlagenforschung betrieben. Internationale Team bestehend aus Chemiker:innen, Biolog:innen, Biochemiker:innen und Physiker:innen forschen zu Zellen, um Abläufe im Körper besser verstehen und so letztendlich Krankheiten wie Krebs effektiver behandeln zu können.
Bildzeile: v.l. Oliver Kaczmarek (Bundestagsabgeordneter aus Unna); Sabine Poschmann, MdB; Dirk Stürmer (Vorsitzender des Kuratoriums).
Foto: Büro Poschmann

Mit seinem Porträt über eine ambitionierte Freiwasser-Schwimmerin hat Film-Student Miguel Temme nicht nur das Bachelor-Studium an der FH Dortmund erfolgreich abgeschlossen. Bei den 34. Bamberger Kurzfilmtagen, Bayerns ältestem Kurzfilmfestival, sicherte er sich jetzt auch die Auszeichnung für die beste Dokumentation sowie den Publikumspreis. Belohnung: zweimal 1.000 Euro und zwei Zentauren-Trophäen in Gold.
An die Urlaube in Nordfrankreich, als Kind mit seinen Eltern, kann sich Miguel Temme noch sehr gut erinnern. Schon damals staunte er über die Wagemutigen, die zwischen Calais und Dover durch die Fluten des Ärmelkanals schwammen. „An diese Erinnerungen wollte ich anknüpfen für das Thema meines Abschlussfilms“, erzählt der heute 28-Jährige. In einer Facebook-Gruppe rund um das Kanalschwimmen machte er sich auf die Suche – und fand schließlich die Protagonistin für seine Dokumentation „Open Water“: Nikki aus Manchester.
„Nikki hatte ursprünglich niemals daran gedacht, dass sie eine erfolgreiche Sportlerin sein könnte“, erzählt Miguel Temme. „Sie war nie wirklich sportlich und entspricht auch nicht dem typischen Bild einer Athletin.“ Trotzdem stellte sie sich der Herausforderung, in offenen Gewässern zu schwimmen – unter extremen Bedingungen mit eisigen Seen und anspruchsvollen Meerengen. „Dabei entdeckte sie die unglaubliche Stärke und Widerstandsfähigkeit ihres Geistes und Körpers“, so Miguel Temme. „Diese Erfahrungen, an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten zu glauben, gibt Nikki inzwischen an Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen weiter: Sie trainiert und begleitet sie als Teil eines Staffelteams, das den Ärmelkanal durchschwimmen möchte.“
Das Publikum der Bamberger Kurzfilmtage und die Fachjury zeigten sich gleichermaßen begeistert von dem 23-minütigen Werk von Miguel Temme, der Buch, Regie und Schnitt übernommen hatte. Drehorte waren neben Manchester auch ein See im Lake District und die Küste von Wales. Sounddesign und Musik steuerte FH-Kommilitonin Melis Sarikaya bei, die damit ebenfalls ihren Bachelor-Abschluss machte. Außerdem beteiligt waren die FH-Studierenden Mattis Schulte (Kamera) und Jonas Borgloh (Produktion und O-Ton).
In der Laudatio der Jury für das „feinfühlige Porträt“ heißt es: „Der Film nimmt seine Protagonistin ernst und nähert sich ihr, ohne aufdringlich oder bloßstellend zu sein. In klaren und ruhigen Bildern werden ihre zwei Lebenswelten – zu Land und zu Wasser – visualisiert.“ Es handele sich um einen „ästhetisch überzeugenden Dokumentarfilm von gesellschaftlicher Relevanz, der sich abseits klassischer Rollenbilder bewegt.“
Bildzeile: Miguel Temme begeisterte mit seiner Doku Publikum und Fachjury.
Foto: privat

Transport-Lösung von Maschinenbau-Student der FH Dortmund
Warum schwer tragen, wenn das Ziehen viel leichter wäre? Das fragte sich Sebastian Reiter, begeisterter Hobby-Wassersportler, als er auf dem Weg zum Stand-Up-Paddling (SUP) sein aufblasbares Stehpaddel-Board im Rucksack vom Autoparkplatz Richtung Ruhr schleppte. Um den Transport deutlich zu vereinfachen, hat der Maschinenbau-Student als Studienarbeit an der Fachhochschule Dortmund eine praktische Rollen-Lösung aus dem 3D-Drucker entwickelt.
Lediglich etwa ein Kilogramm wiegt das handliche Helferlein „SUP-Träger“ von Sebastian Reiter, entstanden als Kombination aus 3D-gedrucktem Kunststoff, Edelstahl und verzinkten Hutmuttern. Zwei Rollen, jeweils nur 125 Millimeter mal 35 Millimeter klein, sind über eine Achsenkonstruktion verbunden. Diese lässt sich unter dem Board einstecken im sogenannten Finnenkasten – wo sonst die Finne ihren Platz hat, die an eine Haifischflosse erinnert und unter Wasser als Spurhalter dient.
„Mein SUP-Träger ist ausgerichtet auf eine Last von bis zu 20 Kilogramm und eignet sich daher für die meisten aufblasbaren Boards mit dem weit verbreiteten US-Box-Finnenkasten“, erklärt Sebastian Reiter. Für seine Studienarbeit am Fachbereich Maschinenbau dokumentierte er alle Schritte von der Idee bis zum Produkt, darunter die Auswahl der passenden Werkstoffe und der schichtweise 3D-Druck nach dem Prinzip der Additiven Fertigung. „Intensiv erprobt habe ich den Prototyp mit einem Testgewicht auf verschiedenen Untergründen“, berichtet der Student. Ob auf Waldboden, Schotter oder Pflastersteinen: „Dank der Querverstrebung zwischen den Rollen und dem hochwertigen Material hält der SUP-Träger den mechanischen Beanspruchungen stand.“
Zur Studienarbeit von Sebastian Reiter gehörte ebenfalls, sich ein mögliches Marketing- und Vertriebskonzept für sein Produkt zu überlegen. Auch hier soll es nicht bei der Theorie bleiben: Beratung holte er sich bereits beim Gründungsservice der FH Dortmund, machte sich schlau in Sachen Betriebswirtschaft und Recht – und ist nun dabei, neben Studium und Wassersport einen Online-Shop für seinen SUP-Träger an den Start zu bringen.
Bildzeile: Einfache Lösung zum Ziehen: Maschinenbau-Student Sebastian Reiter transportiert sein Board für das Stand-Up-Paddling auf Rollen.
Foto: Michael Milewski für die FH Dortmund

Umfrage zur Bezahlung des Nationalteams der Frauen
Soll das Fußball-Nationalteam der Frauen die gleichen Prämien bekommen wie das der Männer? Jeder fünfte Mann ist einer aktuellen Umfrage zufolge dagegen: 21,8 Prozent fänden es schlecht, wenn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) „Equal Pay“ einführen würde – nur 5,1 Prozent der Frauen bewerten das auch so. Während sich von ihnen 63,8 Prozent für die gleiche Bezahlung aussprechen, sind es bei den Männern mit 43,3 Prozent deutlich weniger.
Insgesamt befürwortet eine knappe Mehrheit von 51,4 Prozent „Equal Pay“, 15,2 Prozent lehnen den Vorschlag ab. 18,9 Prozent sind unentschlossen, 14,4 Prozent haben keine Meinung. An der Abstimmung auf der Voting-Plattform „FanQ“ beteiligten sich 5.426 Personen.
„Für die Förderung des Frauenfußballs ist es wichtig, Rückhalt von allen Geschlechtern und gesellschaftlichen Gruppierungen zu erhalten. Daher ist die von uns ermittelte Diskrepanz bei der Bewertung des Equal Pay zwischen Frauen und Männern kein ermutigender Befund“, kommentiert Prof. Dr. Axel Faix. Er lehrt am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung und ist Vorsitzender im Wissenschaftlichen Beirat von „FanQ“.
„Man darf den Effekt eines Equal Pay auf der Ebene der Nationalmannschaften für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs insgesamt nicht überschätzen, denn auch die allgemeinen Bedingungen für Fußballspielerinnen in den oberen Ligen in Deutschland sind vielfach noch ungünstig“, so Axel Faix. Aber als Maßnahme, die Wertschätzung vermittelt und dazu beiträgt, langfristig Mädchen und Frauen für diesen Sport zu begeistern, sei Equal Pay mit von Bedeutung.
Bildzeile: Prof. Dr. Axel Faix von der Fachhochschule Dortmund ordnet die Ergebnisse der Umfrage ein.
Foto: FH Dortmund

Fachhochschule Dortmund beteiligt sich an NRW-Landesprogramm
Die Fachhochschule Dortmund wird Teilnehmerin des Landesprogramms „Vereinbarkeit Beruf & Pflege in Nordrhein-Westfalen“. Rektorin Prof. Dr. Tamara Appel hat dafür eine entsprechende Charta unterzeichnet.
Um das Engagement für Pflegeverantwortung weiter zu stärken, sind an der FH Dortmund mehrere Maßnahmen, verbunden mit dem Landesprogramm, vorgesehen. Dazu gehört zum Beispiel, beratende „Pflege-Guides“ zu qualifizieren, Arbeitszeitmodelle individuell zu überprüfen, einen betrieblichen digitalen „Pflegekoffer“ mit aktuellem Informationsmaterial zu nutzen und sich auf Netzwerkveranstaltungen über Best-Practice-Lösungen auszutauschen.
„Mit ihrer Teilnahme am Landesprogramm kann die Fachhochschule für das Thema Pflege sensibilisieren und es noch sichtbarer machen“, sagt Sonja Wentzel, Pflegeberaterin beim FH-Familienservice. Dieser unterstützt neben Lehrenden und Beschäftigten auch Studierende, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern.
Weitere Informationen zum Landesprogramm:
www.berufundpflege-nrw.de
Hintergrund: Inhalte der Charta
1. Wir fördern eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von Respekt und Wertschätzung für die Aufgaben, die unsere Beschäftigten mit Pflegeverantwortung im Alltag übernehmen.
2. Wir schaffen die Voraussetzung dafür, dass alle Beschäftigten, insbesondere solche mit Führungsaufgaben, diese Werte erkennen, teilen und leben.
3. Uns ist bewusst, dass jede Pflege- und Unterstützungssituation unterschiedlich ist und sich auch immer wieder verändert, weshalb wir einen lösungsorientierten Umgang damit etablieren wollen.
4. Wir führen einen Dialog mit den Betriebs- bzw. Personalräten, um die Anliegen der Beschäftigten und die Bedürfnisse der Unternehmen bestmöglich in Einklang zu bringen.
5. Wir wollen den innerbetrieblichen Informationsstand über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und über die im Unternehmen und in der Kommune vorhandenen Unterstützungs- und Beratungsleistungen bei allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbessern.
6. Wir sichern zu, dass zu dem Thema Vereinbarkeit Beruf und Pflege in unserem Unternehmen ein kontinuierlicher Dialog erfolgt.
7. Wir wollen unser Engagement und unsere Erfahrungen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu einem Bestandteil des externen Dialogs mit Akteur*innen aus Pflege und Gesundheit machen.
Bildzeile: Orientieren sich an der Charta für die „Vereinbarkeit von Beruf & Pflege in Nordrhein-Westfalen“ v.l. Pflegeberaterin Sonja Wentzel, FH-Rektorin Tamara Appel und Gleichstellungsbeauftragte Sonja Hunscha.
Foto: Michael Milewski für die FH Dortmund

Würdigung für Entwicklung einer neuen Klasse von Wirkstoffen
Der Chemische Biologe Professor Craig Crews von der Yale University (USA) ist neuer Ehrendoktor der TU Dortmund. Mit dieser Auszeichnung würdigt die TU Dortmund Crews´ Verdienste in der biochemischen Forschung: Er entwickelt seit über 20 Jahren eine völlig neue Klasse von Wirkstoffen, die auch solche krankheitsauslösenden Proteine stoppen können, die bislang als unangreifbar galten. Die Dortmunder Fakultät für Chemie und Chemische Biologie hatte die Urkunde für den Dr. h.c. bereits 2021 inmitten der Coronapandemie ausgestellt und konnte sie nun endlich persönlich überreichen. Während der Feier wurde außerdem Dr. Michael Beck von der Bayer AG als Honorarprofessor geehrt.
In seiner Laudatio würdigte Prof. Herbert Waldmann, Professor für Biochemie an der TU Dortmund und Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie, den neuen Ehrendoktor Prof. Craig Crews für seine „geniale, wirklich herausragende wissenschaftliche Leistung“: Crews erfand das grundlegend neue Wirkprinzip der „PROTACs“, das mittlerweile in der Grundlagenforschung von vielen hundert Wissenschaftler*innen weiter erforscht und auch von der weltweiten Pharmaindustrie vorangetrieben wird. Die Abkürzung steht für „Proteolysis Targeting Chimera“ und beschreibt einen multifunktionalen Wirkstoff, der an krankheitsrelevante Proteine bindet und diese dem zellulären Abbauprogramm zuführt. Dadurch kontrollieren diese Wirkstoffe den Proteinspiegel und indirekt auch die Proteinfunktion. „Dazu müssen PROTACs nur mit hoher Selektivität an ihr Ziel binden, anstatt die enzymatische Aktivität des Zielproteins zu hemmen oder Protein-Protein-Wechselwirkungen aufwendig zu verhindern“, betont Waldmann. Dadurch sei das Prinzip theoretisch auf alle Proteine anwendbar, für die sich eine Bindung finden lässt. Das schließe auch die meisten Proteine ein, die bei herkömmlichen Ansätzen als nicht angreifbar gelten. Waldmann würdigte den Yale-Professor auch für sein unternehmerisches Engagement. Crews ist Mitbegründer eines börsennotierten Biotech-Unternehmens, das seine innovativen PROTACs-Wirkstoffe bereits klinisch testet.
Prof. Stefan M. Kast, Dekan der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie, und Prof. Gerhard Schembecker, Prorektor Finanzen der TU Dortmund, überreichten Prof. Craig Crews die Urkunde zur Ehrenpromotion in feierlichem Rahmen. Seine Ehrendoktorwürde ist erst die dritte, die seit Gründung der Universität vor über 50 Jahren im Bereich Chemie und Chemische Biologie verliehen wurde.
Über Professor Craig Crews
Crews studierte Chemie an der University of Virginia, bevor er an der Harvard University promovierte. Er war außerdem während seines Studiums DAAD-Stipendiat an der Universität Tübingen. Seit 1995 ist Crews an der Yale University tätig, wo er heute Professor für Molekular-, Zell- und Entwicklungsbiologie in den Fachbereichen Chemie und Pharmakologie ist.
Honorarprofessur für herausragendes Engagement in der Lehre
Als Honorarprofessor zeichnete die TU Dortmund während der Feierstunde Dr. Michael Beck von der Bayer AG aus. Beck engagiert sich seit 2008 in der Lehre der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie: Er hält Vorlesungen zu Computermethoden in der Medizinischen Chemie und führt Exkursionen durch. In seiner Laudatio betonte Prof. Daniel Rauh, Professor für Medizinische Chemie und Chemische Biologie, dass Becks Engagement in der Lehre eine große Bereicherung für die akademische Ausbildung an der Fakultät sei. Die Studierenden profitieren von seinen wissenschaftlichen Erfolgen in der beruflichen Praxis. Die Bezeichnung Honorarprofessor verleiht die Universität ausschließlich an besondere Persönlichkeiten, die über lange Zeit eine enge Beziehung zu einem Fachbereich pflegen. Beck ist der Fakultät neben seiner Lehrtätigkeit auch durch Forschungskooperationen in der angewandten chemischen Biologie, Methodenentwicklung zu Modellierung, Simulation und Künstlicher Intelligenz und vor allem deren Anwendung in der Wirkstoffforschung verbunden.
Über Dr. Michael Beck
Beck ist seit 1999 bei der Bayer AG tätig, hatte Leitungsfunktionen im Bereich Datenwissenschaften in der Division Crop Science inne und ist heute Distinguished Science Fellow. Er beschäftigt sich mit computergestützten und theoretischen Methoden in der chemischen Biologie und Wirkstoffforschung, publiziert in renommierten Fachzeitschriften und ist an zahlreichen Patenten beteiligt.
Bildzeile: v.l. Ehrendoktor Craig Crews mit Honorarprofessor Michael Beck und Professor Herbert Waldmann.
Foto: MPI Dortmund

Der Spezialist für Ultraschallsensorik präsentiert seine neueste Sensorentwicklung und lädt zur Mitarbeit im Dortmunder Firmensitz am PHOENIX See ein.
Dortmund, August 2023 – microsonic stellt seinen neuen cube Ultraschallsensor mit drehbarem Sensorkopf vor. Dieser wurde von den microsonic Ingenieuren für Applikationen im Maschinenbau und in der Landtechnik entwickelt. Dank drehbarem Sensorkopf kann der Sensor in fünf Abstrahlrichtungen ausgerichtet werden und ist somit ideal an die jeweilige Einbaubedingung anpassbar. Mit der QuickLock-Montagehalterung lässt sich der cube schnell und einfach montieren. Dies ermöglicht einen Sensortausch ohne Werkzeug.
Diese neue Entwicklung lädt ein, bei microsonic am Firmenstandort Dortmund an Ultraschallsensoren mit Erfindergeist zu entwickeln und mit Finderspitzengefühl zu fertigen. Vom Dortmunder PHOENIX See vertreibt microsonic die neuste Ultraschallsensorik innerhalb von Deutschland und weltweit. „Für neue Perspektiven suchen wir talentierte Kolleginnen und Kollegen, die die Liebe zum kleinen Detail und Begeisterung für Technik mit uns teilen,“ so Johannes Schulte, Geschäftsführer der microsonic GmbH.
Interessierte Bewerberinnen und Bewerber finden unsere aktuellen Stellenangebote auf: https://www.microsonic.de/jobs
Über microsonic: microsonic gilt als Spezialist der Ultraschall-Sensorik in der industriellen Automatisierungs- und Landtechnik. Seit Gründung 1990 und mit heute mittlerweile 160 Mitarbeitern arbeitet microsonic daran, dass immer wieder neue Ultraschallsensoren in der Ruhrmetropole Dortmund entwickelt und gefertigt werden. Die Ult raschallsensoren werden in unterschiedlichen Anwendungen an Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen, Erntemaschinen in der Landwirtschaft, in der pharmazeutischen Industrie und vielen anderen Bereichen eingesetzt.
Bildzeile: microsonic Ingenieure bei der Sensorentwicklung.
Foto: Witte Wattendorff

Bund fördert Projekt NeMo.bil mit insgesamt 30 Mio. Euro
Ein Konsortium aus Industrie und Wissenschaft entwickelt im Projekt „NeMo.bil“ ein innovatives, schwarmfähiges Mobilitätssystem, das eine neue Form des nachhaltigen und bedarfsgerechten Personen- und Gütertransports im ländlichen Raum ermöglichen soll. Bis 2026 fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Projekt mit insgesamt rund 30 Millionen Euro. Von der TU Dortmund ist Prof. Johannes Weyer von der Fakultät Sozialwissenschaften an NeMo.bil beteiligt, um die sozialen Dimensionen der neuen Mobilitätslösung zu erforschen.
NeMo.bil verfolgt einen systemischen Ansatz: Es soll den öffentlichen Nahverkehr erweitern und eine individuelle öffentliche Mobilität ermöglichen, die so komfortabel ist wie die Nutzung des eigenen Autos. Das Konzept: Automatisierte kleinere Fahrzeuge, sogenannte Cabs, die die ersten und letzten Meilen bedienen, vereinen sich auf längeren Strecken zu einem Konvoi, der von einem größeren automatisierten Fahrzeug, einem sogenannten Pro gezogen wird. Die elektrifizierten Cabs sind besonders leicht sein und bieten bis zu vier Personen Platz. Die Pros dienen als mobile Ladesäulen und ermöglichen im Konvoi höhere Reichweiten und Geschwindigkeiten.
„Durch die Kombination beider Fahrzeugtypen kann das Gesamtsystem eine bisher unerreichbare energetische Effizienz aufweisen“, betont Prof. Johannes Weyer, der an der TU Dortmund eine Seniorprofessur für Nachhaltige Mobilität innehat. Sein Team bringt die sozialwissenschaftliche Perspektive in das Projekt ein, in dem insgesamt 20 Partner aus Industrie und Wissenschaft zusammenarbeiten. Die TU-Wissenschaftler*innen werden das Mobilitätsverhalten der Menschen in den Blick nehmen sowie ihre Bereitschaft untersuchen, innovative Mobilitätsangebote zu nutzen. Dazu werden sie ein agentenbasiertes Modell der Region Paderborn entwerfen und die Akzeptanz des neuen Verkehrsmittels testen. Sie werden Experimente mit dem Verkehrssimulator SimCo durchführen, der an der TU Dortmund entwickelt wurde. Das neue Modell wird reale Menschen und deren Alltagsmobilität abbilden, insbesondere die Wahl zwischen Auto, öffentlichem Verkehr, Rad – und in Zukunft – NeMo.bil.
„Mithilfe von Simulationsexperimenten kann schon vor dem praktischen Einsatz untersucht werden, ob die Menschen das neue Angebot nutzen werden und wie es gestaltet sein sollte, damit es möglichst viele anspricht“, sagt Prof. Weyer. Es gebe bereits erste Überlegungen, NeMo.bil nach erfolgreicher Implementation in Pilotanwendungen im Raum Paderborn auch im östlichen Ruhrgebiet umzusetzen.
Zur Projektwebsite:
https://nemo-paderborn.de/
Bildzeile: Kleine „Cabs“ schließen sich im Projekt zu Konvois zusammen und sollen so Kosten, Ressourceneinsatz und Emissionen reduzieren.
Foto: NeMo Paderborn

Eine Untersuchung von Prof. Christian Janiesch von der Fakultät für Informatik der TU Dortmund stellt eine gängige Annahme der KI-Forschung in Frage: „Je leistungsfähiger die Methodik, umso schwerer ist sie erklärbar.“ Anhand von Tests mit medizinischer Bilddiagnostik konnte er gemeinsam mit Kollegen aus Würzburg und Magdeburg zeigen, dass Mediziner*innen einzelne KI-Analysen teils besser, teils schlechter verständlich fanden, als auf der Basis mathematischer und programmatischer Überlegungen bisher angenommen wurde. Die Ergebnisse sind im „International Journal of Information Management“ veröffentlicht.
Hinter dem Oberbegriff Künstliche Intelligenz stecken verschiedene Verfahren, die heutzutage de facto alle auf Maschinellem Lernen fußen, d.h. die Programme haben eigenständig gelernt, wie sie entscheiden sollen. Die meisten bisherigen wissenschaftlichen Studien, die sich damit beschäftigen, wie erklärbar diese Systeme sind, verwenden dazu Annahmen, die auf mathematischen Prinzipien basieren. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass die Erklärbarkeit (explainability) sinkt, wenn die Leistung (performance) steigt. Sprich: Je komplexer die Anwendung, desto schwieriger ist sie zu erklären. Tiefe künstliche neuronale Netze sind demnach zwar überaus leistungsstark, aber für den Menschen nicht nachvollziehbar, während Entscheidungsbäume üblicherweise leistungsschwächer, aber gut erklärbar sind.
Prof. Janiesch und sein Team gingen die Frage nach der Erklärbarkeit aus einer anderen Perspektive an: Anstatt auf theoretische Modelle zu setzen, analysierten sie die Einschätzung von Fachleuten, die tagtäglich mit KI arbeiten. „Technologische Lösungen können nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn sie von Menschen angewendet werden, die das Problem auch verstehen“, erläutert der Wirtschaftsinformatiker. Dieser sozio-technische Ansatz ermöglichte es, die Erklärbarkeit aus einer realen Anwendungs- und Praxisperspektive zu betrachten. Dafür arbeiteten die Forscher mit Mediziner*innen zusammen, die einschätzten, wie nachvollziehbar verschiedene KI-Verfahren Symptome von Herzkrankheiten oder Hirnscans verarbeiteten.
Während die bisherigen Studien eine lineare oder kurvenförmige Beziehung zwischen Leistung und Erklärbarkeit vermuteten, zeigten die Untersuchungen von Prof. Janiesch und seinem Team ein gruppenartiges Muster in der Erklärbarkeit von KI-Systemen. Die Annahmen zur Leistungsfähigkeit der Systeme wurde grundsätzlich bestätigt, bei der Erklärbarkeit gab es jedoch abweichende Ergebnisse. Einige Modelle, die bisher als besser erklärbar galten, konnten die Fachleute eher schlecht nachvollziehen, oder umgekehrt. Während die tiefen künstlichen neuronalen Netze gleich bewertet wurden, gab es insbesondere bei Entscheidungsbäumen Unterschiede. Die Anwender*innen stuften sie als deutlich besser erklärbar ein, als die bisherigen Überlegungen dies suggerierten. Prof. Janiesch fügt an: „Unsere Forschung zeigt, dass die Erklärbarkeit von KI nicht nur auf mathematischen Analysen basieren sollte, sondern auf der Perspektive derjenigen, die mit dieser Technologie in der Praxis arbeiten. Denn wenn KI eingesetzt wird, müssen die Anwender*innen zunächst Vertrauen aufbauen und das geht nur, wenn nachvollziehbar gearbeitet wird.“
Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit einer stärkeren Einbindung von Fachanwender*innen in den Prozess der KI-Entwicklung und ‑Einführung, um sicherzustellen, dass die Technologie nicht nur leistungsstark, sondern auch erklärbar und praktisch nutzbar ist. Dies ist besonders relevant, wenn es um kritische Entscheidungen auf Basis von KI-Vorhersagen geht, wie etwa in der Medizin.
Zur Publikation
Lukas-Valentin Herm, Kai Heinrich, Jonas Wanner, Christian Janiesch: Stop ordering machine learning algorithms by their explainability! A user-centered investigation of performance and explainability. International Journal of Information Management, Volume 69, 2023
(https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102538)
Bildzeile: Prof. Christian Janiesch hat die Professur für Enterprise Computing an der Fakultät für Informatik der TU Dortmund inne.
Foto: Anastasia Aulbach

Vernetzte Forschung will Herausforderungen der Energiewende angehen
eim Thema Energiewende gebe es nach wie vor viele offene Fragen, sagt Prof. Dr. Yves Rosefort aus dem Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Dortmund: angefangen bei der Strom-Speicherung über den Energie-Transport bis zum Recycling von Anlagen und Geräten. Im neuen Forschungsschwerpunkt „Cloud-Energie-Lab“ vernetzen Wissenschaftler*innen der FH ihre Arbeit, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln.
Kernelement des neuen Forschungsschwerpunkts ist eine zentrale Cloud. In diesem virtuellen Datenspeicher laufen die Ergebnisse aus Forschung und Lehre, Daten aus Simulationen, von den Prüfständen und Real-Laboren ein. Zugleich lässt sich über die Cloud die Hardware in den Laboren steuern und vernetzen. „Wir arbeiten hierbei interdisziplinär zusammen“, betont Prof. Dr. Martin Kiel, Prodekan am Fachbereich Elektrotechnik. Neben seinem Fachgebiet und Aspekten des Maschinenbaus spielen wirtschaftliche Faktoren ebenso eine Rolle wie soziale Überlegungen. „Dieses Zusammenspiel in einem Forschungsschwerpunkt ist herausragend“, lobt Prof. Kiel.
Die Vorteile an einem praktischen Beispiel erklärt: Im „Cloud-Energie-Lab“ können die Expert*innen der Elektrotechnik sehen, wie ihre Batterie in Verbindung mit der Brennstoffzelle der Maschinenbauer*innen reagiert. Sie können echte Langzeittests mit simulierten Daten verknüpfen und Szenarien prüfen: Welche Herausforderungen bestehen für die Netze? Wie können Energielasten sinnvoll gesteuert werden? Wo speichern wir grünen Strom zwischen? „Es gibt da nicht die systemische Lösung, die für alle gleich gut ist“, sagt Prof. Kiel. Darum sollen im Cloud-Energie-Lab die individuellen Bedürfnisse der Anwender*innen abgebildet werden.
„In der laufenden Diskussion sehe ich eine teils verhärtete Front zwischen Befürwortern der Wasserstoff-Technologie und der Batterie-Technologie“, ergänzt Prof. Rosefort. Doch beide Technologien seien richtig und zukunftsrelevant. Es gehe nicht um ein Gegeneinander, sondern um einen klug vernetzten Einsatz. „Dabei schauen wir immer auf die Machbarkeit unter realen Bedingungen, auf die Kosten und die CO2-Gesamtbilanz inklusive Recycling“, so der Wissenschaftler. Der Fokus liege zudem auf der Resilienz des Energiesystems in Gänze. Welche Maßnahmen sichern die Versorgung, wenn mal etwas ausfällt?
Im „Cloud-Energie-Lab“ werden die Forschenden mit verschiedenen Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten. Auch die Lehre spielt im neuen Forschungsschwerpunkt eine wesentliche Rolle. „Die Energiewende ist nur mit guter Ausbildung im Ingenieurstudium zu stemmen. Daran arbeiten wir an der FH Dortmund“, sagt Prof. Rosefort. Sowohl der Berufszweig des Maschinenbaus als auch die elektrotechnischen Fachrichtungen bieten grüne Zukunftsberufe.
Hintergrund:
Das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft fördert den neuen Forschungsschwerpunkt „Cloud-Energie Lab“ mit 240.634,80 Euro im Programm „Focus Forschung – HAW-Kooperation“. Die FH Dortmund stellt zudem eigene Mittel bereit. Der Forschungsschwerpunkt umfasst mehrere Fachbereiche. Zu den beteiligten Professor*innen zählen neben Prof. Dr. Martin Kiel und Prof. Dr. Yves Rosefort auch Prof. Dr. Torsten Füg, Prof. Dr. Vinod Rajamani und Prof. Dr. Markus Thoben, sowie der neuberufene Prof. Dr. Sönke Gößling.
Bildzeile: Im neuen Forschungsschwerpunkt Cloud-Energy-Lab wollen Prof. Dr. Martin Kiel (l.) und Prof. Dr. Yves Rosefort (r.) sowie zahlreich weitere Lehrende der FH Dortmund ihre Daten aus den verschiedensten Laboren bündeln.
Foto: Benedikt Reichel für die FH Dortmund

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger überreichte Prof. Tessa Flatten von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dortmund in Berlin die UNIPRENEURS-Auszeichnung: Der Preis der Ministerien für Wissenschaft und Wirtschaft ehrt Professor*innen für herausragende Leistungen im Bereich der Hochschulausgründungen. Aus rund 700 Nominierungen wurden 20 Persönlichkeiten ausgewählt, die bedeutende Beiträge zum Transfer von Innovationen in die Wirtschaft leisten.
Schon heute entsteht etwa ein Viertel aller deutschen Start-ups im hochschul- und forschungsnahen Umfeld. „Wir wollen das Gründungsgeschehen an unseren Hochschulen stärken. Professorinnen und Professoren spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie tragen maßgeblich zur Gründungskultur an Hochschulen bei und sind wichtige Impulsgeber für die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit Deutschlands“, sagte Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, bei der Preisverleihung in Berlin.
„Die Auszeichnung ist eine große Ehre“, sagt Prof. Tessa Flatten. „Transfer ist neben Forschung und Lehre eine weitere zentrale Aufgabe einer Universität. Ich freue mich außerordentlich über die UNIPRENEURS-Auszeichnung, da sie den Themen Ausgründung und Unternehmertum an Hochschulen mehr Sichtbarkeit verleiht.“ Tessa Flatten ist seit 2015 Professorin für Technologiemanagement an der TU Dortmund und seit 2020 als Mitglied im Rektorat für den Bereich Internationales zuständig. Sie forscht zum Unternehmertum, insbesondere zum Entrepreneurial Marketing sowie zur Gründer*innen-Persönlichkeit. Seit 2021 leitet sie als Direktorin gemeinsam mit Prof. Steffen Strese das Institut für Technologie, Innovation und Entrepreneurship (TIE) an der TU Dortmund.
Schon während ihres Studiums an der RWTH Aachen war Tessa Flatten selbst unternehmerisch tätig und konnte zum Beispiel im Familienunternehmen den Aufbau der Marke Maui Sports begleiten. Ihr Wissen und ihre Erfahrung aus Wirtschaft und Wissenschaft gibt sie sowohl an Studierende verschiedener Disziplinen als auch an Start-ups weiter. Sie engagiert sich als Mentorin für Gründer*innen in unterschiedlichen Phasen und unterstützt die vielfältigen Aktivitäten des Centrums für Entrepreneurship & Transfer der TU Dortmund.
Bildzeile: Prof. Tessa Flatten (Mitte) erhält die Auszeichnung der Initiative UNIPRENEURS von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (r.) und Dr. Anna Christmann (l.), Beauftragte für Digitale Wirtschaft und Start-ups des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
Foto: Jürgen Aloisius Morgenroth

Insgesamt rund 5,8 Millionen Euro
Im Rahmen des Programms „Horizon Europe“ fördert die Europäische Union mit insgesamt rund 5,8 Millionen Euro für vier Jahre das Projekt HealingBat. Prof. Stefan Palzer von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dortmund koordiniert das internationale Vorhaben, bei dem zehn Partner aus sechs europäischen Ländern zusammenarbeiten. Ziel ist es, eine neue Generation von Batterien zu entwickeln, die sich selbst reparieren können und somit langlebiger und nachhaltiger sind.
„Verschiedene Prozesse in herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien führen dazu, dass diese nach einer bestimmten Zeit nicht mehr funktionieren“, sagt Stefan Palzer, Professor für Sensorik und Projektkoordinator von HealingBat. „Wir werden daher den Einsatz neuer Materialien erproben, die die Mechanismen, die bislang zum Versagen der Batterie führen, heilen und somit deren Lebenszeit deutlich verlängern können.“ In die neue Klasse selbstheilender Batterien auf der Basis von Lithium-Schwefel werden die Forscher*innen Sensoren einbetten, die möglichst frühzeitig Probleme detektieren sollen, sowie Aktoren, die dann die Selbstheilungsprozesse innerhalb der Batterie auslösen.
In HealingBat arbeitet das Team der Professur Sensorik von der TU Dortmund mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin, der Coventry University (Vereinigtes Königreich), der TU Delft (Niederlande), dem Paul Scherrer Institut (Schweiz) und dem Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Spanien) sowie den Praxispartnern CPI (Vereinigtes Königreich), IDNEO (Spanien), FI Group (Portugal) und SupraPolix (Niederlande) zusammen. Von den etwa 5,8 Millionen Euro EU-Förderung entfallen rund 800.000 Euro auf die TU Dortmund.
HealingBat wird im Rahmen von Horizon Europe in der Initiative Battery2030+ gefördert. Ziel der EU-Initiative ist es, wieder eine führende Rolle auf dem Gebiet der Batterien einzunehmen, indem sie die Entwicklung der zugrundeliegenden Technologien beschleunigt, um eine europäische Industrie zur Herstellung von Batterien zu ermöglichen, die nachhaltige Energie nutzt und die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft umsetzt.
Bildzeile: Zum Projektauftakt kamen die Partner Anfang Juni an der TU Dortmund zusammen und besuchten unter anderem gemeinsam das Phoenix-West-Gelände.
Foto: Michael Jakubowsky für die TU Dortmund

Fahrradkurs für internationale Studierende der Fachhochschule Dortmund
Die FH Dortmund hat zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) erstmals einen Fahrradkurs für internationale Studierende angeboten. Auf dem Übungsgelände der Jugendverkehrsschule im Fredenbaumpark wurden grundlegende Regel erklärt, bevor es gemeinsam in den Verkehrsdschungel auf die Straßen durch die Dortmunder Nordstadt ging.
Das International Office und das Mobilitätsmanagement der FH Dortmund wollen mit diesem Angebot Studierende aus anderen Ländern unterstützen und sie an der Mobilitätswende in Deutschland teilhaben lassen. Moritz Niermann vom Mobilitätsmanagement: „Wir haben an der FH Dortmund eine große internationale Studierendengemeinschaft. Der Fahrradkurs bietet den Studierenden die Möglichkeit, Dortmund auf umweltfreundliche Weise zu erkunden und trägt dazu bei, dass sich die Studierenden während ihres Aufenthalts in Dortmund sicher und wohlfühlen.“
Der ADFC brachte seine langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich des Fahrradfahrens ein. Die Teilnehmenden erhielten theoretischen Unterricht zu den Verkehrsregeln und -vorschriften in Deutschland und sammelten anschließend praktische Erfahrungen, um sich sicher im Verkehr bewegen zu können. Dieses neue Wissen wurde abschließend bei einer Radtour durch die Dortmunder Nordstadt direkt angewendet.
Bildzeile: Moritz Niermann vom Mobilitätsmanagement der FH Dortmund und Werne Blanke vom ADFC zeigten den Studierenden die Regeln im Radverkehr.
Foto: Benedikt Reichel für die FH Dortmund

Wissenschaftler*innen wollen Entwicklungsprojekte professionalisieren
Die Fachhochschule Dortmund baut ihre Internationalisierungsaktivitäten aus. Mit dem SusProLab – Kurzform für „Sustainable Project Management Lab“ – wird eine internationale Forscher*innengruppe zu nachhaltigem Projektmanagement unter Beteiligung der COMSATS Universität in Islamabad (Pakistan) und der FH Dortmund initiiert.
Das Ziel des SusProLab: Entwicklungsprojekte in Pakistan zu nachhaltigem Erfolg führen. Denn bislang bleiben viele Projekte in dem Land hinter den Erwartungen zurück. „Eine höhere Erfolgsquote und verbesserte Nachhaltigkeit und Langzeitwirkung der Projekte ist substanziell für die Entwicklung des Landes“, betont Prof. Dr. Carsten Wolff, Informatik-Professor am Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten (IDiAL) der FH Dortmund. Dabei gehe es nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltige Aspekte. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterstützt das Projekt mit fast 80.000 Euro für zwei Jahre.
Professor Carsten Wolff ist zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit trotz der 5.529 Kilometer Luftlinien-Distanz schnell und reibungslos funktionieren wird, denn die Projektpartner kennen sich bereits. Prof. Dr. Rao Aamir Ali Khan, Assistenzprofessor für Management Studies an der COMSATS in Islamabad, hat an der FH Dortmund seinen Abschluss im „European Master in Project Management“ (EuroMPM) gemacht. An der Universität Kassel promovierte er danach zusammen mit Prof. Dr. Jan Christoph Albrecht, der 2021 als Professor für Projektmanagement an die FH Dortmund berufen wurde. Und eine Studentin, die Prof. Khan in Pakistan erfolgreich zum Masterabschluss geführt hat, promoviert inzwischen an der FH Dortmund in Kooperation mit der Universität des Baskenlandes in Bilbao. „Forschungs- und Lehrkooperation zwischen der COMSATS und der FH Dortmund bestehen bereits“, sagt Carsten Wolff. „Diese wollen wir deutlich ausbauen.“
Konkret will sich die Forscher*innengruppe Projekte zur Installation sogenannter Mini Hydro Power Plants (MHPP) anschauen. Diese Mini-Wasserkraftwerke eignen sich für die dezentrale Stromversorgung im ländlichen Raum. Jedoch werden viele der von internationalen Geldgebern geförderten MHPPs nicht fertiggestellt oder sind nach kurzer Zeit nicht mehr funktionsfähig. Hier setzt die Arbeit des SusProLab ein. Die Forscher*innen wollen Lösungen entwickeln, die ein Fortbestehen der Projekte sicherstellen. Wo gibt es rechtliche Hürden? Wie kann die Gemeinschaft im Ort nachhaltig eingebunden werden? Dazu werden Forschende und Studierende aus Pakistan und Deutschland zusammenarbeiten. Carsten Wolff geht davon aus, dass in dem Projekt zudem mehrere Master- und Doktorarbeiten zwischen Studierenden aus Pakistan, der FH Dortmund und den EuroPIM-Universitäten entstehen können und so die Basis für ein langfristiges Lehr- und Forschungsengagement gelegt wird.
Bildzeile: Prof. Dr. Casten Wolff
Foto: Matthias Kleinen für die FH Dortmund

Die ersten FH-Maschinenbau-Absolventen besuchten ihre Alma Mater
Gespannt und neugierig wie die Erstsemester kehrten die Absolventen des Fachbereichs Maschinenbau/Konstruktionstechnik des Jahrgangs 1972 nach mehr als 50 Jahren an ihre Fachhochschule Dortmund zurück. Ihr Ausbildung hatten sie noch an der „Staatlichen Ingenieurschule für Maschinenwesen“ begonnen, die 1971 in der neugegründeten FH Dortmund aufging. Sie zählen damit zu den ersten offiziellen FH-Dortmund-Absolventen.
Der Fachbereich Maschinenbau nahm sich viel Zeit, um die Alumni und ihre Ehefrauen über den Campus an der Sonnenstraße zu führen. Maschinenbau-Dekan Prof. Dr. Thomas Straßmann berichtete über moderne Lehre und Forschung am Fachbereich. Beim Besuch in den Laboren erlebten die Ehemaligen neue Anwendungsfelder wie Robotik und industriellen 3D-Druck. „Es war für uns ein besonderes Ereignis, unsere alte Studienstätte und ihre positive Entwicklung erleben zu dürfen“, sagte Hans-Georg Manns, Absolvent des Jahrgangs 1972, der die jährlichen Treffen der Ehemaligen organisiert. Der Besuch habe gezeigt, wie sich die FH Dortmund den Herausforderungen neuer Zeiten stellte und sich immer wieder erfolgreich anpasse.
Bildzeile: Maschinenbau-Dekan Prof. Dr. Thomas Straßmann (Mitte) und Prof. Dr. Andreas Kleinschnittger (rechts), Lehrender für Technisches Zeichnen und Konstruktionselemente am Fachbereich Maschinenbau, empfingen Ende September fünf Absolventen des ersten FH-Dortmund-Abschluss-Jahrgangs (1972) und zeigten ihnen ihre Alma Mater.
Foto: FH Dortmund

Engagement für Chancengleichheit und Vielfalt gewürdigt
Die Fachhochschule Dortmund wurde mit dem Prädikat „Total E-Quality“ ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in Dortmund wurde die Urkunde für gelungenes und nachhaltiges Engagement für Chancengleichheit und Vielfalt überreicht.
Die Auszeichnung „Total E-Quality“ wird bereits zum 30. Mal vom gleichnamigen Verein an Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung vergeben. Die FH Dortmund hatte sich erstmals um den Titel beworben. „In unserer Bewerbung haben wir dargelegt, wie wir an der FH Dortmund Chancengleichheit und Diversität praktisch umsetzen“, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte Sonja Hunscha. Sie nahm die Urkunde gemeinsam mit Dr. Ramona Schröpf, Prorektorin für Kommunikation und Internationalisierung, sowie Prof. Dr. Stephan Weyers, Prorektor für Lehre und Studium, entgegen.
In ihrer Begründung lobt die Jury die Chancengleichheitsstrategie der FH Dortmund, welche die Standards in den verschiedenen Aktionsfeldern „hervorragend erfüllt“. Die Auszeichnung der FH Dortmund erfolge „aufgrund des beispielhaften Handelns im Sinne einer geschlechter- und diversitätsgerecht ausgerichteten Organisationskultur“. Um einen kompakten Überblick der hochschulweiten Maßnahmen geben zu können, hatte Sonja Hunscha mit vielen Kolleg*innen aus mehreren Bereichen der Hochschule zusammengearbeitet.
Die Jury greift auf, dass die FH auch aktiv ist in den Bereichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Bildungsgerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit. Zugunsten der Chancengleichheit zeige die FH außerdem „viel Engagement in der Region, um Studierende aus Nicht-Akademikerfamilien in ihrer Lebenswelt anzusprechen, zu gewinnen und zu halten.“ Insgesamt wurden in Dortmund 57 Preisträger*innen aus dem gesamten Bundesgebiet ausgezeichnet.
Hintergrund zu: Total E-Quality Deutschland e.V.
Der Verein Total E-Quality Deutschland e.V. würdigt mit seinem Prädikat Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, die sich besonders für Geschlechter- und Diversitätsgleichheit in ihren Institutionen einsetzen und um die Auszeichnung bewerben können. Die Preisverleihung findet jährlich an wechselnden Orten statt, in diesem Jahr bei „BIG direkt gesund“ in Dortmund.
Weitere Informationen:
www.total-e-quality.de
Bildzeile: Dr. Ramona Schröpf (2.v.l.), Prorektorin für Kommunikation und Internationalisierung, Prof. Dr. Stephan Weyers, Prorektor für Lehre und Studium, und Sonja Hunscha, Gleichstellungsbeauftragte an der FH Dortmund, nahmen die Urkunde von den Vorstandsvorsitzenden des Vereins, Dr. Ulla Weber (l.) und Udo Noack (r.), entgegen.
Foto: Sarah Rauch / Total E-Quality Deutschland e.V.

Das Race-Ing. Team der Fachhochschule Dortmund blickt auf eine erfolgreiche Rennsaison zurück. Erstmals seit 2015 bestand ein eigenhändig konstruierter Rennwagen der FH Dortmund jede einzelne der anspruchsvollen technischen Inspektionen und durfte am Hauptrennen der Formula Student Germany auf dem Hockenheimring teilnehmen.
Mit Platz 13 in der Klasse Formula Student Combustion der Formula Student Germany ist das Race-Ing. Team um Teammanagerin Zeliha Alak hochzufrieden und blickt motiviert auf die kommende Saison. Dabei werden wieder maßgebliche Elemente des Rennwagens getauscht, verändert und erneuert – so wie es das Regelwerk vorschreibt. Denn bei der Formula Student ist die Zeit auf der Rennstrecke nur ein kleiner Teil der Wertung. Konstruktion, Innovation, Business-Plan und Marketing-Aktivitäten zählen ebenfalls dazu.
Dafür arbeiten Studierende verschiedener Fachbereiche zusammen und Nachwuchskräfte aus der Studierendenschaft sind immer gern gesehen. „Wir agieren autonom wie ein eigenständiges Unternehmen mit verschiedenen Bereichen“, erklärt Zeliha Alak beim Saison-Abschluss am Forschungs- und Technologiezentrum LaSiSe in Selm.
Hier präsentierte das Race-Ing. Team seinen erfolgreichen Rennwagen in Aktion und hatte dazu auch Sponsoren geladen. Denn für die neue Saison wird frisches Kapital benötigt. „Neben einem neuen Motor soll das Monocoque, also die Karossiere des Wagens, überarbeitet werden“, erklärt Daniel Jovanovic, Leiter der Abteilung Motor. Im Februar 2024 beginnt die Fertigungsphase für den neuen Rennwagen. Den circa 30 FH-Studierenden des Teams stehen dann wieder lange Tagen bevor: bis zu 70 Wochenstunden zusätzlich – neben dem Studium.
„Im Race-Ing. Team leben unsere Studierenden die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit an der FH Dortmund“, lobt Prof. Dr. Tamara Appel, Rektorin der FH Dortmund, das Engagement. Wer im Team dabei sei, könne eine Fülle praxisnaher Erfahrungen sammeln. „Für die nächste Saison wünsche ich dem Race-Ing. Team viel Erfolg“, so die Rektorin.
Bildzeile: Das Race-Ing. Team der Fachhochschule Dortmund zusammen mit Rektorin Prof. Dr. Tamara Appel (2.v.l.) beim Saison-Abschluss am Forschungs- und Technologiezentrum LaSiSe. Das Team besteht aus Studierenden der Ingenieurswissenschaften sowie der Fachbereiche Wirtschaft und Design.
Foto: Benedikt Reichel für die FH Dortmund

Mit der automatischen digitalen Vermessung von Herzklappen bei Operationen beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Robotic Vision von Prof. Dr. Jörg Thiem in einem neuen Forschungsprojekt an der Fachhochschule Dortmund. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, neue Standards zu setzen.
Als wichtiges Ventil sorgt eine kleine Klappe im menschlichen Körper dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt – nämlich von der linken Herzkammer in die größte Schlagader, die Aorta. Wenn diese Aortenklappe mit ihren drei halbmondförmigen Taschen aus hauchdünnem Gewebe nicht mehr funktioniert, ist eine Operation erforderlich und besondere chirurgische Expertise gefragt. Denn dann geht es um Millimeterarbeit am offenen Herzen.
Mit möglichst exakten Messdaten unterstützen soll die Mediziner*innen bei ihren Entscheidungen künftig IDA, die „Intraoperative Digitale Aortografie“. Für dieses Ziel ist am Fachbereich Informationstechnik der Fachhochschule Dortmund jetzt ein Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Thiem gestartet, das bis September 2025 läuft. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat für die Entwicklung von „Algorithmen zur automatischen Detektion von Merkmalen in Aortenklappen“ 441.180 Euro aus dem Förderprogramm „KMU-innovativ Medizintechnik“ bewilligt.
„Um auf den Aortenklappen charakteristische, medizinisch relevante Messpunkte automatisch zu erfassen, erforschen wir Bild-Erkennungsmethoden, die auf Künstlicher Intelligenz basieren“, erläutert Jörg Thiem. Kooperationspartner ist die Klavant GmbH, ein Medizintechnik-Hersteller im ostwestfälischen Minden. Das Unternehmen entwickelt ein neues Verfahren, um die Aortenklappe während der Operation am geöffneten Brustkorb mit mehreren Kameras zu erfassen. Anhand dieser Aufnahmen, die sich dreidimensional darstellen lassen, wird das digitale Maßband des Dortmunder Forschungsteams dann direkt Live-Ergebnisse liefern.
„Das optische 3D-Messverfahren soll den Therapieerfolg in der Aortenklappen-Chirurgie signifikant steigern, wenn es etwa darum geht, Folgeoperationen zu vermeiden oder eine optimale Prothese auszuwählen und einzusetzen”, erklärt Michael Bogatzki, Geschäftsführer der Klavant GmbH.
„Bislang ist es vor allem von der Erfahrung und dem Augenmaß der Chirurg*innen abhängig, wie gut die Operationen gelingen“, so Projektleiter Jörg Thiem, zugleich Prorektor für Forschung und Transfer an der FH Dortmund. Zu seinem Forschungsteam gehören die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter Dominik Fromme und Tim Streckert sowie Matthis Hofmann als wissenschaftliche Hilfskraft. Sie werden gemeinsam mithilfe unterschiedlicher Aufnahmen von Herzklappen an der automatischen Bild-Erkennung arbeiten und sich auch mit medizinischem Fachpersonal beraten.
Informationen zum Fachbereich:
www.fh-dortmund.de/informationstechnik
Bildzeile: Projektleiter Prof. Dr. Jörg Thiem vom Fachbereich Informationstechnik der Fachhochschule Dortmund.
Foto: Roland Baege für die FH Dortmund

Ein Plan für nicht planbare Veränderungen
Unter dem Namen „DigiTransPro“ entsteht an der Fachhochschule Dortmund ein neuer Forschungsschwerpunkt zu digitalen Transformationsprozessen. Die Frage, der Lehrende, Promovierende und Studierende insbesondere der Fachbereiche Informatik und Wirtschaft nachgehen wollen, lautet: Wie kann der digitale Wandel in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft gestaltet werden?
„Digitalisierung ist die technische Automatisierung vorhandener Prozesse“, erklärt Prof. Dr. Carsten Wolff, Lehrender am Fachbereich Informatik und im Vorstand des Instituts für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten (IDiAL) der FH Dortmund. „Transformation ist einen Schritt größer. Sie beschreibt eine Entwicklung, die bisher so nicht möglich und damit auch so nicht vorhersehbar war.“ Messenger-Dienste und Social Media etwa seien eine Transformation der Kommunikation. Ähnliche Umbrüche durchlaufen aktuell viele Branchen.
Wenn Prof. Wolff über (digitale) Transformation spricht, beginnt er auch mal bei Leonardo Da Vincis Schuhmacher: „Der konnte sich im 15. Jahrhundert auch nicht vorstellen, dass wir heute Schuhe irgendwo auf der Welt produzieren, ohne den Fuß ausgemessen zu haben. Und dass wir diese Schuhe in Geschäfte stellen, ohne zu wissen, ob sie dort gekauft werden.“ So aber funktioniert der Schuhmarkt heute. Auch die Industrielle Revolution war eine Transformation. „Die Industrialisierung hat sich durchgesetzt, denn die Massenproduktion mit standardisierten Verfahren war effizienter“, erklärt Carsten Wolff. Wenn digitale Transformation die Effizienz ebenfalls steigert, werde sie sich auch durchsetzen. Was das für den Schuhkauf bedeutet, weiß auch Professor Wolff heute noch nicht: „Vielleicht schaue ich bald nur in eine Kamera und eine KI erstellt den passenden Schuh nach meinen Wünschen – ohne, dass ich diese aussprechen muss. Wir sind bei der digitalen Transformation noch ganz am Anfang.“
Die Herausforderung liegt darin, Veränderungsprozesse zu gestalten, ohne vorab schon das Ergebnis zu kennen. „Genau dafür wollen wir Methodiken generieren, die sich an bestehenden Ideen des Projektmanagements orientieren, aber auch darüber hinausgehen“, erklärt Dr. Jan Christoph Albrecht, Professor für Projektmanagement am Fachbereich Wirtschaft. Mit dem internationalen Studiengang „European Master in Projekt Management“ sei die FH Dortmund dafür bereits gut positioniert. „Wir wollen Projektmanagement in allen Fachrichtungen und möglichst vielen Studiengängen der FH Dortmund verankern“, ergänzt Carsten Wolff. Diese interdisziplinäre Ausrichtung sei wichtig, um den technologischen Wandel mit neuen Partizipationsansätzen voranzutreiben.
„Digitale Transformation betrifft nicht nur ein einzelnes Unternehmen oder eine einzelne Branche, sie wirkt in die Gesellschaft“, betont auch Prof. Albrecht. Darum benötigen Veränderungsprozesse ein gutes Management. Heißt: den Wandel Schritt für Schritt vorantreiben, dabei alle Beteiligten mitnehmen und zugleich die große Vision nicht aus den Augen verlieren. Carsten Wolff: „In vielen Ländern ist Projektmanager*in bereits eine geschützte Berufsbezeichnung, die eine Ausbildung erfordert. In Deutschland haben wir noch Nachholbedarf. Mit DigiTransPro werden wir dazu beitragen, Veränderungsprozesse zu professionalisieren.“
Hintergrund:
Der Aufbau des Forschungsschwerpunkts wird im Projekt „DigiTransPro – Digital Transformation Projects: Projektmanagement für digitale Transformation“ durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mit 277.486 Euro im Programm „Focus Forschung – HAW-Kooperation“ gefördert. Neben Prof. Dr. Carsten Wolff und Prof. Dr. Jan Christoph Albrecht sind auch Prof. Dr. Marco Boehle mit seinem Schwerpunkt proaktives Kostenmanagement und digitales Controlling sowie Prof. Dr. André Dechange mit dem Schwerpunkt Projektmanagement am Aufbau des neuen Forschungsschwerpunkts beteiligt.
Bildzeile: Das Projektteam von „DigiTransPro“ an der FH Dortmund: v.r. Prof. Dr. Jan Christoph Albrecht, Prof. Dr. Carsten Wolff, Hermina Motruk, Prof. Dr. André Dechange und Prof. Dr. Marco Boehle.
Foto: Benedikt Reichel für die FH Dortmund

Gegen den Lehrkräftemangel
Das Programm Peer Mentoring im Lehramt geht an der TU Dortmund in die zweite Runde: Nach dem erfolgreichen Probelauf im Sommersemester unterstützt erneut rund ein Dutzend erfahrene Studierende Neulinge bei ihrem Start ins Bachelorstudium Lehramt. Das Mentoring-Programm ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen das Dortmunder Kompetenzzentrum für Lehrerbildung und Lehr-/Lernforschung (DoKoLL) einen Beitrag gegen den Lehrkräftemangel an Schulen leisten will.
Beim Peer Mentoring im Lehramt helfen Studierende aus höheren Fachsemestern als Mentor*innen Studienanfänger*innen beim Einstieg in den Unialltag und bei Fragen rund um das Lehramtsstudium sowie den zukünftigen Beruf. Ziel ist es, den angehenden Lehrkräften durch einen informellen Austausch unter Kommiliton*innen dabei zu helfen, die ersten Herausforderungen zu meistern und so ihr Durchhaltevermögen zu stärken. Schließlich ist in den ersten Semestern erfahrungsgemäß der größte Schwund in einem Studienfach zu beobachten. „Gemeinsam können wir Fragen der Mentees zu Beginn des Studiums klären und individuelle Lösungen finden. Außerdem ist es toll zu sehen, wie die neuen Studis sich untereinander austauschen und Anschluss zu anderen finden“, erklärt Fatima Kubat, die sich seit April als Mentorin in dem Programm engagiert. Noch bis zum 15. Dezember können sich Lehramtsstudierende im ersten oder zweiten Semester als Mentees bewerben.
Insgesamt sind derzeit über 7.500 Lehramtsstudierende an der TU Dortmund eingeschrieben. Die Universität bietet als eine von wenigen Hochschulen Studiengänge für alle fünf Schulformen an, darunter auch für jene, die derzeit besonders stark vom Lehrermangel betroffen sind wie Grundschulen, Förderschulen und Berufskollegs. Die Zahl der Erst- und Neueinschreibungen im Lehramt konnte zum Wintersemester um mehr als zehn Prozent gesteigert werden. „Die TU Dortmund hat als Reaktion auf den Lehrkräftemangel zum Wintersemester 23/24 zusätzliche Studienplätze in den besonders nachgefragten Lehramtsstudiengängen Grundschule und Sonderpädagogische Förderung geschaffen. Mit Peer Mentoring im Lehramt legen wir den Fokus darauf, unsere Studierenden auf dem ersten Teil ihres Wegs in den Schuldienst bestmöglich zu unterstützen“, sagt Dr. Hanna Altmeppen, Geschäftsführerin des DoKoLL.
Die wissenschaftliche Koordination des Programms verantwortet Eva Sara Kubitzek: „Lehramtsstudierende, die sich als Mentoren oder Mentorinnen im Programm anmelden, haben sich oftmals selbst mehr Unterstützung zu Beginn ihrer Studienzeit gewünscht, z.B. beim Knüpfen von Kontakten zu Mitstudierenden, beim Zurechtfinden auf dem Campus oder dem Zeitmanagement in der ersten Prüfungsphase. Peer Mentoring im Lehramt setzt genau da an und schafft Räume, in denen Kommiliton*innen sich miteinander vernetzen, einander Tipps geben können.“
Für einen erfolgreichen Start in die Lehramtskarriere
Peer Mentoring im Lehramt ist Teil des Projekts „talents4teachers / teachers4talents“ (t4t), das das Land NRW seit 2021 im Rahmen der Ruhr-Konferenz fördert, um Chancengerechtigkeit im Ruhrgebiet zu stärken. Ziel des Projekts ist es, Schüler*innen für ein Lehramtsstudium zu gewinnen, Lehramtsstudierende auf dem Weg zum Berufseinstieg zu unterstützen und angehende Lehrer*innen für Bildungsgerechtigkeit im Unterricht zu sensibilisieren. Dabei leistet auch das Talentscouting der TU Dortmund einen Beitrag, indem die Scouts Schüler*innen unabhängig von ihrer Herkunft Wege zum Lehramtsstudium aufzeigen. Die TU Dortmund trägt das Projekt t4t gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen in der Universitätsallianz Ruhr.
Zur Webseite von Peer Mentoring im Lehramt:
https://dokoll.tu-dortmund.de/entwicklung-und-forschung/t4t/peer-mentoring-im-lehramt/
Bildzeile: Peer Mentoring im Lehramt geht dieses Semester in die nächste Runde.
Foto: Felix Schmale für die TU Dortmund

Bei der Akademischen Jahresfeier wurden 26 Studierende ausgezeichnet
Festliches Ambiente in der Stahlhalle der Deutschen Arbeitsschutz-Ausstellung (DASA) und freudige Gesichter bei 26 Absolvent:innen der Fachhochschule Dortmund: Die akademische Jahresfeier im November 2023, bildete den Höhepunkt des Hochschuljahres und würdigte 26 herausragende studentische Leistungen.
„Sie haben an unserer Fachhochschule gelernt, geforscht und gelebt. Sie haben sich in einer enormen Tiefe mit Ihrem Fach beschäftigt“, lobte Prof. Dr. Tamara Appel. Die Rektorin hob das große Engagement der Studierenden hervor. „Mit den Kompetenzen, die Sie bei uns erlangt haben, werden Sie Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit entwickeln und den friedlichen und freien Austausch der Wissenschaft stärken.“ Lobende Worte gab es auch von Celine Carstensen-Opitz, Vorsitzende der Fördergesellschaft der FH Dortmund und Mitglied des Vorstands der VOLKSWOHL BUND Versicherung: Die Abschlussarbeiten spiegelten die Themenvielfalt der FH Dortmund.
Für die besten Bachelor- und Masterarbeiten eines jeden Fachbereichs würdigte die Fördergesellschaft: Luisa Bebenroth (Design), Alexander Block & Sven Walter (Angewandte Sozialwissenschaften), Rica Grünebaum (Wirtschaft), Aron Hemmis (Informationstechnik), Clemens Kurzeya (Informatik), Felix Smyrek (Maschinenbau), Fabian Teschke (Elektrotechnik) und Christian Väth (Architektur). In ihren Dankesworten lobten Studierende die persönliche und kompetente Unterstützung durch die Lehrenden an der FH Dortmund, die moderne technische Ausstattung und das kulturell vielfältige und respektvolle Miteinander. „Man hatte nie das Gefühl, nur eine Matrikelnummer in einem größeren System zu sein“, so ein Preisträger.
Die Fördergesellschaft unterstützt die anwendungsbezogene Lehre und Forschung und zeichnet Arbeiten aus, die konkrete Probleme lösen und Prozesse verbessern. Den Forschungspreis 2023 erhielt Prof. Dr. Nicole Knuth vom Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften. Seit zehn Jahren forscht sie kontinuierlich zu Kindern und Jugendlichen in der Heimerziehung insbesondere zu deren Chancen auf Mitbestimmung sowie Unterstützung für die Familien. „Unsere Projekte haben etwa dazu beigetragen, dass Kommunen rechtlich verpflichtet wurden, Ombudsstellen für Eltern und Kinder aufzubauen sowie die Selbstvertretungsorganisation von Betroffenen zu stärken“, so die Wissenschaftlerin.
Der Preis für ausgezeichnete Lehre ging an Prof. Dr. Thomas Felderhoff vom Fachbereich Informationstechnik. Seine Lehrveranstaltungen seien nicht nur verständlich, sondern machten auch Spaß, lobten die Studierenden. Er könne komplexe theoretische Konzepte verständlich vermitteln. Er nehme sich Zeit, sei stets ansprechbar und zeige aufrichtiges Interesse an den Anliegen der Studierenden. „Sein Vertrauen in uns motiviert uns, unsere Grenzen zu überschreiten und uns selbstbestimmt weiterzuentwickeln“, so der Fachschaftsrat.
Weitere Würdigungen dieses Abends:
Preis der Fördergesellschaft für herausragende kooperative Promotion:
Nadine Richter (Angewandte Sozialwissenschaften)
Förderpreis des Soroptimist International Clubs Dortmund:
Lilli Riesenweber (Elektrotechnik)
Cornelia-Därmann-Nowak-Preis des Soroptimist International Clubs Dortmund Hellweg:
Kerstin Sander (Maschinenbau)
Preis der Rudolf-Chaudoire-Stiftung:
Fachbereich Elektrotechnik: Nico Hölter, Dennis Karl, Mike Kreusel
Fachbereich Maschinenbau: Damian Arndt, Philip Blechmann, Max Linnemann
Fachbereich Informationstechnik: Matthis Hofmann, Maximilian Kleist, Robin Pape
Preis der KARL-KOLLE-Stiftung:
Tobias Semer und Tim Hendrik Sedlatschek (Maschinenbau)
Heinrich-Frommknecht-Preis:
Alexander Honermann und Christian Zahn (Wirtschaft)
Preis des Deutschen Akademischen Austauschdiensts:
Zekarias Fikadu Tiruneh (Informatik)
Bildzeile: 26 Studierende und zwei Professor*innen wurden bei der Akademischen Jahresfeier 2023 der Fachhochschule Dortmund ausgezeichnet. Zum Abschluss in der Dortmunder DASA versammelten sich alle Preisträger*innen und Stifter*innen auf der Bühne.
Foto: Roland Baege für die FH Dortmund

Prof. Reinhard Genzel zu Gast an der TU Dortmund
2020 hat Prof. Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München, den Nobelpreis für Physik erhalten. Im November 2023 hat er vor rund 1000 Gästen, die sich auf das voll besetzte Audimax und einen zusätzlichen Hörsaal verteilten, in der TU Dortmund erzählt, wie es ihm gelang nachzuweisen, dass sich im Zentrum unserer Milchstraße ein Schwarzes Loch befindet. Der Vortrag fand im Rahmen der Reihe „Initialzündung“ statt, die daran erinnert, dass einst Alfred Nobel auf der benachbarten Zeche Dorstfeld experimentierte.
Ob in Science-Fiction-Filmen, der Popkultur oder der Wissenschaft: Schwarze Löcher haben eine ganz besondere Anziehungskraft. Reinhard Genzel ist einer der weltweit führenden Forscher*innen der Astrophysik, der sich auf Schwarze Löcher und die Entstehung von Galaxien spezialisiert hat. Unter dem Titel „Galaxien & Schwarze Löcher – Eine vierzigjährige Reise“ nahm er das Publikum mit auf eine Expedition durch sein Lebenswerk als Astrophysiker – von der Entdeckung einer dichten Masse im Zentrum unserer Milchstraße bis zum Nobelpreis für seine Forschung an jenem Objekt namens Sagittarius A*, das er zweifelsfrei als Schwarzes Loch identifizieren konnte.
Die Reise, über die Genzel im Rahmen der „Initialzündung“ berichtete, startete 1985 an der University of California in Berkeley. Prof. Genzel entdeckte gemeinsam mit anderen Forschenden ein massereiches Objekt im Zentrum unserer Galaxie. Ein Schwarzes Loch, vermuteten die Wissenschaftler*innen, und veröffentlichten ihre These in der Fachzeitschrift Nature. Doch statt Anerkennung traf die Gruppe vielseitig auf Zweifel: „Keiner hat uns geglaubt“, berichtete Genzel. Es fehlten eindeutige Beweise und es mangelte nicht an alternativen Erklärungen.
Reinhard Genzel ließ sich jedoch nicht davon abhalten, weiter an dieser Entdeckung zu forschen. „Man muss sich anstrengen, denn von nichts kommt nichts,“ kommentierte er im Audimax. „Die Forschung verlangt Experimentiererei, Geduld und die Möglichkeit, sie überhaupt durchführen zu können. Die Max-Planck-Gesellschaft gab uns die Ressourcen zu forschen und dabei auch ein Risiko einzugehen.“ Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen wurden belohnt: Neue Teleskope, mit denen unsere Milchstraße beobachtet werden kann, erlaubten mit der Zeit immer präzisere Messungen von den Sternbewegungen um das Zentrum. Das Very Large Telescope beispielsweise, das weltweit größte Observatorium der Europäischen Südsternwarte in Chile, verhalf den Wissenschaftler*innen um die Jahrtausendwende zu zunehmend schärferen Aufnahmen aus dem All, anhand derer sie die dichte Masse im Zentrum unserer Galaxie besser analysieren und auf über 4 Millionen Sonnenmassen bestimmen konnten.
Durch Aufnahmen von solchen Teleskopen verfestigten sich die Hinweise, dass sich im Zentrum unserer Galaxie tatsächlich ein Schwarzes Loch befindet. Gleichzeitig konnten Genzel und sein Team mehr und mehr alternative Erklärungen für die verdichtete Masse anhand der neuen Daten ausschließen. 2020, nach rund vier Jahrzehnten intensiver Forschung, erhielt Prof. Genzel schließlich den Nobelpreis für Physik gemeinsam mit Roger Penrose und Andrea Ghez.
Den Bericht über seinen Weg zum Nobelpreis untermalte der Astrophysiker im Audimax mit Gedankenexperimenten, humorvollen Anekdoten und Videos mit musikalischer Begleitung – vom Sternenballett bis zu „Highway to Hell“ von ACDC. Nach dem Vortrag stellte sich Genzel einigen fachlichen, aber auch vielen philosophischen Fragen aus dem Publikum und stand den interessierten Gästen sowohl für Foto- als auch Autogrammwünsche noch lange zur Verfügung.
Zur Initialzündung
Der schwedische Chemiker Alfred Nobel, Erfinder des Dynamits und Stifter des Nobelpreises, experimentierte in den 1860er-Jahren unter anderem in Dortmund-Dorstfeld auf der dortigen Zeche Dorstfeld mit Sprengstoff im Bergbau. Um Nitroglyzerin mit größerer Sicherheit sprengen zu können, entwickelte er 1863 die sogenannte Initialzündung. In Anlehnung an diese Experimentierphase Nobels in Dortmund trägt die Vortragsreihe den Titel „Initialzündung“. Zu Gast waren bisher Prof. Frances Arnold (Nobelpreis für Chemie 2018), Prof. Erwin Neher (Nobelpreis für Medizin 1991), Prof. Benjamin List (Nobelpreis für Chemie 2021) und Prof. Reinhard Genzel (Nobelpreis Physik 2020).
Bildzeile: Der Physik-Nobelpreisträger Prof. Reinhard Genzel ist zu Gast an der TU Dortmund.
Foto: Roland Baege für TU Dortmund

Walt Whitman-Experte zu Gast in Dortmund
Im Dezember 2023 hat Professor Ed Folsom, einer der führenden US-amerikanischen Literaturwissenschaftler, die Ehrendoktorwürde der TU Dortmund erhalten. Prof. Folsom forscht an der University of Iowa und hat sich in seiner Forschung auf den Lyriker Walt Whitman (1819-1892) spezialisiert. Auf Initiative der Fakultät Kulturwissenschaften erhielt er die Ehrendoktorwürde für sein herausragendes wissenschaftliches Engagement für die Partnerschaft zwischen der University of Iowa und der TU Dortmund, die er auf amerikanischer Seite seit fast 30 Jahren leitet.
TU-Rektor Prof. Manfred Bayer hieß die Gäste seitens der Universität willkommen, während Manfred Sauer, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Dortmund, die Besucher*innen im Namen der Stadt begrüßte. Beide bedankten sich bei Prof. Ed Folsom und Laudator Prof. Christopher Merrill aus Iowa und freuten sich sehr, den Walt-Whitman-Experten in die „TU Family“ aufnehmen zu dürfen. Ed Folsom lehrte 1996 als Fulbright-Professor an der TU Dortmund. Sein Aufenthalt legte den Grundstein für eine seit damals sehr aktive Universitätspartnerschaft der TU Dortmund mit der University of Iowa in Iowa City in vielen Bereichen. Folsom gründete mit internationalen Wissenschaftler*innen die „Whitman Week“, die fortgeschrittene Studierende und Whitman-Spezialist*innen zusammenbringt. Sie fand 2008 zum ersten Mal in Dortmund statt und wird seitdem jährlich an Universitäten auf der ganzen Welt organisiert.
„Ich freue mich, Prof. Folsom nun einen von uns nennen zu dürfen“, sagte Prof. Walter Grünzweig von der Fakultät Kulturwissenschaften, der seit fast 40 Jahren persönlich mit dem neuen Ehrendoktor kooperiert. „Wir schätzen Ed Folsom für seine außerordentliche Forschung und Lehre sowie seinen Umgang mit Studierenden und anderen Wissenschaftler*innen. Wir blicken auf eine jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen der TU Dortmund und der University of Iowa zurück, für die wir uns herzlich bedanken möchten.“ Prof. Folsom unterstützte auch die Neuübersetzung von Whitmans Werk Leaves of Grass, die Amerikanistik-Studierende der TU Dortmund Ende letzten Jahres gemeinsam mit dem Schauspieler Armin Mueller-Stahl der Öffentlichkeit präsentierten.
Prof. Christopher Merrill, Direktor des International Writing Program an der University of Iowa, würdigte in seiner Laudatio auf seinen langjährigen Freund und Kollegen Ed Folsom dessen revolutionäre Studien von Whitmans Werk. Insbesondere erwähnte er Folsoms Mitbegründung des digitalen Whitman Archivs und seine zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen über den Lyriker.
Der Literaturwissenschaftler bedankte sich in seiner Rede bei seinen Dortmunder Kolleg*innen. Die Stadt Dortmund habe für ihn, seit er 1996 als Fulbright-Professor hierherkam, eine besondere Anziehungskraft. Hier stoße Whitmans frühes Engagement für demokratische Werte und die Auseinandersetzung mit dem Thema Diversität auf großes Interesse. In diesem thematischen Zusammenhang sei Whitman seit Jahren in Dortmund präsent: Im Rahmen des Projekts „Gedankenzüge“ fahren Whitman-Zitate unter dem Titel „Experiment Demokratie“ seit 2022 in 68 Dortmunder U-Bahnen.
Bildzeile: Der neue Ehrendoktor Prof. Ed Folsom bei seiner Dankesrede.
Foto: Felix Schmale für die TU Dortmund

Am Samstag, dem 27. Januar feierte die erfolgreiche populärwissenschaftliche Veranstaltungsreihe „Zwischen Brötchen und Borussia“ der Fakultät Physik ihr Jubiläum im Dortmunder U. In der Festveranstaltung präsentierte TU-Alumnus Marcus Weber von den „Physikanten & Co.“ der Wissenschaftsministerin und rund 170 Besucher*innen unterhaltsame Experimente aus der Physik. Im Anschluss waren die Gäste in die neue Ausstellung „2ˣ – Physik und Kunst zwischen Zeit und Raum“ eingeladen, die noch bis März die Auseinandersetzung junger Künstler*innen der TU Dortmund mit physikalischen Phänomenen zeigt.
Frisch als Physikprofessor nach Dortmund berufen, etablierte der heutige TU-Rektor Manfred Bayer vor zwanzig Jahren gemeinsam mit seinem damaligen Kollegen Prof. Metin Tolan die öffentliche Veranstaltungsreihe „Zwischen Brötchen und Borussia“. Seither halten viermal pro Semester Forschende am Samstagvormittag allgemein verständliche Vorträge über Themen, die in einem Zusammenhang mit der Physik stehen – zu einer Uhrzeit, zu der regelmäßig rund 400 Gäste auf den Campus der TU Dortmund kommen: zwischen Frühstück und Heimspiel.
Prof. Bayer eröffnete die Jubiläumsfeier und begrüßte als Ehrengast Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Insgesamt, so rechnete der Rektor vor, haben in den letzten zwei Jahrzehnten 70.000 Gäste die Vorträge der Physiker*innen besucht. Damit sei „Zwischen Brötchen und Borussia“ die bundesweit erfolgreichste Veranstaltungsreihe ihrer Art. Sie hat über die Jahre Themen wie die Physik des Fußballspiels behandelt, Effekte in Science-Fiction-Filmen beleuchtet, den Stand der Forschung zu Mobilfunkstrahlung erklärt oder auch Modelle zur Ausbreitung des Coronavirus vorgestellt. Als persönliches Highlight erinnerte Prof. Bayer an einen Vortrag über das Projekt „Ice Cube“, in dem die Universität am Südpol an Neutrinos forscht. Hier gab es einst eine Live-Schaltung zur antarktischen Forschungsstation, wo 2005 sogar vorübergehend eine BVB-Fahne in die Reihe der offiziellen Flaggen am Pol eingereiht wurde.
Ministerin Ina Brandes begrüßte ebenfalls die Gäste und bedankte sich bei allen, die insbesondere junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern, wie es durch die Vorträge bei „Zwischen Brötchen und Borussia“ gelingt. Hier können teilnehmende Schüler*innen seit Jahren auch ein Quiz ausfüllen, durch das sie ein Schülerdiplom und die Möglichkeit zu Laborbesuchen erhalten können.
Die Physikanten: Show mit Knalleffekten
Nach den Begrüßungsworten eröffnete Marcus Weber, der die „Physikanten & Co.“ im Jahr 2000 nach seinem Studium an der damaligen Universität Dortmund gegründet hatte, seine Wissenschaftsshow im Kino des Dortmunder U. Dabei stellte er Versuche zur Schau, die er bereits in der Fernsehsendung „Wer weiß denn sowas?“ (ARD) präsentiert hat, bei der er regelmäßig zu Gast ist. Weber forderte das Publikum zum Mitexperimentieren auf und erklärte spielerisch, wie die physikalischen Abläufe funktionieren. Er begeisterte das bunt gemischte Publikum unter anderen mit einem implodierenden Fass sowie Wirbelringen aus Rauch und Seifenblasen.
Physik trifft Kunst auf der Hochschuletage im Dortmunder U
Im Anschluss an die Wissenschaftsshow hatten die Gäste noch die Gelegenheit, auf der Hochschuletage die Ausstellung „2ˣ – Physik und Kunst zwischen Zeit und Raum“ zu besuchen. Die gezeigten Fotografien und Multimedia-Installationen basieren auf einer Kooperation des Seminars für Kunst und Kunstwissenschaft und der Experimentellen Physik 2 der TU Dortmund. Die jungen Künstler*innen haben sich mit physikalischen Phänomenen befasst und diese zum Ausgangspunkt ihrer Werke gemacht. Eine dieser Arbeiten von Malin Emming schaffte es sogar in den Jahreskalender 2024 der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Ihre digitalen Collagen zeigen aneinandergereihte komprimierte Fotos einer Reise nach Frankreich, wodurch ein gleichsam gestauchtes Gesamtbild entsteht, das der Verbundenheit von Raum und Zeit Anschauung verleiht. Die Ausstellung, die Werke von insgesamt elf Künstler*innen zeigt, ist noch bis zum 3. März geöffnet.
Bildzeile: Marcus Weber von den Physikanten begeisterte das Publikum in der Wissenschaftsshow mit seinen Experimenten.
Foto: Martina Hengesbach für die TU Dortmund

Gestiftet von Dr. Michael Brenscheidt
Die Technische Universität Dortmund hat am Mittwoch, den 17. Januar erstmals den Dr. Michael Brenscheidt-Transferpreis an drei herausragende Projekte verliehen: Der erste Preis ging an Prof. Anna-Lena Scherger und Jannika Böse für Sprachförderung mehrsprachiger Vorschulkinder. Dr. Alvaro Ortiz Pérez vom Lehrstuhl für Sensorik erhielt den zweiten Preis für eine Auftragsarbeit aus dem Mittelstand. Der dritte Preis ging an den Fotografenmeister Uwe Grützner, der mit Drohnenaufnahmen neue Kooperationspartner gewinnen konnte. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro stiftete der Dortmunder Wirtschaftsjurist Dr. Michael Brenscheidt.
„Neben Forschung und Lehre bildet Transfer die dritte Säule unserer Universität“, sagte Rektor Prof. Manfred Bayer. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, Wissen und Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen und damit einen Mehrwert zu schaffen. Ich bin Dr. Michael Brenscheidt daher sehr dankbar für die großzügige Stiftung dieses Preises.“ Im Rahmen der Veranstaltung „Zukunftsdialog“ gratulierte er den Gewinner*innen, die der Transferbeirat des Centrums für Entrepreneurship & Transfer (CET) der TU Dortmund ausgewählt hatte.
Der erste, mit 6.000 Euro dotierte Preis ging an Prof. Anna-Lena Scherger und Jannika Böse von der Fakultät Rehabilitationswissenschaften, die sich der Sprachförderung von Vorschulkindern zugewanderter Familien widmen. In ihrem Projekt „Basisfähigkeiten stärken – Qualifizierung, Diagnostik und Intervention“ haben sie ein Fortbildungskonzept entwickelt, um Betreuungspersonen in sogenannten Brückengruppen für alltagsintegrierte Sprachförderung zu qualifizieren. In Brückengruppen werden Kinder, die bisher keinen Kita-Platz haben, auf die Grundschule vorbereitet. Die Ergebnisse wurden in der Praxis so positiv aufgenommen, dass nach Projektende bereits mehrfach Qualifizierungsmaßnahmen angefragt wurden, u.a. auch für Kindertagespflege und Spielgruppen.
Auf den zweiten, mit 3.000 Euro dotierten Platz schaffte es Dr. Alvaro Ortiz Pérez von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik mit einer Machbarkeitsstudie für ein mittelständisches Unternehmen zur Detektion von Kohlenstoffdioxid und eines bestimmten Isoliergases. Ziel war es, eine Sensortechnologie zu identifizieren, die den messtechnischen und ökonomischen Anforderungen des Auftraggebers entspricht. Nach erfolgreichem Projektabschluss wurde die Kooperation fortgesetzt, um gemeinsam einen Prototyp zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Das Transferprojekt veranschaulicht, wie außeruniversitäre Partner technologische Eigenständigkeit und Know-how mithilfe der TU Dortmund aufbauen können.
Den dritten, mit 1.000 Euro dotierten Transferpreis erhielt der Fotografenmeister Uwe Grützner von der Fakultät Raumplanung für den Einsatz von Drohnenaufnahmen innerhalb der TU Dortmund und bei externen Partnern. Durch die Verwendung der Drohnen für Wärmebilder oder Laservermessung haben sich einige erfolgreiche Kooperationen zwischen unterschiedlichen Disziplinen der TU Dortmund ergeben. Gleichzeitig hat Uwe Grützner die neue Technologie auch außeruniversitären Partnern zur Verfügung gestellt und damit neue Netzwerke geknüpft.
Dr. Michael Brenscheidt-Transferpreis
Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt besondere Leistungen beim Forschungstransfer und bei wissenschaftlichen Kooperationen mit Praxispartnern. Die TU Dortmund versteht Transfer als einen interdisziplinären und beidseitigen Austausch von Wissen, Dienstleistungen, Technologien und Personen mit externen Partnern in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Der Stifter Dr. Michael Brenscheidt war Mitglied der Geschäftsführung bei verschiedenen Unternehmen, Rechtsanwalt und Partner bei audalis Kohler Punge & Partner in Dortmund. Mit dem Preis möchte der Wirtschaftsjurist wichtige Impulse, die von TU-Wissenschaftler*innen und dem CET für die Realisierung neuer Geschäftsideen und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgehen, unterstützen.
Zukunftsdialog
Die Transferpreise wurden im Rahmen des dritten, vom CET veranstalteten Zukunftsdialogs vergeben. Der Zukunftsdialog bietet Unternehmen aus der Region die Möglichkeit, aktuelle Zukunftsfragen aus ihrer Perspektive im Kontext der Universität zu beleuchten und in einen inhaltlichen Austausch mit Studierenden, Wissenschaftler*innen und Beschäftigten der TU Dortmund zu treten. Am 17. Januar war Simone Schulz, Vorsitzende der Geschäftsführung von Boehringer Ingelheim microParts mit Sitz in Dortmund, zu Gast und berichtete aus Sicht der pharmazeutischen Industrie von dem Megatrend Neo-Ökologie.
Bildzeile: Dr. Michael Brenscheidt (2.v.l.), Stifter des Transferpreises, und Prof. Gerhard Schembecker (r.), Prorektor Finanzen, überreichten die Auszeichnungen an (v.r.) Uwe Grützner, Prof. Anna-Lena Scherger, Jannika Böse und Alaa Guenak (in Vertretung für Dr. Alvaro Ortiz Pérez). Sina Sadegh Nadi (l.) vom CET hat die Veranstaltung moderiert.
Foto: Oliver Schaper für die TU Dortmund

Wie die Komponenten eines Doppel-Brennstoffzellenantriebs eines LKW so aufeinander abgestimmt werden müssen, damit sie möglichst sparsam und trotzdem leistungsfähig arbeiten, hat der Recklinghäuser Felix Smyrek in seiner Bachelorarbeit an der FH Dortmund untersucht. Sein Ergebnis unterstreicht die Sinnhaftigkeit von Brennstoffzellenantrieben in LKW.
Mehrere LKW-Hersteller verwenden Antriebe aus zwei Brennstoffzellensystemen (BZS) und einer Batterie. Das bietet Vorteile, wie zum Beispiel eine höhere Lebensdauer, wenn die BZS bei geringem Leistungsbedarf, etwa im Stadtverkehr, abwechselnd eingesetzt werden.
Bei höherem Leistungsbedarf liegt der Gedanke nahe, die Leistung gleichmäßig auf beide BZS zu verteilen, damit beide möglichst wenig beansprucht werden. Ob das auch wirklich stimmt, untersuchte Felix Smyrek in zwei Schritten an dem computersimulierten Modell eines LKW eines asiatischen Herstellers in Kooperation mit dem Zentrum für Brennstoffzellentechnik (ZBT) in Duisburg.
Der statische Betrieb
Der Recklinghäuser betrachtete im ersten Schritt ein Szenario mit gleichbleibendem Leistungsbedarf, zum Beispiel bei einer Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit auf einer flachen Straße. Macht es dabei einen Unterschied, wenn die BZS unterschiedlich hohe Leistungen abgeben? „Die Effizienzkurve eines Brennstoffzellensystems ist recht einfach darzustellen“, sagt Felix Smyrek. Sie steigt erst steil an, erreicht ihr Maximum („Peak“) und fällt dann deutlich flacher wieder ab.
Smyreks Versuchsreihe ergab: Auch wenn ein einzelnes BZS die geforderte Leistung ohne Weiteres liefern kann, ist die Effizienz am höchsten, wenn jedes BZS möglichst nah am Peak betrieben wird. Daraus folgt die Erkenntnis: Bei Leistungsanforderungen unterhalb des Peaks ist es effizienter, nur eine Zelle zu betreiben. Liegt die Anforderung darüber, wie im Beispielfall, sollten beide BZS zu gleichen Teilen ran.
Der dynamische Betrieb
Beim dynamischen Betrieb, der eine reale Autofahrt mit Anfahren, Beschleunigen, Bremsen und so weiter abbildet, kommt zusätzlich die Batterie ins Spiel. Sie dient dazu, in bestimmten Situationen zu puffern, also bei Leistungsspitzen mitzuhelfen. Felix Smyrek untersuchte nun, wann genau ihr Einsatz am effizientesten ist.
Der Maschinenbaustudent fand heraus: Immer dann, wenn es schnelle Leistungswechsel gibt, ist es ratsam, so viel wie möglich mit der Batterie zu puffern. Aus zwei Gründen. Erstens, steigen die Verluste eines BZS bei Lastwechseln, wie es sie bei schnellen Leistungsspitzen gibt, und damit verliert man Energie. Zweitens, etwas komplizierter: Beim Bremsen wird die Bremsenergie rekuperiert, das heißt, in die Batterie zurückgespeist. Das geht aber nur, wenn die Batterie in diesem Moment nicht schon voll ist. Deswegen ist es sinnvoll, die Batterie während der Fahrt immer wieder zu beanspruchen, um ihre vollständige Aufladung zu vermeiden.
Wertvolle Daten
Weil sich die Brennstoffzellen-Antriebssysteme der LKW-Hersteller in vielen Punkten unterscheiden und die Hersteller auch keine Einzelheiten zu Dingen wie Wirkungsgrad und genaue Abstimmung von BZS und Batterie herausgeben, lässt sich Felix Smyreks Ergebnis nicht ohne Weiteres auf andere LKW übertragen. Dennoch birgt sie Grundlagenwissen darüber, wie das Zusammenspiel zwischen zwei Brennstoffzellen und einer Batterie möglichst effizient gesteuert werden kann, und damit ist sie ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zum optimalen Nutzen des Antriebssystems.
Von der angefallenen Menge an Daten profitiert auch das ZBT. Die Kooperation mit dem Duisburger Institut habe seine Arbeit erst ermöglicht, sagt Felix Smyrek. „Daher freut es mich umso mehr, dass ich dem Team am ZBT einen kleinen Benefit geben konnte und sie die Erkenntnisse für weitere Projekte nutzen können.“
Warum überhaupt Brennstoffzellen? Sind rein batteriebetriebene Fahrzeuge nicht sowieso effizienter?
Batterie-elektrische Fahrzeuge besitzen insgesamt einen höheren Wirkungsgrad als Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Das bedeutet, von der ihnen zugeführten Energie – ihrer Ladung – wandeln sie einen höheren Anteil in Antriebsenergie um, nämlich bis zu 80 Prozent, in Ausnahmefällen auch mehr. Zum Vergleich: Ein Brennstoffzellenantrieb liegt bei bis zu 60 Prozent, Verbrennungsmotoren bei maximal 45 Prozent.
Der Nachteil einer Batterie liegt in ihrem Gewicht. Je höher die Reichweite eines Fahrzeugs sein soll, desto größer und schwerer muss die Batterie sein, um ausreichend Energie bereitzuhalten. Für LKW, die viele hundert Kilometer am Stück zurücklegen, würde die Batterie so groß und schwer sein, dass ihr Betrieb unrentabel würde. Darüber hinaus wären dafür Ladestationen mit Ladeleistungen von einem Megawatt notwendig – sieben Mal so viel wie das, was ein elektrischer PKW benötigt.
Da kommt der Brennstoffzellenantrieb ins Spiel. Denn dessen Kraftstoff – Wasserstoff – lässt sich nicht nur platzsparender und leichter transportieren, sondern auch viel schneller betanken. Das bedeutet, bei hohen Reichweiten ist der Brennstoffzellenantrieb trotz geringerem Wirkungsgrad unterm Strich effizienter.
Bildzeile: Maschinenbaustudent Felix Smyrek hat einen Brennstoffzellenantrieb für LKW untersucht.
Foto: Tilman Abegg für die FH Dortmund

In einem gemeinsamen Projekt haben das Seminar für Kunst und Kunstwissenschaft und die Experimentelle Physik 2 der TU Dortmund interdisziplinär zusammengearbeitet: Dabei haben sich Kunststudierende ausgehend von physikalischen Phänomenen mit Dimensionen von Zeit und Raum befasst. Die Werke reichen von Fotografien bis zu Multimedia-Installationen und sind bis zum 3. März auf der Hochschuletage im Dortmunder U in der Ausstellung „2ˣ – Physik und Kunst zwischen Zeit und Raum“ zu besichtigen.
Der gemeinsame Nenner von Physik und Kunst ist, dass Modelle, Methoden, Geräte und Kameras von großen Maßstäben bis in den Nanobereich schauen, um räumliche und zeitliche Skalensprünge bildlich erfahrbar zu machen. Die multimedialen Kunstwerke bewegen sich unterschiedlich schnell von kleinen in große Welten und zurück. Im Dortmunder U werden sie auf dem Campus Stadt der TU Dortmund nun erstmals in einer Ausstellung der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Eine der Arbeiten von Malin Emming schaffte es sogar in den Jahreskalender 2024 der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Ihre digitalen Collagen zeigen aneinandergereihte komprimierte Fotos einer Reise nach Frankreich, wodurch ein gleichsam gestauchtes Gesamtbild entsteht, das der Verbundenheit von Raum und Zeit Anschauung verleiht. Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation in Form eines Endlosleporellos. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.
Die Kooperation zwischen kunstwissenschaftlichem Seminar und der Experimentellen Physik 2 ist aus dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereich TRR160 („Kohärente Manipulation wechselwirkender Spinanregungen in maßgeschneiderten Halbleitern“) hervorgegangen.
Campus Stadt
Auf dem Campus Stadt gibt die TU Dortmund als Partner im Dortmunder U regelmäßig Einblicke in Forschung und Lehre. Ausstellungspräsentationen und der Raum als Forum des Dialogs bieten der Stadtgesellschaft durch verschiedene Veranstaltungsformate die Möglichkeit, Fragestellungen und Erkenntnisse der Wissenschaftsdisziplinen kennenzulernen und gemeinsam zu diskutieren.
Begleitprogramm zur Ausstellung
4. Februar und 3. März, 12 Uhr: Familiensonntage mit Rundgang
Freitag, 9. Februar und 23. Februar, 12-13 Uhr: Lunchtalks in der Ausstellung
Freitag, 16. Februar, 15-16 Uhr: Studienberatung zum Lehramtsstudium Kunst in der Ausstellung
Freitag, 1. März, 15-16 Uhr: Studienberatung zum Studium der Physik in der Ausstellung
Bildzeile: In der Ausstellung „2ˣ – Physik und Kunst zwischen Zeit und Raum“ können Besucher*innen bis zum 3. März die Werke von elf Kunststudierenden besichtigen.
Foto: Martina Hengesbach für die TU Dortmund

Im Dezember 2023 hieß Rektor Prof. Manfred Bayer rund 700 Gäste zur Akademischen Jahresfeier im Audimax der TU Dortmund willkommen. Im Rahmen der festlichen Veranstaltung wurden wieder zahlreiche Auszeichnungen vergeben, darunter Preise für herausragende Abschlussarbeiten und Promotionen sowie Anerkennungen für besonderes Engagement in Lehre und Forschung.
Nach der Begrüßung der Gäste bat Rektor Prof. Manfred Bayer zunächst um ein stilles Gedenken an den kürzlich verstorbenen Altrektor Prof. Paul Velsinger, der in seiner Amtszeit von 1978 bis 1990 vor allem die Integration der Pädagogischen Hochschule Ruhr geleitet sowie den Aufbau des benachbarten Technologiezentrums mitinitiiert hatte. In seiner Ansprache nahm Bayer zudem Bezug auf das Kriegsgeschehen in der Welt, insbesondere den Konflikt im Nahen Osten, der aktuell auf Hochschulen weltweit ausstrahle. Er machte deutlich: „Die TU Dortmund ist ein Ort des respektvollen Miteinanders. Anfeindungen haben hier keinen Platz. Wir dulden insbesondere keine Form von Antisemitismus“, sagte er unter dem Applaus der zahlreichen Gäste. Die Universität habe den Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober scharf verurteilt und zugleich deutlich gemacht, dass sie das Leid aller Opfer der daraus folgenden Gewalteskalation anerkenne. „Wir sind dankbar dafür, dass auf unserem Campus Menschen aus über 130 Nationen friedlich miteinander lernen und forschen. Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung treten wir entschieden entgegen.“
Auszeichnungen und Festvortrag
„Trotz allem wollen wir den Blick aber auch auf das Positive richten und heute jene Leistungen würdigen, die in Lehre und Forschung dieses Jahr an der TU Dortmund erbracht wurden“, leitete er zu den Preisverleihungen über. Dabei vergaben zunächst verschiedene Laudator*innen die Lehrpreise der TU Dortmund in vier Kategorien. Sarah Toepfer, AStA-Vorsitzende, zeichnete Prof. Jan Nagel von der Fakultät für Mathematik aus. Dr. Katrin Stolz, Leiterin des Bereichs Hochschuldidaktik im Zentrum für HochschulBildung, verlieh den Lehrpreis an Dr. Julia Sattler von der Fakultät Kulturwissenschaften. Der Lehrpreisträger aus dem Vorjahr Prof. Mario Botsch beglückwünschte Alina Bähr von der Fakultät Kulturwissenschaften zur Auszeichnung. Prof. Wiebke Möhring, Prorektorin Studium, verlieh den Lehrpreis an Markus Alex, Volker Mattick und Andrea Martin vom ITMC, Bereich Medien Service, sowie Dr. Katrin Stolz und Dr. Stephanie Steden vom Zentrum für HochschulBildung.
Guido Baranowski, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund, überreichte die Jahrgangsbestenpreise für hervorragende Abschlussarbeiten an den 17 Fakultäten.
Die Verleihung der Dissertationspreise übernahm Prof. Nele McElvany, Prorektorin Forschung. Sie ehrte auch Dr. Giulio Mattioli von der Fakultät Raumplanung mit dem Forschungspreis der TU Dortmund Young Academy, der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wurde.
Die Festrede hielt Prof. Christian von Coelln, Leiter des Instituts für Deutsches und Europäisches Wissenschaftsrecht an der Universität zu Köln. Unter dem Titel „Freiheit in der Universität“ sprach er darüber, wie wichtig es ist, dass Wissenschafts- und Meinungsfreiheit als Grundrechte an Hochschulen gelebt werden. Zudem betonte er, dass auch zweckfreie Forschung und unpopuläre Meinungen zum Wohl der demokratischen Gesellschaft beitragen, da sie den Diskurs fördern können.
Die „United Harriet Colliery Band“ untermalte die Akademische Jahresfeier musikalisch unter Leitung von Prof. Christopher Houlding. Der Abend klang mit einem feierlichen Empfang in der Mensa aus. Wie bereits in den Vorjahren wurde die Akademische Jahresfeier von der Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund unterstützt.
Bildzeile: TU-Rektor Prof. Manfred Bayer begrüßt rund 700 Gäste zur Akademischen Jahresfeier im Audimax der TU Dortmund.
Foto: Roland Baege für die TU Dortmund

Eine neue, bessere Methode zur Blutdruckmessung hat Fabienne Sahl entwickelt und damit den ersten Master-Abschluss des jungen Studiengangs Biomedizinische Informationstechnik erreicht.
Zunächst eine Korrektur: „Blutdruckmessung“ ist genau genommen der falsche Begriff, denn für eine Messung müsste der Blutdruck direkt innerhalb der Arterie ermittelt werden. Das passiert aber nur während Operationen und auf Intensivstationen. Alle anderen Methoden, die den Blutdruck von außen abnehmen, heißen deshalb korrekt „Schätzung“.
Das gilt auch für die bekannteste Methode mit der aufblasbaren Manschette um den Oberarm. Die besitzt einen großen Nachteil: Der für die Schätzung nötige Luftdruck presst die Arterie zusammen, sodass zwischen einzelnen Schätzungen mehrere Minuten vergehen müssen, damit die Gefäße sich wieder auf die normale Größe ausdehnen können. Die Ermittlung einer Blutdruckkurve, also die lückenlose zeitliche Abbildung des pulsgetriebenen Blutkreislaufs, ist damit nicht möglich.
Weil diese Kurve aber viele wichtige Informationen über das Herzkreislaufsystem und den Gesundheitszustand der untersuchten Person bergen würde, wäre eine einfache und zuverlässige Methode zu ihrer Schätzung für Ärzt*innen sehr hilfreich.
Ihre Aufgabe: Die Formel finden
Hier setzt Fabienne Sahls Forschungsidee an. Als Signalempfänger dienen drei Sensoren am Oberarm. Diese messen den Druck, der sich beim Puls durch das Ausdehnen der Arterie durchs Gewebe nach außen ausbreitet. Sahls Aufgabe bestand unter anderem darin, eine Formel (mathematisch: eine „Übertragungsfunktion“) zu finden, mit deren Hilfe sich die empfangenen Signale in eine medizinisch brauchbare Blutdruckkurve umwandeln lassen.
Fabienne Sahl bediente sich dafür eines „tiefen neuronalen Netzwerks“ der künstlichen Intelligenz, kurz: einer KI. Vereinfacht gesagt, speiste sie die KI mit den Daten der Drucksensoren. Die KI passte dann die Übertragungsfunktion an, sodass diese wiederum auf Grundlage der Drucksignale den Blutdruck schätzen konnte. Gleichzeitig ermittelte Fabienne Sahl den Blutdruck mit der bereits anerkannten, zuverlässigen „Volume-Clamp-Methode“. Anschließend verglich sie die Blutdruckschätzung mit den Volume-Clamp-Werten und justierte die Funktionsweise der KI nach – sodass die Übertragungsfunktion Blutdruckschätzungen durchführen kann, die mit den Volume-Clamp-Werten übereinstimmten.
Viele Vorteile und ein Hindernis
Die Suche nach einer einfachen, zuverlässigen Methode zur Schätzung der Blutdruckkurve beschäftigt viele Forscher*innen weltweit. So wurden in den vergangenen Jahren einige hoffnungsvolle Methoden gefunden, darunter auch einige KI-gestützte, doch sie alle haben den einen oder anderen Nachteil: zum Beispiel einen zu großen Datenhunger oder intransparente Rechenwege.
Fabienne Sahls Methode besitzt den Charme, von diesen Nachteilen deutlich weniger stark betroffen zu sein. Zudem erlaubt die Übertragungsfunktion Rückschlüsse auf die individuelle Beschaffenheit des Oberarmgewebes, die aus medizinischer Sicht wertvoll sind.
Die Methode ist ein vielversprechender Ansatz – und das Ergebnis einer erfolgreichen Masterarbeit –, aber noch nicht ausgereift. Als Pferdefuß erwiesen sich die Sensoren, deren Daten sehr störanfällig sind. Doch das könnte sich bald ändern: In ihrer Promotion an der FH Dortmund möchte Fabienne Sahl die Lösungsansätze, die sich aus ihrer Masterarbeit ergeben, ausarbeiten.
Referenz: Die Volume-Clamp-Methode
In ihrer Arbeit diente Fabienne Sahl die Volume-Clamp-Methode als Referenz. Diese funktioniert über eine Blutdruckmanschette am Finger, die sich mit Luft füllt. Anders als bei der Oberarmmanschette passt sich der Luftdruck dem Pulsschlag an, sodass er den Schwankungen in der Arterie präzise entgegenwirkt und dadurch der Druck zwischen Manschette und Arterie durchgehend gleichbleibt. Doch auch diese Methode, die unter den nicht-invasiven Varianten als genaueste gilt, hat Nachteile: So ist mit ihr zum Beispiel kein dauerhaftes Monitoring möglich, weil auch durch sie die Arterien zusammengedrückt werden.
Bildzeile: Forscht an einer einfachen und zuverlässigen Methode zur Blutdruckbestimmung: Fabienne Sahl.
Foto: Tilman Abegg für die FH Dortmund

„75 Jahre Soziale Arbeit am Standort Dortmund“, das klingt nach einer gleichförmigen Fortentwicklung von 1948 bis heute. Bei der Feierstunde im Dietrich-Keuning-Haus wurde deutlich: Die Geschichte des Fachbereichs war vieles, aber sicher nicht geradlinig und ruhig.
Kein Wunder: Die Soziale Arbeit in Dortmund war von Beginn an ein Gegenentwurf. Eine idealistische Rebellion, zuerst gegen die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, den Klassenhass und jegliche Kriegstreiberei. Später gegen paternalistische Strukturen, die immer auch die Soziale Arbeit selbst betrafen. Nach 75 Jahren kritischer und konsequenter Selbst- und Gesellschaftsreflexion durften die Menschen des Fachbereichs am 18. September im Dietrich-Keuning-Haus in der Dortmunder Nordstadt wohlverdient der Feier und Wertschätzung ihres Fachbereichs in seinem heutigen Erscheinungsbild folgen.
„Die Angewandten Sozialwissenschaften der FH Dortmund“, sagte Rektorin Prof. Dr. Tamara Appel anlässlich des Jubiläums, „sind nicht nur ein wissenschaftlich wie gesellschaftlich relevanter Lehr- und Forschungsmotor. Durch ihre intrinsische Interdisziplinarität sind sie auch eine wichtige Kraft im Bestreben unserer Hochschule, gemeinsam die besten Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.
Ihre Perspektive orientiert sich konsequent am Menschen und an den Werten eines für alle würdevollen Lebens. Damit ist der Fachbereich ein unverzichtbarer Teil der moralischen und ethischen DNA der gesamten Hochschule.“
Dekanin Prof. Dr. Katja Nowacki betonte in ihrer Festrede, „dass die Soziale Arbeit neben der direkten Hilfe für Benachteiligte und besonders schützenswerte Gruppen auch eine politische Dimension hat und eine wichtige Menschenrechtsprofession ist. Wir als Fachbereich sind stolz, eine Ausbildungsstätte für Menschen zu sein, die in der Sozialen Arbeit tätig sind und sich für diese einsetzen.“
In diesem Sinne ehrte die Ausbildungsstätte auch die Absolvent*innen der Jahrgänge 2020 bis 2023, von denen viele bisher pandemiebedingt darauf verzichten mussten. Etwa 250 von insgesamt rund 1300 Absolvent*innen waren bei der Feier anwesend. Anschließend schritten die Gäste anschließend zum Sektempfang und durch eine eigens für diesen Anlass kuratierte Ausstellung: 19 wandhohe Charts erzählen zurückliegende Ereignisse, Anekdoten, zeigen Bilder und Zitate und vermitteln den Blick dieses kritischen Fachbereichs auf seine eigene Geschichte.
„Ich gratuliere dem Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften“, unterstrich Rektorin Tamara Appel abschließend, „und ich danke allen Menschen, die ihn in diesen 75 Jahren begleitet und geprägt haben. Für die kommenden Jahre weiß ich ihn in den besten Händen und wünsche allen Beteiligten viel Erfolg in ihrer Arbeit und, im Sinne des Fachbereichs, auch in allen anderen Bereichen ihres Lebens.“
Bildzeile: Etwa 130 Absolvent*innen aus den vergangenen vier Jahren konnten ihren Studienabschluss vor Ort feiern.
Foto: Vivian Rutsch für die FH Dortmund


