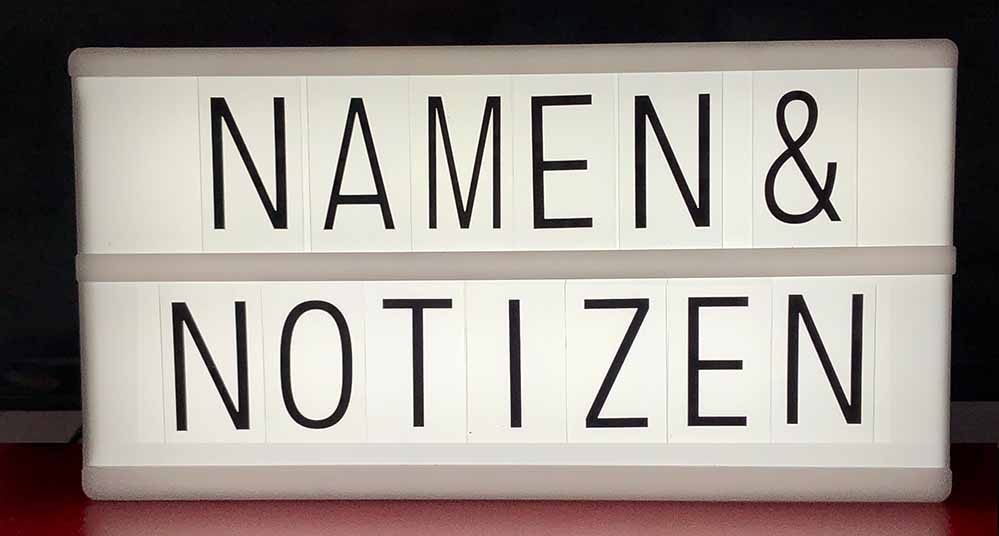Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“
Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Initiativkreis ist bereit einzuziehen und fordert Stadt zum Handeln auf
Seit dem Kommunalwahlkampf letzten Jahres tragen die Aktivist:innen des
Initiativkreises für ein Sozial-Ökologisches Zentrum ihre Forderungen
kontinuierlich in die Öffentlichkeit. Der Versuch, ein Zentrum in Dortmund zu etablieren, das den großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte
Rechnung trägt, wird nicht nur von einem breiten Spektrum an Parteien und ihren Vertreter:innen, sondern vor allem von einer Vielzahl von Vereinen
und Initiativen der Zivilgesellschaft unterstützt. „In den vielen Gesprächen der
vergangenen Monate ist deutlich geworden, dass es in Dortmund einen
Freiraum braucht. Der Bedarf ist da, der Wille ist da – Jetzt fehlt nur noch ein Gebäude“ sagt Mila Ellee, Pressesprecherin des Initiativkreises.
Seit einem Beschluss im Ausschuss für Finanzen im Dezember 2020 steht
die Initiative im Kontakt mit der Verwaltung und ist aktiv auf Raumsuche.
„Natürlich muss unser zukünftiges Gebäude gewissen Kriterien
entsprechen: Es muss all den Initiativen, die sich gegen soziale Ungleichheit und für
Klimagerechtigkeit engagieren, Platz bieten und sollte möglichst gut erreichbar sein- Ein Sozial-Ökologisches Zentrum, dass nur mit dem SUV erreichbar ist,
wäre unsinnig!“ stellt Tim Maaß, Pressesprecher des Initiativkreises, fest.
Am 1. Mai enthüllten die Aktivist:innen ein Leuchtschild, dass über dem zukünftigen Eingang ihres Gebäudes hängen wird und die Position der
Aktivist:innen unterstreicht: „Wir sind bereit einzuziehen und mit der Arbeit
loszulegen“ macht Mila Ellee deutlich. „Alles, was jetzt noch fehlt, ist, dass die Stadt in Bewegung kommt.“
Der Initiativkreis steht zwar im Austausch mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Dortmund, es wurden aber bisher noch keine konkreten Besichtigungstermine
angeboten. Zudem fand vor gut 4 Wochen ein Gespräch mit dem
Oberbürgermeister Herrn Westphal statt. Auch hier gab es Zuspruch, bisher
aber ohne Arbeitsergebnisse.
Das geforderte Konzept liegt vor, die Forderungen, wie im Ausschuss für
Finanzen gefordert wurden, konkretisiert. Nun ist die Stadt Dortmund am Zug,
mögliche Gebäude vorzuschlagen und Ortstermine zu organisieren.
Foto: Mona Dierkes

Baerbock-Boom erfasst Dortmunder GRÜNE
Die Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock hat bei den Dortmunder GRÜNEN einen Neumitglieder-Boom ausgelöst. Vergangene Woche konnte mit Sylva Dresbach nun das 600. Mitglied der Dortmunder GRÜNEN aufgenommen werden.
„Bei allem Schrecken in der Pandemie ist deutlich geworden, was in diesem Land in den letzten Jahrzehnten versäumt und ausgesessen worden ist. Ich finde es stark, dass Annalena Baerbock als junge Mutter jetzt in die Verantwortung geht und bin begeistert von ihrer Kandidatur. Für mich ist wichtig zu sehen, egal ob bei der Klimakrise, der Digitalisierung, bei allem was wir unseren Kindern an Umweltproblemen hinterlassen oder auch bei der sozialen Spaltung: Unsere Gesellschaft ist am Limit, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass die Dinge besser werden. Für mich ist klar: Den GRÜNEN Wahlkampf mit Annalena Baerbock möchte ich aktiv unterstützen und bin deshalb nun den GRÜNEN beigetreten.“ begründet Sylva Dresbach ihren Parteieintritt.
Alleine in den letzten zwei Wochen sind rund 50 Neumitglieder dem Kreisverband der Dortmunder GRÜNEN beigetreten.
„Dieser Zulauf ist weit größer, als wir zu hoffen gewagt haben. Stellvertretend für alle, die neu bei uns dabei sind, heißen wir unser 600. Mitglied Sylva herzlich willkommen. Die vielen neuen Mitstreiterinnen und Mitstreiter geben Rückenwind vor der wichtigsten Bundestagswahl aller Zeiten. Gemeinsam werben wir dieses Jahr für den klimagerechten Politikwechsel mit uns GRÜNEN“, freuen sich die Dortmunder Kreisverbandssprecher*innen Heide Kröger-Brenner und Michael Röls.
Am 21. Mai findet um 19 Uhr online ein Treffen für Neumitglieder sowie Interessierte statt.
Bildzeile: Kreisverbandssprecher Michael Röls begrüßt Sylva Dresbach als 600. Mitglied der Dortmunder Grünen.
Foto: Bündnis90 / Die Grünen

Neues Testzentrum bei der Dortmunder Tafel
Auch die Dortmunder Tafel ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. Viele Maßnahmen wurden in den vergangenen Monaten ergriffen, um den Mitarbeiter*innen und Kund*innen möglichst viel Sicherheit in der Krise zu bieten.
Darüber hinaus haben sich die Verantwortlichen früh Gedanken gemacht, wie die Dortmunder Tafel einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten kann.
Und so kam die Idee auf, in der Nordstadt ein zusätzliches Testzentrum für Corona-Schnelltests aufzubauen. Es zeigt sich ja aktuell, dass gerade in den Stadtteilen mit beengten Wohnverhältnissen und bei Bürgern mit Sprachproblemen die Infektionsraten hoch sind.
Nach kurzer Suche fand sich mit der Spitzweg Apotheke in Dortmund-Wickede ein kompetenter Partner für ein neues Testzentrum.
Räumlichkeiten vor der Tafel, die sonst für Kinderprojekte genutzt werden, aber wegen Corona gerade leer stehen, können für die Tests genutzt werden.
Die Kunden der Dortmunder Tafel können die Wartezeit auf ihren Einkauf nutzen, um sich schnell, ohne Termin und kostenlos testen zu lassen. Das Testergebnis gibt es dann ausgedruckt oder per Mail.
„Wir hoffen, dass viele Kunden dieses Angebot nutzen, um sich selbst abzusichern und damit auch für die Menschen in ihrer Umgebung das Risiko einer Ansteckung zu minimieren“, sagt Maja Silberg, die das Projekt für die Tafel organisiert hat.
Selbstverständlich steht das kostenlose Test-Angebot auch allen anderen Menschen offen. Montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr ist das Zentrum geöffnet.

Intensivpfleger rettet auch privat Leben
„Der genetische Zwilling“: Mitarbeiter des Klinikums
Dortmund leistet Stammzellen-Spende
Als er sich vor vier Jahren registrierte, hatte er kaum mit einer Antwort gerechnet:
Matthäus Atzert, ausgebildeter Fachgesundheits- und Krankenpfleger
für Intensivpflege und Anästhesie, hat vor kurzem zum ersten Mal
Stammzellen für einen Leukämie-Patienten gespendet. Gemeldet hatte er
sich bei der DKMS (Deutschen Knochenmarksspenderdatei) bereits im Jahr
2017. „Es dauert teilweise sehr lange, bis die DKMS einen passenden
Spender findet“, sagt der 35-Jährige, der auf der neurologischen Intensivstation
A12i im Klinikum Dortmund arbeitet. „Gerade in Pandemie-Zeiten
verschwinden solche Themen leider aus dem öffentlichen Fokus, obwohl
natürlich nach wie vor viele Menschen an Blutkrebs erkranken. Umso wichtiger
ist es, genau jetzt darauf aufmerksam zu machen“, so Atzert.
„Du rettest im Krankenhaus doch jeden Tag Leben“, habe ein Freund zu ihm gesagt,
als er diesem erzählte, dass er als passender Spender ausgewählt wurde.
Die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr hoch: Damit eine solche Spende erfolgreich
abläuft, müssen Patient*in und Spender*in möglichst identische Gewebemerkmale
aufweisen, quasi „genetische Zwillinge“ sein. Andernfalls können so
genannte „Abstoßungsreaktionen“ auftreten, bei denen die neu transplantierten
Stammzellen den Körper als fremd erkennen und bekämpfen. „Die Frage, ob ich
das wirklich machen werde, hat sich daher für mich gar nicht erst gestellt“, so
Atzert. „Für mich bedeutet das einen kleinen Aufwand, für den Erkrankten hingegen
ist es eine riesige Chance.“
Stammzellen sind im Körper für den Blutbildungsprozess zuständig. Gesunde,
transplantierte Zellen übernehmen diese Funktion bereits nach wenigen Wochen.
Fünf Tage vor dem Spendetermin hat Atzert zwei Mal täglich ein Medikament
erhalten, das die Anzahl seiner Stammzellen im Blut steigert. „Da können natürlich
Nebenwirkungen auftreten“, erklärt Atzert. „Bei mir waren es Müdigkeit und
Rückenschmerzen. Das war aber auf jeden Fall auszuhalten. Und ich würde es
jederzeit nochmal machen.“ Dreieinhalb Stunden habe die Spende gedauert –
und danach habe er erstmal genauso lange geschlafen. Die Kosten für Hotel,
Fahrt und Gehaltsausfälle hat die DKMS für ihn übernommen.
Zwei Jahre lang ist er nun als Spender für diese eine betroffene Person blockiert,
für die er bereits gespendet hat. „Es sein kann, dass die- oder derjenige erneut
eine Stammzellen-Spende benötigt“, erklärt Atzert. Wenn beide Seiten zustimmen,
wäre nach dieser Zeit sogar eine Kontaktaufnahme zwischen Spender*in
und Empfänger*in möglich. Eine anonyme Korrespondenz ist auf Wunsch bereits
vorher machbar.
Laut der DKMS erkrankt weltweit alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs. Nur
ein Drittel der Patient*innen hat innerhalb der Familie geeignete Spender*innen.
In Deutschland findet jede*r Zehnte keine*n passende*n Spender*in. Dabei ist die
Registrierung simpel: Jeder gesunde erwachsene Mensch bis 55 Jahren kann sich mit geringem Aufwand bei der DKMS oder einer anderen Datei zur potentiellen Spende melden.
Bildzeile: auch privat ein Lebensretter: Matthäus Atzert, Intensivpfleger im Klinikum Dortmund, hat seine erste Stammzellen-Spende für einen Leukämie-Patienten geleistet.
Foto: Klinikum Dortmund
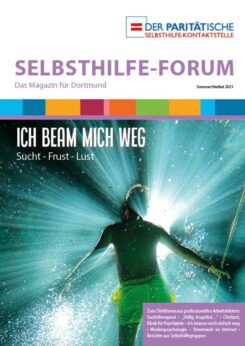
Selbsthilfe-Forum, Magazin für Dortmund neu erschienen
Titelthema: Ich beam mich weg. Sucht – Frust – Lust
Das neue SELBSTHILFE-FORUM, Ausgabe Sommer/Herbst ist unter dem Titelthema „Ich beam mich weg. Sucht – Frust – Lust“ ist aktuell erschienen.
Inhalt
Eintauchen in eine Scheinwelt, Abkapseln, der Wunsch nach einer besseren Wirklichkeit – ein bekanntes Bedürfnis. Wer kennt nicht das schöne Gefühl beispielsweise in den Schlaf abzutauchen, oder sich einfach Kopfhörer auf die Ohren zu packen …
So nachvollziehbar dieses Verhalten auch ist – was geschieht, wenn jemand zu oft abtaucht? Und mit anderen Mitteln wie z. B. Drogen, Internet-Surfen oder Glücksspiel nachhilft? Wann werden aus gesunden Alltagsfluchten problematische Lebenszustände? Wann verliert jemand seine eigenen Stärken und Fähigkeiten, um gesund Belastung auszugleichen oder sich dem Alltag zu stellen?
Es gibt Spannendes zu lesen: Eine Unterhaltung mit einem Suchttherapeuten über die Alltags-Droge Alkohol und das Bedürfnis nach Rausch. In einem Gespräch mit einer Medienpsychologin, geht es um Hilfe bei problematischem Internetkonsum. Und ein Psychiater schreibt über seine Erfahrungen, wenn psychische Störungen mit Suchtmitteln reguliert werden.
Dass es auch positive Beispiele gibt, sich „weg zu beamen“ oder dem Alltag zu stellen, ist in weiteren zahlreichen Beiträgen lesen. Wer denkt schon bei Krebserkrankungen ans Singen oder bei Parkinson ans Tischtennis-Spielen? Wer weiß schon als Außenstehender, dass der (Um-)Weg über die Sucht zu ganz neuem Bewusstsein führen kann?
Eine Belastung teilen derzeit alle: Die Pandemie hat das Leben auf den Kopf gestellt. Und Selbsthilfegruppen haben in dieser Zeit mit ihrer Stützpfeiler-Funktion für ganz viele Menschen noch mehr Bedeutung. Doch die Schutzmaßnahmen ließen und lassen Präsenz-Gruppentreffen nicht oder nur erschwert zu.
Dass Selbsthilfegruppen die Ausflüge ins Virtuelle dabei als Ausweg zu schätzen lernen, hätte vorher niemand gedacht. Digitale Werkzeuge, die dabei genutzt werden und wurden, können sicherlich auch interessant im persönlichen Alltag sein.
Druck- und Digital- und WordDokument-Ausgabe
Das SELBSTHILFE-FORUM ist als Druckausgabe in der Selbsthilfe-Kontaktstelle erhältlich und als Download auf der Website der Kontaktstelle zu finden.
Für das Lesen mit entsprechender Spracherkennungssoftware wird die Ausgabe von der Kontaktstelle auf Anfrage als Word-Dokument zur Verfügung gestellt.
Über das SELBSTHILFE-FORUM
Seit vielen Jahren ist das SELBSTHILFE-FORUM das Organ der Selbsthilfe. Selbsthilfegruppen schreiben über Ihre Arbeit, aktuelle Selbsthilfethemen werden aus der professionellen Hilfelandschaft aufgegriffen und neue Entwicklungen werden publiziert. Das SELBSTHILFE-FORUM erscheint zweimal im Jahr – jeweils im Mai und November.

Mehr als 20.000 Tulpen blühen im Botanischen Garten Rombergpark
Mehr als 20.000 Tulpenzwiebeln pflanzten Ehrenamtliche der fünf Dortmunder Rotary Clubs und des Rotaract-Club Dortmund vor sechs Monaten anlässlich des Welt-Polio-Tages in der kleinen Talwiese im Botanischen Garten. Die Zwiebeln spendeten die fünf Dortmunder Rotary-Clubs und die Freunde & Förderer des Botanischen Gartens Rombergpark.
Jetzt stehen die mehr als 20.000 Tulpen in voller Blüte und zeigen das Logo „END POLIO NOW“- eine weltweite rotarische Initiative zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Mit 40 Metern Breite und 17 Metern Höhe sind das imposante Logo und damit die Initiative unübersehbar.
END POLIO NOW ist eine weltweite Aktion von Rotary zur Ausrottung der Kinderlähmung. Mit jeder gepflanzten Tulpenzwiebel wurden drei Polio-Impfungen finanziert. Somit förderte die Pflanzaktion im Botanischen Garten die Impfung von 60.225 Kindern in Zentralasien.
Seit 1979 trägt Rotary zur Bekämpfung des Polio-Virus bei. Das Virus, das die Kinderlähmung auslöst, infiziert hauptsächlich Kinder unter fünf Jahren. Durch präventiven Impfschutz konnte seitdem die Zahl der weltweiten Polio-Fälle um 99,9 Prozent reduziert werden.
Auch durch die Corona-Pandemie ist die Bedeutung des von Rotary aufgebauten PolioPlus-Projektes deutlich geworden. Gerade jetzt wird das weltweite Polio-Impfnetzwerk maßgeblich am Erfolg mitwirken – vor allem im Kampf gegen die Kinderlähmung – aber auch gegen Covid-19.
Bildzeile: v.l. Thomas Franke (Assistant Governor des Rotary Distrikt 1900), Dr. Patrick Knopf (Direkter des Botanischen Gartens Rombergpark).
Foto: Botanischer Garten Dortmund
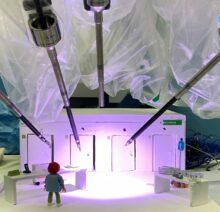
Über 10.000 Aufrufe in nicht mal 24 Stunden
Live-Event: Pflege-Praktikum aus dem Home-Office
auf der kleinsten Krankenhaus-Station der Welt
Am Ende gab es für die Zuschauer*innen sogar eine Praktikums-Urkunde:
Das Klinikum Dortmund hatte auf seinem Instagram-Account
(@klinikumdo) ins „Tiny Hospital“ eingeladen, um corona-konform ein
Pflege-Praktikum vom heimischen Sofa aus zu ermöglichen. Eingedampft
auf 24 Minuten erlebten die eine 8-Stunden-
Frühschicht auf 40 x 40 cm Grundfläche. So klein war nämlich die Station,
die als Mini-Modell neben vier Zimmern und zwei Stationspulten u.a. auch
Medikamente sowie Ruf-Leuchten über jeder Tür hatte. Die Geschicke auf
der Station wurden gelenkt vom OP-Roboter DaVinci, der die Kommandos
der Zuschauer, aber auch „zufällige“ Störungen im Schichtablauf lenkte.
Innerhalb von nicht mal 24 Stunden entwickelte sich das Live-Experiment, das
nach der Session auf dem IGTV-Kanal des Klinikums gespeichert wurde, rein organisch zum bislang erfolgreichsten IGTV-Video mit über 10.000 Aufrufen. „Wir
wurden u.a. sogar vom Instagram-Account einer Gesamtschule geteilt, was natürlich optimal ist. Schließlich ist so eine Aktion gedacht, um uns als Arbeitgeber bei der Zielgruppe Schüler*innen bekannt zu machen“, erklärt Marc Raschke,
Leiter der Unternehmenskommunikation des Klinikums Dortmund.
Während der Live-Übertragung aus dem OP-Saal 9, wo der Roboter und die Mini-
Station aufgebaut waren, steuerte Prof. Dr. Maximilian Schmeding, Direktor der Klinik für Chirurgie im Klinikum Dortmund den „DaVinci“. Konkret bedeutete das, dass er vier Arme steuern musste, wovon einer die Kamera war und die drei
anderen als Greifer auf der Station wirkten. Mit diesen Greifern wurde Essen verteilt, telefoniert, ein Patient für seine OP vorbereitet, Verband gereicht, Körperpflege
organisiert, dokumentiert usw. „Wir möchten mit diesem digitalen ’Kammerspiel‘ aufzeigen, wie vielfältig die Arbeitsabläufe auf einer Station sein können“,
erklärt Raschke. „Das ist natürlich nicht wie im realen Leben, soll aber ja
auch nur einen ersten Anreiz bieten.“
Fachkundig kommentiert wurde die Live Übertragung von Andrea Besendorfer,
die als Pflegewissenschaftlerin im Klinikum Dortmund arbeitet und zahlreiche
Hintergrundinfos zu dem Geschehen auf der Mini-Bühne beitrug. „Die Idee war entstanden, weil wir gemerkt haben, dass Krankenhäuser in der Pandemie von vielen Menschen eher gemieden werden. Dem wollten wir aktiv etwas entgegensetzen und zugleich aufmerksamkeitsstark für den so wichtigen Beruf der Pflege werben“, so Raschke.
Die Aktion, die eine Eigenkreation der Unternehmenskommunikation des Klinikums
Dortmund ist, verstehen die Macher als Beitrag zur Stärkung der Arbeitgeber-Marke. Das Klinikum ist bereits in den vergangenen Jahren immer wieder durch außergewöhnliche Rekrutierungs-Aktionen für Personal aufgefallen. Das Haus bekommt seit Jahren von unabhängigen Forschungs-Instituten eine hohe Arbeitgeber-Attraktivität bestätigt.
Weitere Infos zu Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten auch auf: www.klinikumdo.de/karriere
Foto: Klinikum Dortmund

Erklärung Marco Bülow: Kanzlerkandidat – Für den Bundestag reicht´s
Marco Bülow kandidiert erneut für den Bundestag. Für Die PARTEI und für Dortmund.
“Ich möchte mit 100% für eine lebenswerte Zukunft und eine saubere transparente Politik kämpfen. Im letzten Herbst habe ich mich bei der Bevölkerung beworben, erneut für den Bundestag zu kandidieren. Danach habe ich sehr viel Unterstützung erfahren. Fast 3000 Menschen
haben sich gemeldet und teilweise auch direkte Unterstützung angeboten. Dann kam Die PARTEI hinzu, der ich beigetreten bin. Sie hat mich für Dortmund als Direktkandidat nominiert. In NRW bewerbe ich mich für einen vorderen Listenplatz. Damit ist jetzt klar:
Ich kandidiere erneut für den Bundestag. Das Abenteuer hat begonnen und ich möchte den Wahlkreis direkt gewinnen. Und es bleibt dabei: Die Bevölkerung ist der Chef.
Die Volksparteien erodieren, zerlegen sich. Der Bundestag glänzt durch Starre, einseitigen Lobbyismus und Korruption. Krisen werden nicht wirklich angegangen, geschweige denn bewältigt. Pflegeplätze werden abgebaut und selbst in der Pandemie werden vor allem die Rüstungsausgaben drastisch erhöht, während Abgeordnete sich darum kümmern, mit Masken Geld zu verdienen. Dies fällt uns alles auf die Füße.
In NRW und in Dortmund sieht es nicht anders aus. Ich möchte die Politik umgestalten und mich gerade für diejenigen einsetzen, die keine starke Lobby haben. Natürlich spüre ich für meine Stadt Dortmund, die Region und seine Menschen eine besondere Verantwortung.
Es muss weiter einen Abgeordneten geben, der für eine saubere und soziale Politik kämpft und Missstände aufdeckt. Dortmund kennt mich.
Die PARTEI wächst unaufhörlich und hat mittlerweile bundesweit 50.000 Mitglieder. Wahrscheinlich wird die PARTEI im Herbst in Berlin das erste Mal ins Abgeordnetenhaus einziehen. Wir wollen 299 Kanzlerkandidatinnen für den Bundestag aufstellen. Zwei davon in Dortmund, mit Sandra Goerdt und mir. Es ist Zeit!”
Hier der Link zur vollständigen Erklärung: https://marco-buelow.de/meine-kandidatur-deine-wahl/
Foto: Die PARTEI Dortmund

Fachhochschule Dortmund ist „Leading Employer 2021“
Die Fachhochschule Dortmund gehört bundesweit zu den „Top 1 Prozent“ aller Arbeitgebenden, die jetzt mit dem Titel „Leading Employer 2021“ gewürdigt wurden.
Anlass für die Auszeichnung ist eine umfassende, auftragsunabhängige Studie zur erfolgreichen Personalarbeit, die das Düsseldorfer Institute of Research & Data Aggregation erstellt hat. Aspekte der Untersuchung waren unter anderem die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Arbeitsplätze. Aktuell hat die Fachhochschule rund 900 Mitarbeitende.
Karriere-Portal der FH Dortmund: www.fh-dortmund.de/karriere
Bildzeile: Ausgezeichnete Fachhochschule: Kanzler Jochen Drescher (links) und Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick mit der Glas-Trophäe „Leading Employer 2021“
Foto: FH Dortmund / Michael Milewski

Das Klinikum Dortmund hat im jetzt erschienenen „ServiceAtlas Kliniken 2022“ als Gesamturteil ein „sehr gut“ errungen und gehört damit zum Spitzenfeld der untersuchten Kliniken in Deutschland. Die 630 Seiten umfassende Publikation dient Patient:innen dazu, planbare Krankenhaus-Aufenthalte ganz im Sinne einer bestmöglichen und umfassenden Versor-gung zu organisieren. „Als Maximalversorger mit über 4.500 Mitarbeitenden in der Spitzengruppe einer solch detaillierten, reflektierten und vielschichtigen Analyse dabei zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns natürlich über das Ergebnis“, erklärt Marc Raschke, Leiter der Unternehmenskommunikation im Klinikum Dortmund.
Die Analyse umfasst 2.694 Befragte mit 3.812 Urteilen; eingeflossen sind Bewertungen von jeweils bis zu drei Kliniken, mit denen die Befragten in den letzten 12 Monaten persönlich Erfahrungen als Patient:in oder Besucher:in gesammelt haben. Die Kriterien der Bewertungen reichten von Kundenbindung und Klinikabläufe über pflegerische und ärztliche Versorgung bis hin zu Service-Zusatzleistungen. So wurde das jeweilige Haus u.a. im Hinblick auf Sauberkeit, Barrierefreiheit, Freundlichkeit, Image, Weiterempfehlung, Beratungsqualität etc. untersucht. Aber auch das Eingehen auf Patientenwünsche durch Ärzt:innen oder Pflegekräfte sowie die Organisation von Aufnahme und Entlassung fanden Berücksichtigung. Über 30 Einzelkriterien und Leistungsmerkmale wurden hierbei abgefragt.
Die Wettbewerbsstudie enthält Rankings sowie detaillierte Einzelprofile zu 28 kommunalen, 15 konfessionellen und überwiegend gemeinnützigen sowie 14 privaten Klinikgruppen. – Insgesamt wurden nur 18 Kliniken mit der Bestnote ausgezeichnet, darunter das Klinikum. Die Marktforschungs-Firma ServiceValue hat mit dem „ServiceAtlas Kliniken 2022“ bereits zum zweiten Mal dieses Ran-king in Sachen Kundenorientierung erstellt.
Foto: Klinikum Dortmund

DOGEWO21: Jetzt mit roten Elektro-Flitzern für die Mieterschaft im Einsatz
Das kommunale Wohnungsunternehmen
DOGEWO21 setzt verstärkt auf Elektromobilität: Die Serviceflotte für den Kundeneinsatz erhält derzeit 17 neue VW e-up!s. Damit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DOGEWO21 künftig zu Außenterminen wie z. B. Wohnungsvermietungen oder Baustellenterminen unterwegs. Stationiert wird die E-Flotte an fünf Servicebüros und auf dem Hof des Kundenzentrums an der Landgrafenstraße. Um die Fahrzeuge laden zu können, wurde dort jeweils eine eigene, mit Ökostrom betriebene Ladeinfrastruktur geschaffen.
Die Fahrzeuge sind vornehmlich im Dortmunder Stadtgebiet unterwegs. Sie ersetzen siebzehn Benziner und helfen somit rund 11,4 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen „Wir fühlen uns nicht nur dem Ziel verpflichtet, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, wir halten darüber hinaus auch eine emissionsfreie, relativ geräuscharme Serviceflotte für erstrebenswert“, sagt Christian Nagel, Prokurist Wohnungswirtschaft bei DOGEWO21.
Schon jetzt wird bei Neubauten die Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen und Garagen soweit vorbereitet, dass interessierte Mieter*innen sich direkt eine Wallbox durch ein Fachunternehmen installieren lassen können. So wurden erst im Herbst 2020 in Benninghofen 26 neue Garagen mit einer solchen Vorausstattung gebaut.
Das Unternehmen unterhält bereits seit 2016 einen e-Golf in der Serviceflotte. In den kommenden drei Jahren werden die neuen E-Flitzer im Arbeitsalltag erprobt. Aktuell sind außerdem noch dreizehn benzinbetriebene Servicefahrzeuge im Einsatz. Die Anschaffung weiterer Elektroautos bei auslaufenden Leasingverträgen ist vorgesehen.
Bildzeile: v.l. Christian Jäger, Hausverwalter, und Uwe Jänike, Bauleiter, mit neuen E-Autos für das DOGEWO21-Servicebüro in Benninghofen.
Foto: Dogewo21

Antrittsbesuch – Neuer Landrat
Der neu gewählte Landrat des Kreises Unna, Mario Löhr, stattete der Auslandsgesellschaft am einen Antrittsbesuch ab. Empfangen wurde er vom Präsidenten der Auslandsgesellschaft Klaus Wegener, dem Kuratoriumsvorsitzenden Wolfram Kuschke und dem Geschäftsführer Marc Frese. Mario Löhr interessierte sich insbesondere für die Arbeit der Auslandsgesellschaft im Bereich der Städtepartnerschaften und des internationalen Austauschs.
Bildzeile: Landrat Mario Löhr (2.v.li.) mit (re.) Marc Frese und Klaus Wegener sowie Wolfram Kuschke (li.) von der Auslandsgesellschaft.
Foto: Auslandsgesellschaft.de e.V.

PSD Bank Rhein-Ruhr eG veröffentlicht Geschäftszahlen 2020
Genossenschaftsbank schließt Corona-Jahr mit positiver Bilanz ab
Die PSD Bank Rhein-Ruhr verbuchte mit einer Bilanzsumme von 3,96 Mrd. Euro und einem Vorsteuergewinn von 21,2 Mio. Euro positive Zahlen im Geschäftsjahr 2020. Während der Corona-Pandemie setzte die Genossenschaftsbank verstärkt auf digitale Services und sorgte als Mitinitiator und Sponsor von Corona-konformen Veranstaltungen wie der PSD Bank Flight Night oder dem PSD ParkSommer für außergewöhnliche Erlebnisse in der Region.
Düsseldorf, 11.03.2021. Die PSD Bank Rhein-Ruhr blickt trotz der Corona-Pandemie auf ein positives Geschäftsjahr 2020 zurück. Durch das besondere Geschäftsmodell der beratenden Direktbank konnte sie die Herausforderungen in der Kundenbetreuung und -kommunikation digital meistern. Statt der persönlichen Beratungsgespräche in den Filialen nutzten die Kundinnen und Kunden im Lockdown neben der klassischen Telefonberatung ersatzweise Video-Calls, WhatsApp- und Chat-Beratung – digitale Strukturen, die zum Teil schon seit Jahren aufgebaut und erweitert wurden.
Positives Wachstum und Dividendenauszahlung trotz Corona-Pandemie
Die Regionalbank zeigte im Jahr 2020 ein solides Wachstum und stabile Zahlen. So hat sich die Bilanzsumme von 3,84 Mrd. Euro in 2019 auf rund 3,96 Mrd. Euro in 2020 erhöht. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei 21,2 Mio. Euro. Wichtige Geschäftstreiber der PSD Bank Rhein-Ruhr sind die Kundenkredite, die im Jahr 2020 bei stabilen 3,17 Mrd. Euro liegen. Während bei den Ratenkrediten aufgrund der Corona-Pandemie das Neugeschäft gebremst wurde (Zusagevolumen bei 90,2 Mio. Euro), konnte die Baufinanzierung um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. Das Volumen stieg hier von 378 Mio. Euro in 2019 auf 436 Mio. Euro in 2020.
Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen mit 2,72 Mrd. Euro sowie das betreute Kundenvermögen von 3,1 Mrd. Euro konnten wie in den letzten Jahren nahezu konstant gehalten werden. Mit rund 4.200 Neukunden betreute die PSD Bank Rhein-Ruhr zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt fast 150.400 Kundinnen und Kunden. „Für das Geschäftsjahr 2020 haben wir trotz der erschwerten Bedingungen und dem verstärkten Krisenmanagement ein gutes und solides Ergebnis erzielt und knüpfen damit an die Erfolge der letzten Jahre an“, erklärt August-Wilhelm Albert, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr eG. Daher sei auf der digitalen Vertreterversammlung im November 2020 auch eine Dividendenausschüttung von 1,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen worden.
Soziale Projekte wurden in Zeiten von Corona verstärkt
Neben ihrem Kerngeschäft beteiligte sich die PSD Bank Rhein-Ruhr auch im Jahr 2020 an einer Vielzahl kultureller, sportlicher und sozialer Projekte in der Region. „Als Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, auch in herausfordernden Zeiten zu helfen“, so Albert. „Die Corona-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Besonders stolz sind wir dabei auf die zahlreichen Veranstaltungen, mit denen wir unter Wahrung der Kontaktbeschränkung ein bisschen Abwechslung und Freude bieten konnten.“
So hat die Regionalbank etwa mit der PSD Bank Flight Night im Autokino Düsseldorf das erste professionelle Zuschauer-Sportevent Deutschlands seit dem Corona-Lockdown ermöglicht und Familienangebote wie den PSD ParkSommer in Dortmund mitinitiiert. Hinzu kamen Förderungen von zahlreichen sozialen Projekten, darunter ein Roboter für krebskranke Kinder für die Stiftung Universitätsmedizin Essen im Wert von 15.000 Euro oder einen Betrag von 17.000 Euro an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik in Düsseldorf.
Stark aufgestellt auch für 2021
Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich die PSD Bank Rhein-Ruhr auch dank ihrer starken digitalen Ausrichtung gut aufgestellt. „Unser Geschäftsmodell der beratenden Direktbank und speziell auch unsere digitale Infrastruktur haben sich während der Krise besonders bewährt“, so Dr. Stephan Schmitz, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr eG. „Für 2021 wollen wir daher die digitalen Services sowie auch das Thema Nachhaltigkeit, dem wir uns in besonderer Weise verpflichtet fühlen, noch stärker in den Fokus rücken.“
Bildzeile: Vorstände der PSD Bank Rhein-Ruhr Dr. Stephan Schmitz (l.) und August-Wilhelm Albert.
Foto: PSD Bank

Innovative Web-App wird in DOKOM21
Rechenzentren in Dortmund gehostet
Mobile Arbeitszeiterfassung und
digitale Urlaubs- und Personaleinsatzplanung ganz einfach auf
Smartphone, Tablet und Desktop erledigen. Der gfos.SmartTimeManager
ist eine praktische Web-App, die kleinen und mittelständischen
Unternehmen gerade auch in Zeiten von Corona und Homeoffice hilft,
effizient zu arbeiten. „Die Rechenzentrumsdienstleistungen von DOKOM21
unterstützen uns dabei, unseren Kunden störungsfrei laufende Cloud-Anwendungen wie beispielsweise gfos.SmartTimeManager garantieren zu können“, erklärt Francisco Pacheco, Geschäftsführer der GFOS-Technologieberatung GmbH, die zur Gesellschaft für
Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH (GFOS mbH) mit
Hauptsitz in Essen gehört. Bei der Umsetzung der GFOS knownCloud profitiert der IT-Spezialist von der Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit der DOKOM21 Rechenzentren in
Dortmund. Um eigene Applikationen hochverfügbar für Kunden in der Cloud
betreiben zu können, entwickelte GFOS die Idee zur GFOS knownCloud. „Dafür
suchten wir eine Basislösung, die die erzeugten Daten der GFOS knownCloud-Kunden über mehrere Rechenzentren hinweg – hochverfügbar und nahezu online – spiegelt“, berichtet Pacheco.
DOKOM21 Rechenzentren bieten leistungsfähige Infrastruktur
„Mit professioneller Beratung und Unterstützung durch DOKOM21-
Rechenzentrumsexperten haben wir uns für Systeme entschieden, durch die die
erwünschte Hochverfügbarkeit am autarken Standort und maximale
Verfügbarkeit erreicht werden konnte. Die Möglichkeit der Aktiv-Aktiv-Spiegelung
der Systeme über mehrere Standorte hinweg ist für uns ein Key Feature und
zwingende Voraussetzung für unsere Lösung. Die leistungsfähige Infrastruktur
des vom TÜV zertifizierten DOKOM21 Rechenzentrums in Dortmund garantiert
uns Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit“, erläutert der Geschäftsführer der
GFOS Technologieberatung.
Die DOKOM21 Rechenzentren sind mit einem hochmodernen Sicherheits- und
Brandschutzsystem, redundanter Stromversorgung, energieeffizienter Kühlung
und einer leistungsstarken Anbindung an die großen Internetbackbones wie
Frankfurt und Amsterdam ausgestattet. Mit insgesamt 4.600 Quadratmetern
Fläche ist DOKOM21 der größte Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet.
Neben GFOS profitieren weitere renommierte Unternehmen wie WILO, Materna,
Leifheit oder VOLKSWOHL BUND Versicherungen von den Rechenzentrums-
Dienstleistungen.
Hosting Service im GFOS eigenen Service-Rechenzentrum bei DOKOM21
Mit der GFOS knownCloud können die Kunden einen sicheren Hosting Service
nutzen. Die Auslagerung in das Rechenzentrum von DOKOM21 ermöglicht den
Kunden, von den zahlreichen Vorteilen der modularen Softwarefamilie von GFOS
zu profitieren – ohne teure und komplexe Hardware kaufen zu müssen. Der
Hosting Service erfolgt im GFOS eigenen Service-Rechenzentrum bei
DOKOM21 und steht täglich, 365 Tage im Jahr, für 24 Stunden für die Kunden
bereit. GFOS garantiert eine Verfügbarkeit von über 99,6 Prozent im Jahresdurchschnitt mithilfe der professionellen Infrastruktur des DOKOM21-Rechenzentrums.
Individuelle Beratung für interessierte Unternehmen
Weitere Informationen über Rechenzentrums-Dienstleistungen von DOKOM21
und eine individuelle Beratung erhalten interessierte Unternehmen unter Tel.
0231 930 94 02 oder per E-Mail an geschaeftskunden@dokom21.de.
Fragen zur ganzheitlichen Konzeption von IT-Umgebungen und zur modularen Softwarefamilie gfos beantwortet GFOS unter Tel. 0201 61 30 00 oder per E-Mail an info@gfos.com.
www.dokom21.de/rechenzentrum
www.gfos.com
Bei der Umsetzung der GFOS knownCloud profitiert GFOS mit Hauptsitz in Essen von der Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit der DOKOM21 Rechenzentren in Dortmund. Francisco Pacheco (re.), Geschäftsführer der GFOS Technologieberatung, und Carsten Schäfer, DOKOM21 Leiter Vertrieb Geschäftskunden, freuen sich über die Bereitstellung des TÜV zertifizierten Datacenters für GFOS im DOKOM21 Rechenzentrum.
Foto: Roland Kentrup

Geschichte erleben. Wirtschaft verstehen. Zukunft formen.
Westfälisches Wirtschaftsarchiv online auf Instagram
Gern hätte die Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte (GWWG) wieder 300 Gäste im Großen Saal der IHK zu Dortmund zu ihrem traditionellen Jahresvortrag begrüßt, aber die Zeiten haben sich geändert. „Vor dem Hintergrund der Corona-Situation haben wir bereits vor einigen Monaten entschieden, ein attraktives digitales Format zu entwickeln. Wir hoffen sehr, dass wir 2022 wieder in gewohnter Form zusammenfinden können und nach der Veranstaltung auch gemeinsam ein Glas Bier trinken können“, erklärt Dr. Ansgar Fendel, Vizepräsident der IHK zu Dortmund und Vorsitzender der GWWG. „Wir danken der DSW 21, namentlich unserem Vorstandsmitglied Hubert Jung, ohne deren großzügige Förderung wir dieses digitale Format nicht hätten realisieren können.“ Mit der Veranstaltung, die im You-Tube Channel der IHK zu Dortmund übertragen wurde und dort dauerhaft abrufbar ist, starten die GWWG und das Westfälische Wirtschaftsarchiv (WWA) eine neue Social-Media-Offensive, die unter dem Motto steht „Geschichte erleben. Wirtschaft verstehen. Zukunft formen.“ Entwickelt wurde diese Strategie zusammen mit der Konato GmbH. „Wir möchten Geschichte erlebbar machen! Jeden Monat befassen wir uns mit einem spannenden Thema der westfälischen Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Ihr könnt uns jederzeit hier auf Instagram Fragen stellen oder Anregungen schicken,“ freut sich Nicole Werhausen, Geschäftsführerin der Konato GmbH und seit Oktober Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte.
Auch einen Vortrag gab es bei der virtuellen Eröffnungsveranstaltung. Dr. Hubert Zilkens, promovierter Theologe und Unternehmensberater, sprach zum Thema Hoesch, und das aus besonderer Perspektive. Es ging um moralische Unternehmenswerte und Führungskultur. WWA-Direktor Dr. Karl-Peter Ellerbrock konnte ihre Bedeutung für die jüngere Hoesch-Geschichte aus eigener Erfahrung nur bestätigen. „Ich selbst habe einige Jahre im Stab von Dr. Rohwedder gearbeitet und den Prozess einer neuen Identitäts-findung von Hoesch nach dem Scheitern von Estel, dem ersten länderübergreifenden Unternehmenszusammenschluss in Europa, aktiv mitgestalten dürfen. Die Deutungsmacht der Geschichte spielte in diesem Konzept eine besondere Rolle.“ Geschichte erleben finden Sie auf Instagram unter „Wirtschaftsarchiv, WWA Dortmund.“
Bildzeile: v.l. Dr. Ansgar Fendel, Vorsitzender der GWWG, der Referent Dr. Markus Zilkens, Jürgen Wannhoff, stv. Vorsitzender der GWWG, Gastgeber Hubert Jung, Vorstand DSW 21, Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Geschäftsführer der GWWG, und Nicole Werhausen, Konato GmbH.
Foto: WWA/Oliver Schaper

Poschmann besucht Deutsches Industrielack-Museum in Dortmund
Die Dortmunder Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann tauschte sich mit dem Geschäftsführer der Kaddi-Lack Farben GmbH & Co.KG Thomas Grüner über die aktuelle Situation und Entwicklungen der Branche aus. Denn obwohl Grüner sich mit seinem Geschäft schon auf Kleinmengenabgaben und schnelle Auslieferungen spezialisiert hat, ist die Krise nicht spurlos an ihm vorbeigezogen. Dennoch schaut er positiv in die Zukunft und denkt sogar über Investitionen im Bereich Digitalisierung und Produktionserweiterung nach. Eine besondere Besichtigung gab es für Poschmann im Anschluss: Auf dem Firmengelände betreibt Grüner nämlich das Deutsche Industrielack-Museum. Hätten Sie gewusst, dass es so etwas in Dortmund gibt?
Foto: Büro Poschmann

Bundesfreiwilligendienst in Zeiten von Corona
Schulabschluss in der Tasche – und jetzt?
Freie Bufdi-Plätze im Klinikum Dortmund
Die Plätze sind begehrt, eine frühzeitige Bewerbung wird belohnt: Viele Jugendliche
entscheiden sich nach der Schule erstmal für eine Zeit im Bundesfreiwilligendienst
(Bufdi). Doch nicht nur junge Leute engagieren sich in
sozialen oder kulturellen Bereichen, alle Altersgruppen können sich auf eine
Bufdi-Stelle bewerben – auch in Pandemie-Zeiten. „Unsere Bufdis erhalten
selbstverständlich die gleichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen und
Impfungen wie alle anderen Mitarbeiter auch“, erklärt Christian Wurth, Koordinator
der Bundesfreiwilligen im Klinikum Dortmund. Wie viele Stellen
das Klinikum Dortmund besetzen darf, entscheidet nicht das Haus selbst:
Die Zuteilung erfolgt zentral über das Bundesfamilienministerium.
„Wir machen es uns zur Aufgabe, die Interessen individuell zu fördern“, sagt
Wurth. „Möchte ein Bundesfreiwilliger den Nachtdienst erleben, begleitet er eine
Schicht. Zieht er eine Ausbildung in Erwägung, darf er tageweise in die entsprechende
Abteilung, etwa in den Einkauf oder in die EDV, hineinschnuppern.“ Sogar
direkte Berufseinstiege werden nach Kräften und auf unbürokratischen Wegen
vermittelt, so Wurth.
Vielfältige Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Bundesfreiwilligen können sich in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten
innerhalb des Pflegehilfs- und Betreuungsdienstes im Klinikum in verschiedenen
Bereichen engagieren. Darunter fallen u.a. der Patientenbegleitdienst, die
neurologische Funktionsabteilung, die Blutspende, die EDV-Abteilung oder die
Zentrale Notaufnahme. Das Angebot, außerhalb von Beruf und Schule für einen
Zeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten in einem sozialen oder kulturellen
Umfeld arbeiten, richtet sich an Menschen aller Altersgruppen.
Bewerbungen jederzeit möglich, Schnelligkeit siegt
Es gibt keinen Bewerbungsschluss, Bewerbungen sind jederzeit möglich. Wer
eine der begehrten 30 Bufdi-Stellen im Klinikum Dortmund ergattern möchte, sollte
dennoch schnell sein: Die Zuteilung erfolgt zentral durch das Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), gesteuert durch ein komplexes
EDV-System, das vorschreibt, wann wie viele Bufdis aufgenommen werden
dürfen und wann nicht. Deshalb sollten sich Interessierte frühzeitig bewerben
– wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Das bietet das Klinikum Dortmund
Vielfältige Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Gutes Arbeitsklima
Krankenhausübliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen
Überdurchschnittliches Taschengeld (500 € zzgl. Sozialversicherung)
Mitarbeiter-Impfungen
38,5 Std. Woche
20 Tage Urlaub
25 Tage Weiterbildung
Dienstzeugnis
Beste Verkehrsanbindung
Kurzbewerbung bitte über das klinikinterne Bewerbungsportal: www.klinikumdo.de/karriere
Foto: Klinikum Dortmund

Weckbacher – Innovationsschmiede aus Westfalen feiert 75-jähriges Jubiläum
Dortmunder Sicherheitsexperten setzen deutschlandweit Maßstäbe – hochmoderne Schließanlagen sorgen für Schutz und Sicherheit
Die Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Sie blickt dabei auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die ihresgleichen sucht. „Wir sind am 3. Januar 1946 als kleiner Eisenwarenladen mit Schlüsseldienst gestartet. Heute zählen wir bundesweit zu den bedeutendsten Errichtern von Sicherheitstechnik. Vom Schlüssel mit Bart damals zur vollelektronischen Schließanlage heute – darauf sind wir schon ein wenig stolz“, erklären die beiden Geschäftsführer Dirk Rutenhofer und Michael Mainz, die seit 1992 am Ruder stehen und dank großartiger Mitarbeiter und vieler innovativer Entscheidungen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Expansion besitzen.
Bereits die Wirtschaftswunderjahre ließen den Betrieb florieren, so dass die damalige Weckbacher KG in den 1960er Jahren zu einem der bedeutendsten Großhändler des metallverarbeitenden Handwerks und der Industrie im Ruhrgebiet aufstieg. Im Privatkundensektor zählte das Unternehmen ebenfalls zu den führenden mechanischen Schließanlagenexperten. Doch zu Beginn der 1990er Jahre stand Weckbacher vor wirtschaftlichen und strategischen Herausforderungen. Die Märkte hatten sich geändert und erforderten mehr Beweglichkeit. Wollte es bestehen bleiben, musste sich das Unternehmen grundlegend wandeln. Die beiden neuen Geschäftsführer Michael Mainz und Dirk Rutenhofer sowie Prokurist Eckhard John erkannten das und setzten auf einen Neubeginn.
Die mit zum Teil schmerzhaften Einschnitten verbundenen Maßnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht. „Dank großartiger Mitarbeiter und vieler innovativer Entscheidungen transformierten wir uns vom alteingesessenen, eindimensionalen Schlüsseldienst zum Errichter digitaler Schließanlagen und elektronischer Sicherheitstechnik“, so Rutenhofer.
Jahrhundertauftrag Reichstagsgebäude
Tatsächlich darf das Unternehmen heute ohne falsche Bescheidenheit behaupten, dass wohl die meisten Bundesbürger einmal im Laufe ihres Lebens in einem von Weckbacher gesicherten Gebäude gestanden haben beziehungsweise stehen werden. So übrigens auch die vielen Fans des BVB beim Besuch der Heimspiele im Signal Iduna Park oder auch die Mitarbeiter, Patienten, Besucher und Kunden von Krankenhäusern, Banken, Verlagshäusern, Museen oder Universitäten im gesamten Bundesgebiet.
Der Durchbruch und damit Meilenstein für den bundesweiten Erfolg des Unternehmens liegt bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück. 1999 erhielten die Sicherheitsexperten von der Bundesrepublik Deutschland den Auftrag, das Reichstagsgebäude nebst sämtlichen Neubauten des Deutschen Bundestages in Berlin zu „verschließen“. Inzwischen sind die Anlagen aus Dortmund nahezu im gesamten Regierungsviertel, aber auch im Berliner Schloss oder im Bundeskanzleramt zu finden. Daneben finden sich zahlreiche Ankerprojekte in anderen Teilen der Republik, darunter die Zwillingstürme der Deutschen Bank sowie der Maintower in Frankfurt, die Meistersingerhalle in Nürnberg, die neue Messe und das Staatstheater in Stuttgart oder das Universitätsklinikum Düsseldorf mit mehr als 20.000 intelligenten Türschlössern. Demzufolge hat Weckbacher auch eigene Niederlassungen in Berlin, Würzburg, Maintal, Stuttgart sowie Bielefeld.
Das Unternehmen beschäftigt derzeit 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zahlreiche seiner Schlosser, Tischler, Elektrotechniker, Ingenieure, Kaufleute und IT-Experten hat es selber ausgebildet. Hier blieb es seinen Wurzeln treu, denn schon seit den 1950er Jahren kümmerte es sich um gut ausgebildeten, eigenen Nachwuchs. Eine der ersten Auszubildenden war Ursula Krause, die dem Unternehmen bis zu ihrem Ruhestand 50 Jahre lang treu blieb. Derzeit absolvieren acht junge Menschen ihre Ausbildung zu Kaufleuten für Bürokommunikation, Kaufleuten im Groß- und Außenhandel und zu Elektrotechnikern der Fachrichtung Nachrichtentechnik. Weitere 18 Angestellte arbeiten seit ihrer Ausbildung bei Weckbacher, manche von ihnen bereits seit nahezu 30 Jahren. Wie zum Beispiel Prokurist und Gesamtvertriebsleiter Dennis Ochmann.
Besondere Expertise im medizinischen Bereich
„Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden verläuft immer sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich. Bei der Projektierung und Installation von neuen Sicherheitsanlagen, wie auch bei Anpassungen und Erweiterungen von digitalen und mechanischen Schließanlagen schätzen sie vor allem den persönlichen Kontakt, die Beratung und unsere starke Problemlösungskompetenz“, betont Dennis Ochmann.
Seit langem setzen die Experten Maßstäbe, wenn es um die Einführung innovativster Zugangstechnik geht. Ihre Expertise zeigte sich zuletzt besonders im medizinischen Bereich. War sie bereits vor Corona im laufenden Krankenhausbetrieb unter strengsten Hygienevorgaben äußerst gefragt, konnten die Fachleute ihre Fertigkeiten unter den momentanen Ausnahmebedingungen erneut beweisen.
„Dank unserer elektronischen Zugangssteuerungen konnten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sehr schnell neue Hochsicherheitszonen zum Beispiel für medizinische Schutzkleidung eingerichtet werden“, so Michael Mainz.
Neuer Firmensitz mit Sicherheitszentrum
„Unsere Kundschaft besteht aber nicht nur aus Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Wir statten auch Einfamilienhäuser und Wohnungen mit modernen Sicherheitssystemen aus“, so Rutenhofer. Welche Lösungen Weckbacher für private und gewerbliche Immobilien bietet, können die Dortmunder bald am neuen Firmensitz an der Hannöverschen Straße 76 begutachten. Das derzeit im Bau befindliche dreigeschossige Gebäude wird neben den notwendigen Planungs- und Verwaltungsbüros mit dem „Weckbacher Sicherheitszentrum NRW“ auch wegweisende Muster- und Ausstellungsflächen beinhalten, die den Stand der Sicherheitstechnik eindrucksvoll demonstrieren.
Damit bekennt sich das Unternehmen klar zum Standort Dortmund. „Wir freuen uns, den Umzug pünktlich in unserem Jubiläumsjahr zu realisieren. Es ist ein wahrer Schlüsselmoment für uns.“
www.weckbacher.com
Bildzeile: An der Hannöverschen Straße 76 in Dortmund entsteht derzeit die neue Firmenzentrale der Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH. Neben den notwendigen Planungs- und Verwaltungsbüros befindet sich hier zukünftig auch das „Weckbacher Sicherheitszentrum NRW“ mit wegweisenden Muster- und Ausstellungsflächen, die den Stand der Sicherheitstechnik eindrucksvoll demonstrieren. Der Bau des dreigeschossigen Gebäudes ist ein klares Bekenntnis zu Standort Dortmund.
Foto: Jan Heinze

Stadterneuerung Hörde – zweite Phase der Beteiligung zum Stadteingang abgeschlossen
Auch die zweite Phase der Beteiligung zum Stadteingang Hörde ist auf großes Interesse gestoßen. Nachdem es in der ersten Phase um die Ausstattungselemente ging, wurde jetzt der Entwurfsplan vorgestellt und diskutiert.
Die Fläche vor der Sporthalle an der Faßstraße wird im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms ganz neu gestaltet. Hier soll ein Bereich entstehen, der vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht ist. Der Autohändler wird demnächst mit seinem Betrieb an einen anderen Standort umziehen.
Der Entwurf wurde als digitaler Plan und als 3-D-Modell in zwei Videos auf der Beteiligungsseite der Hörder Stadtteilagentur vorgestellt und erläutert. Parallel wurde ein Flyer an rund 4.500 Haushalte in Hörde verteilt und im Büro der Hörder Stadtteilagentur ausgelegt. Wieder waren alle Interessierten eingeladen, ihre Meinung zum bisherigen Stand der Planung zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen.
Hohe Zustimmungswerte zu den Plänen
Und erneut interessierten sich mehrere hundert Personen für die Umgestaltung des Stadteingangs Hörde. Über soziale Medien konnten über 2.000 Personen erreicht werden. Die Beteiligungsseite wurde fast 1.000 Mal aufgerufen. Die Videos schauten sich über 500 Personen an. Fast 50 Anregungen und Kommentare erreichten die Hörder Stadtteilagentur.
„Der Zustimmungswert zu den Plänen der Stadt Dortmund und des Planungsbüros wbp Landschaftsarchitekten erreichte fast 80 Prozent“, zeigt sich die Leiterin der Stadterneuerung, Susanne Linnebach erfreut. „Und es gab eine Reihe von bedenkenswerten Verbesserungsvorschlägen. Damit verzeichnen wir eine hohe Akzeptanz der Pläne und es unterstreicht wie wichtig es ist, die Bewohner*innen eines Stadtteils für eine Mitwirkung zu gewinnen“, so Linnebach weiter.
In vielen Kommentaren wurden zum einen Fragen der Sicherheit und Sauberkeit thematisiert. Zum anderen wurden in einigen Beiträgen die Radwegeführung und der Abstand der Sportgeräte zur Straße angesprochen. Das Schaffen von mehr Grün und der Erhalt des alten Tankstellendaches im Baustil der 1960er Jahre wurden positiv gesehen.
Hinweise gehen in die Planung ein
Jetzt läuft die Auswertung. Von den eingegangenen Hinweisen fließen die Ersten bereits in die laufende Planung ein. Die Lage der Trampoline wird beispielsweise so verändert, dass sie nicht mehr nahe der Straße liegen. Die Kombination mit der Calisthenics-Anlage (Trainingsanlage für Eigengewichtsübungen) entfällt, so dass hier jede Nutzer*innengruppe für sich aktiv sein kann. Der Grünanteil wird erhöht.
Das Thema der Radwegeführung ist schwieriger zu lösen. Denn die Rad- und Fußwegeführung entwickelt sich aus der vorhandenen Brücke und eine Verlegung der Bushaltestelle hätte schwere Nachteile. Eventuell bietet das Gelände des neuen Stadteingangs eine autofreie Alternative für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, wird es einen ausführlichen Bericht geben, zu welchen Punkten Hinweise eingegangen sind und wie mit ihnen umgegangen wird.
Der konkreten Planung für den Stadteingang vorausgegangen war ein Wettbewerbsentwurf für den Schulhof des Phoenix-Gymnasiums und den Stadteingang. Der Schulhof ist bereits umgebaut worden. Jetzt folgt der Stadteingang, nachdem das Privatgrundstück des Autohandels von der Stadt gekauft wurde.
Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Umgestaltung des Stadteingangs an der Faßstraße gemeinsam. Die PHOENIX Flächen und Hörde sollen zusammenwachsen und sich gemeinsam entwickeln. Das Projekt ist Teil des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde“.
Grafik: Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt

Go-Live von handwerk-digital.nrw
Neue Digitalisierungs-Plattform für das Handwerk
Gemeinschaftsprojekt vom Land NRW mit 1 Mio. Euro gefördert
Go-Live von handwerk-digital.nrw: Es gibt ab sofort eine neue Digitalisierungs-Plattform für Handwerksbetriebe in Nordrhein-Westfalen. Sie bietet Unternehmen ausführliche Informationen, viele nützliche Tools und individuelle Unterstützung rund ums Thema Digitalisierung. Sie hilft Betrieben, Prioritäten bei der digitalen Transformation zu setzen.
Ob Fragen zu Fördermitteln, Anpassungen von Geschäftsmodellen oder verbesserte Sichtbarkeit von Homepages im Internet – auf handwerk-digital.nrw gibt es die richtigen Antworten.
Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart:
„Es freut mich sehr, dass mit handwerk-digital.nrw nun eine attraktive Digitalisierungs-Plattform mit hohem Nutz- und Informationswert an den Start geht. Die digitale Transformation verändert das Handwerk und die Märkte grundlegend. Es ist wichtig, dass immer mehr Handwerksbetriebe die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, die digitale Transformation aktiv mitgestalten und sich weiterentwickeln. Als zentrale digitale Anlauf- und Austauschplattform für die 1,1 Millionen Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Handwerk, die Unternehmen, Kammern und Fachverbände des Handwerks in Nordrhein-Westfalen wird das Angebot ein wichtiges Instrument für den Wissenstransfer rund um das Thema digitale Transformation werden und vielen Betrieben wertvolle Unterstützung rund ums Thema Digitalisierung geben.“
„Die Plattform ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur digitalen Transformation des Handwerks in NRW“, sagt Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund. „Durch die Digitalisierung befinden sich sowohl handwerkliche Wertschöpfungsketten als auch Geschäftsmodelle und Marktprozesse im Umbruch. Das stellt unsere Betriebe vor große Herausforderungen und bietet gleichzeitig ein enormes Potential, das nicht ungenutzt bleiben sollte. Die Handwerksorganisationen in NRW arbeiten eng mit der LGH zusammen, um ihren Mitgliedern die bestmögliche Beratung und Unterstützung zukommen zu lassen. Wir freuen uns, dass wir unserem Dienstleistungsangebot nun eine zentrale Anlaufstelle für das komplexe Themenfeld der Digitalisierung mit der Unterstützung des Landes hinzufügen können.“
handwerk-digital.nrw ist ein Gemeinschaftsprojekt der HWK Dortmund, HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld sowie der Fachverbände Tischler NRW und Metall NRW. Erklärtes Ziel des Konsortiums ist es, Handwerksunternehmen in Nordrhein-Westfalen bei der digitalen Transformation Möglichkeiten aufzuzeigen und sie aktiv bei der Umsetzung erfolgversprechender Vorhaben zu begleiten.
Das Projekt ist Teil der „Digitalisierungsoffensive Handwerk NRW“ und wird vom Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie über einen Zeitraum von drei Jahren mit 1 Mio. € gefördert. Die Fördermaßnahme wird von der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) als bewilligende Stelle abgewickelt
Mit dem Launch der Webseite, die in den letzten zweieinhalb Jahren federführend von der HWK Dortmund aufgebaut wurde, bekommen die mittelständischen Unternehmen des Handwerks ein neues passgenaues Tool an die Hand – eine zentrale Plattform als Orientierungshilfe und Leitfaden für die digitale Weiterentwicklung im Handwerk. Neben News und Wissensvermittlung gibt es beispielsweise einen umfassenden Veranstaltungskalender.
Betriebsinhaber können eine neue Beraterdatenbank nutzen (organisationsübergreifend und per fachlicher und geographischer Vorauswahl) und so auf das Know-how der Digitalisierungs-Experten von Kammern und Fachverbänden in Nordrhein-Westfalen zurückgreifen. Ergänzend gibt es ein Frage-Antwort-Tool. Jede Frage wird individuell beantwortet und dann anonym veröffentlicht.
Dr. Jens Prager, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe, die als Lead-Partner am Projekt beteiligt ist, freut sich über den Launch der Website: „In den zurückliegenden Monaten hat die Corona-Pandemie der Digitalisierung, die schon vor Corona als Zukunftsthema für das Handwerk von Bedeutung war, einen Turbo verliehen. Die Website gibt der Digitalisierung im Handwerk nun eine feste Adresse. Hier erhalten die Betriebe Informationen, Beratung und Unterstützung auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft.“
handwerk-digital.nrw ist der Grundstein für die digitale Weiterentwicklung der Handwerksbetriebe in Nordrhein-Westfalen. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für ausführliche Informationen, nützliche Tools und persönliche Unterstützung rund um Digitalisierung.
Foto: Roman Samborskyi / handwerk-digital.nrw/ Shutterstock.com

Kreative Schneidermeisterin
feiert silbernes Betriebsjubiläum
Konni Lach fertigt seit 25 Jahren mit großer Begeisterung hochwertige Mode für Damen / Innung gratuliert persönlich im Maßatelier in Holzwickede
Bereits seit 25 Jahren fertigt Damenschneidermeisterin Konni Lach erfolgreich Mode für ihre Kundinnen. Anlässlich des Jubiläums ließen es sich Inge Szoltysik-Sparrer, Obermeisterin der Innung für Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet und Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas nicht nehmen, persönlich zur Gratulation zu kommen und die Ehrenurkunde des Handwerks zu übergeben. „Als kreative und engagierte Modeschaffende sind Sie seit Jahren eine Bereicherung für unsere Branche und die Innung. Wir wünschen Ihnen noch viele erfolgreiche Jahre“, gratulierte die Obermeisterin.
Starker Einsatz für den eigenen Traum
Mit viel Elan und großem Einsatz verwirklichte Konni Lach ihren Traum der Selbstständigkeit: Nach einer Ausbildung zur Damenschneiderin in Dortmund absolvierte sie 1990 die Meisterprüfung und machte sich 1996 im Union-Gewerbehof an der Huckarder Straße als Damenschneidermeisterin selbstständig. Um ihr Unternehmen auf sichere finanzielle Beine zu stellen und nach und nach einen Kundenstamm aufzubauen, war sie in den ersten Jahren gleichzeitig fest angestellt als Schneidermeisterin in einem Ausbildungszentrum in Herne und in einer Waldorf-Schule. „Ich habe ganztags gearbeitet und war abends noch in meinem Atelier. Das hat mir Freude bereitet“, erinnert sich die Schneidermeisterin. 2004 verwirklichte sie ihren Traum endgültig, kündigte ihre Festanstellung und widmete sich nur noch ihrem eigenen Betrieb. „Ich wollte endlich mehr Zeit haben, um die Arbeit zu machen, die ich so liebe: die kreative Maßarbeit“, so die 64-jährige Dortmunderin. Ihr derzeitiges, lichtdurchflutetes Maßatelier an der Schloßallee 11 in Holzwickede bezog die Damenschneidermeisterin, die bereits seit sieben Jahren Mitglied der Innung Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet ist, erst im Mai vergangen Jahres. Zuvor hatte sie ihren Firmensitz 20 Jahre lang in Dortmund-Hombruch.
Spezialistin für Damenmode
Konni Lach hat den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf maßgeschneiderte Business-Kleidung und Festliches gelegt. „Ich fertige aber auch gern Alltagskleidung an. Viele Frauen sind nicht glücklich mit dem, was sie an Mode von der Stange bekommen und wenden sich dann an mich“, so die Schneidermeisterin. „Ich freue mich sehr, meinen Kundinnen mit stilvoller Kleidung eine Freude machen zu können. Ich bekomme viel positive Rückmeldung und das ist ein großartiges Gefühl. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Konni Lach freut sich, weiterhin für ihre Kundinnen da zu sein und noch viele modische Highlights setzen zu können.
Bildzeile: Gratulierten persönlich zum 25-jährigen Betriebsjubiläum: Inge Szoltysik-Sparrer, Obermeisterin der Innung für Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet (r.) und Ludgerus Niklas, Geschäftsführer der Innung (M.), übergaben Schneidermeisterin Konni Lach (l.) einen Blumenstrauß und die Ehrenurkunde.
Foto: Innung

Doppeltes Meister-Jubiläum
in der Autolackiererei Richter
Geschäftsführer des Fachverbands Lack- und Karosserietechnik Westfalen verleiht Urkunden an verdiente Handwerksmeister des traditionsreichen Familienbetriebs in Coesfeld
Gleich doppelten Grund zur Freude gab es jetzt bei der Autolackiererei Richter GmbH in Coesfeld. Seniorchef Otto Richter und sein Neffe Ralf Heitz-Große Lembeck erhielten aus den Händen von Volker Walters, dem Geschäftsführer des Fachverbands Lack- und Karosserietechnik Westfalen, Ehrenurkunden zu ihrem Meisterjubiläum im Handwerk. Otto Richter, der am 5. März 1960 seine Prüfung als Maler- und Lackierermeister vor der Handwerkskammer Münster ablegte, erhielt den diamantenen Meisterbrief für 60 erfolgreiche Jahre im Handwerk. Sein Neffe Ralf Heitz Große-Lembeck, der am 16. Februar 1995 seine Prüfung als Fahrzeug-Lackierermeister ebenfalls vor der Handwerkskammer Münster ablegte, erhielt den silbernen Meisterbrief für 25 meisterliche Jahre. „Die beiden Urkunden, die ich Ihnen heute im Namen unseres Fachverbands und der Handwerkskammer überreiche, sind ein beeindruckendes Zeugnis Ihrer persönlichen Leistung, aber auch der hohen Qualität Ihres Unternehmens“, so Geschäftsführer Volker Walters in seiner Laudatio. „Wer einen Familienbetrieb über so viele Generationen erfolgreich führt, muss hervorragende handwerkliche Arbeit leisten. Zu diesem außergewöhnlichen Ereignis beglückwünsche ich Sie beide.“
Familienbetrieb seit Generationen
Die Autolackiererei Richter GmbH kann auf eine fast 90-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1932 im benachbarten Rosendahl-Holtwick. Dort hatte Josef Richter, der Vater des heutigen Seniorchefs Otto Richter und Großvater von Gesellschafter-Geschäftsführer Ralf Heitz- Große Lembeck , ein Malergeschäft, in dem er auch Kutschen lackierte und verzierte. Nach dem Krieg baute der geschäftstüchtige Handwerker mit seinem Sohn Otto Richter eine kleine Werkstatt auf, in der er die ersten Autos reparierte und lackierte. Der heutige Diamant-Jubilar legte seine Gesellenprüfung 1955 ab, machte 1960 seinen Meister und übernahm anschließend den väterlichen Betrieb. Dank stark steigender Auftragszahlen baute er das Unternehmen Anfang der 1970er Jahre am Standort Coesfeld komplett neu auf, modernisierte und erweiterte den Betrieb bis heute stetig. Damals wie heute gehörten und gehören zu den Kunden vor allem Autohäuser und Werkstätten sowie Privat- und Firmenkunden aus Coesfeld und der ganzen Umgebung. Im Jahr 2008 wurde die nächste Generation in die Geschäftsleitung des Unternehmens einbezogen. Ralf Heitz- Große Lembeck, der aktuelle Silbermeister-Jubilar, und sein Bruder Uwe Heitz übernahmen als Neffen die Geschäftsführung. Gemeinsam erweiterten sie das Unternehmen und führten es erfolgreich in das Zeitalter der Digitalisierung. Auch die Tochter des Seniorchefs, Bianca Vacker (geb. Richter), ist im Familienunternehmen tätig.
Weit über 100 junge Menschen ausgebildet
Heute hat die Autolackiererei Richter GmbH ein eingespieltes Team mit rund 20 Beschäftigten – allesamt selbst ausgebildet oder langjährige Mitarbeiter, darunter vier Meister und drei Auszubildende. Als Ausbildungsbetrieb und wahre Talentschmiede hat sich das Unternehmen in der Region in all den Jahrzehnten seines Bestehens einen guten Namen gemacht. Weit über 100 junge Menschen hat der Familienbetrieb bereits den Einstieg in eine sichere berufliche Zukunft im Handwerk ermöglicht. Und sogar Landes- und Bundessieger im Fahrzeuglackiererhandwerk gingen aus dem Mitarbeiterkreis der Autolackiererei Richter hervor. Anlässlich des Jubiläums, das bedingt durch die Corona-Pandemie nur im Kreis der engsten Familie gefeiert werden konnte, bedankten sich beide Jubilare ausdrücklich bei allen Beschäftigten für ihre immer sehr gute Arbeit und bei ihren Kunden und Geschäftspartnern für die langjährige Treue.
Bildzeile: Gratulation zum Jubiläum: Betriebsleiter Ralf Heitz-Große Lembeck, Volker Walters, Geschäftsführer des Fachverbands Lack- und Karosserietechnik Westfalen und Seniorchef Otto Richter.
Foto: Fachverband Lack- und Karosserietechnik Westfalen
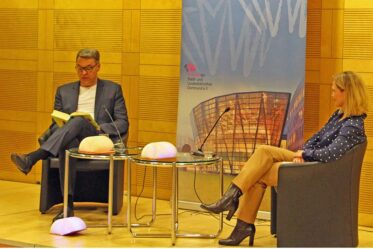
Der Oberbürgermeister und „Herr Bello“, der Virologe und das Beatles-Virus: Prominente lesen vor
Wenn der Oberbürgermeister mit verstellter Stimme einen Hund mimt; wenn die Vorstandsvorsitzende des Dortmunder Energieversorgers mit großem Spaß von „achtsamen Morden“ spricht, und wenn ein Virologe sich vom Beatles-Virus anstecken lässt… dann ist man mittendrin bei „Dortmund liest“. Die 44. Ausgabe der beliebten Veranstaltung, organisiert von den Freunden der Stadt- und Landesbibliothek, fand am Montagabend bereits zum zweiten Mal ohne Publikum statt – dafür wurde live aus dem Studio B gestreamt. Der Abend ist unter folgendem Link weiterhin abrufbar: https://youtu.be/UkBrO_WrVdY.
Zu Gast waren diesmal Oberbürgermeister Thomas Westphal, die Vorsitzende der DEW21-Geschäftsführung Heike Heim sowie der Direktor der Lungenklinik im Klinikum Dortmund, Dr. Bernhard Schaaf. Im Gespräch mit Moderatorin Kerstin von der Linden plauderten sie über Literatur und das Lesen, ließen sich aber auch einige private Dinge entlocken, bevor sie gut zehn Minuten lang aus ihren mitgebrachten Büchern vorlasen.
Das dickste Buch hatte Oberbürgermeister Thomas Westphal mitgebracht: Das Kinderbuch „Herr Bello“ von Paul Maar war Familienlektüre in einem verregneten Urlaub auf Bornholm, verriet er. Seine beiden Töchter (12 und 14) hatten ihn bei der Lektüreauswahl beraten. Westphal erwies sich als versierter Vorleser, der die Geschichte um einen Hund, der dank eines „Wunderdüngers“ zum Menschen mutiert, auch erwachsenen Leser*innen empfahl.
Heike Heim outete sich im Interview als Schnellleserin, die inzwischen auf E-Books umgestiegen sei. Sie hatte den unterhaltsamen Krimi-Bestseller „Achtsam Morden“ von Karsten Dusse im Gepäck. Dr. Bernhard Schaaf dagegen empfahl „The Beatles“ von Frank Goosen, der seine musikalische Sozialisation ebenso beschreibt wie eine Reise nach Liverpool. Alle drei Bücher stehen in der Stadt- und Landesbibliothek zur Ausleihe bereit.
In der Veranstaltung erinnerte Wolf-Dietrich Köster, Vorsitzender der Bibliotheksfreunde, an seinen kürzlich verstorbenen Vorgänger Dr. Walter Aden, der „Dortmund liest“ im Jahr 2000 ins Leben gerufen und bis 2018 wortgewaltig, einfühlsam und humorvoll moderiert hatte. Aden, von 1999 bis 2017 Vorsitzender der Bibliotheksfreunde und seitdem Ehrenvorsitzender, habe den Verein der Bibliotheksfreunde mit seinen 600 Mitgliedern groß gemacht, würdigte Köster.
Die nächste „Dortmund liest“-Veranstaltung findet im November statt.
„Dortmund liest“ vom 15. März: https://www.youtube.com/watch?v=UkBrO_WrVdY
Webseite der Bibliotheksfreunde:
https://bibliotheksfreunde-dortmund.de/
Bildzeile: Oberbürgermeister Thomas Westphal und Moderatorin Kerstin van der Linden.
Foto: Hans-Christian Wirtz/Stadt- und Landesbibliothek

Ministerin Scharrenbach übergibt fast 170.000 Euro Fördermittel für Hörder „Brückengeschichten“
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen fördert die Hörder „Brückengeschichten“ des örtlichen Vereins Hörde International e.V. mit fast 170.000 Euro. Den Bescheid über die Gelder aus dem Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ überbrachte Ministerin Ina Scharrenbach der Vereinsvertretung persönlich im Beisein von Bürgermeisterin Barbara Brunsing sowie Bezirksbürgermeister Michael Depenbrock.
In den kommenden beiden Jahren möchte das Kunstprojekt „Brückengeschichten“ vor Ort hör- und erlebbar machen, was die Hörder*innen miteinander und mit ihrem Stadtteil als Heimat verbindet. „Das Projekt ,Brückengeschichten‘ in Hörde ist ein gelungenes Beispiel für die Nutzung des Förderinstruments ,Heimat-Werkstatt‘. Die Kombination von Hörbeiträgen und Wandbildern stärkt die lokale Identität, fördert die Verbundenheit im Dortmunder Quartier und macht lokale Geschichte(n) erlebbar“, kommentiert Ministerin Scharrenbach die außergewöhnliche Initiative.
Wie die Idee für die „Brückengeschichten“ entstand
Bei den Vorbereitungstreffen zum Brückenfest im Winter 2019 tauschten sich der Vorstandsvorsitzende von Hörde International e.V., Jochen Deschner, und Silvia Liebig, Dortmunder Künstlerin, über ihre geplanten Projekte aus. Dabei entschied man sich, die beiden Projekte Wandbilder und Oral-History-Collage in einem zusammenzufassen, weil sie sich so wunderbar ergänzten. Die Idee einer Fassadenbemalung von Hörder Wohnhäusern durch Kunstschaffende unter dem Titel „Brückengeschichten“ war geboren.
Wie lassen sich möglichst viele der Hauseigentümer*innen im Stadtteil für die Idee einer Fassadenbemalung gewinnen? Welche Motive können die Fassaden aufwerten? Die Hörder Stadtteilagentur, die im Rahmen der Stadterneuerung Hörde beratende und vermittelnde Ansprechpartnerin für die Hörder Bürgerschaft ist, stellte sich eben diese Fragen und suchte für die Umsetzung der “Brückengeschichten“ finanzielle Unterstützung. Nach intensiver Beratung durch das Amt für Stadterneuerung wurde mit dem Modul der „Heimat-Werkstatt“ aus dem Heimatförderprogramm des Landes NRW das passende Förderprogramm gefunden.
Die Heimat-Werkstatt will Menschen miteinander darüber ins Gespräch bringen, was ihre lokale Identität ausmacht, und dafür sensibilisieren, was sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld als Gemeinschaft verbindet. Sie besteht aus zwei Phasen und beginnt immer mit einem offenen Diskussions- und Arbeitsprozess, der die Einwohner*innen in breiter Form an der Frage teilhaben lässt, was sie prägt und ausmacht.
Für diesen sogenannten „Werkstatt-Prozess“ sollten die Hörder Bürger*innen ursprünglich im Rahmen des Hörder-Brückenfestes in einer von der Künstlerin Silvia Liebig entwickelten Sprachkabine erzählen, was sie verbindet, warum sie sich in Hörde zuhause fühlen. Daraus entstand der Name des Projektes „Brückengeschichten“.
Hörder Geschichten werden akustisch gesammelt und in Wandbilder umgewandelt
Coronabedingt konnte das Brückenfest, welches seit dem Jahr 2015 durch den Verein Hörde International e.V. organisiert wird, nicht stattfinden. Kurzerhand entwickelte die Künstlerin zusammen mit dem Verein eine Alternative, die auch das Heimatministerium überzeugte: Die Geschichten, die ein Bild vom Heimatort Hörde ergeben, werden nun mit Mikrofon und Aufnahmegerät eingefangen und von der Künstlerin zu Hörstücken komponiert. In Kurzinterviews formulieren Einzelpersonen spontan ihre Antworten zu Fragen rund um Hörde als Heimat, die als Audiodateien aufgenommen und später zu einem „akustischen Stimmungsbild“ zusammengefügt werden.
In der zweiten Phase der Heimat-Werkstatt setzen Streetart-Künstler*innen die Hörstücke von Silvia Liebig in Wandbilder, sogenannte Murals, um. Ab Herbst 2022 wird man an fünf Standorten in Hörde die gemalten Wandbilder sehen und gleichzeitig die Hörstücke per App hören können.
Bezirksvertretung Hörde unterstützt den Verein
Zu den Gesamtkosten für die Fassadenbemalungen von ca. 188.000 Euro steuert das Land Nordrhein Westfalen 90 Prozent dazu. „Ohne die Förderung wäre das Projekt in dieser Form nicht durchführbar gewesen“, sagt Jochen Deschner, 1. Vorsitzender des projektdurchführenden Vereins „Hörde International e.V.“.
Die restlichen 10 Prozent der Gesamtkosten kommen aus Mitteln des Vereins. Dabei ist die Vereinsförderung der Bezirksvertretung Hörde hilfreich. „Die Bezirksvertretungen können in ihrem Stadtbezirk über die Förderung von Kunst und Kultur sowie Heimat- und Brauchtumspflege entscheiden“, erklärt Bezirksbürgermeister Michael Depenbrock. „Daher unterstützen wir in Hörde gerne einen Verein, der sich im Stadtgebiet mit viel ehrenamtlichem Engagement einen Namen gemacht hat“.
Auch Bürgermeisterin Barbara Brunsing freut sich über die Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen: „Das Projekt fördert die Entstehung von Kommunikationsstrukturen und stärkt das Gemeinschaftsbewusstsein. Wir Dortmunder*innen verstehen uns als eine zupackende Solidargemeinschaft. Mit den „Brückengeschichten“ zeigen wir funktionierende Nachbarschaften in der Großstadt, in denen man sich kennt und vertraut.“
Übrigens: Noch sind auch nicht alle Fassaden ausgewählt, die in der zweiten Phase des Projekts bemalt werden – Bewohner*innen und Eigentümer*innen in Hörde sind herzlich aufgerufen, Vorschläge auch dafür bei der Hörder Stadtteilagentur einzureichen.
Hörde International e.V. – Bürger*innenverein für das neue Hörde
In Hörde wird, wie an kaum einer anderen Stelle, gelungener und beispielhaft schnell vollzogener Strukturwandel erlebbar. PHOENIX West entwickelte sich zum zukunftsweisenden Technologiezentrum, und aus PHOENIX Ost wurde das “Wohn- und Freizeitparadies PHOENIX See“. Der Emscher-Umbau brachte viele neue Naturbereiche mit vielschichtigem Rad- und Fußwegenetz. So sehen wir das Hörder Zentrum heute gestärkt, erweitert und zu neuem Leben erwacht.
Für dieses neue Hörde gibt es seit 2014 einen Verein. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einheit Hördes aus Alt und Neu und das enge Zusammenwachsen dieser beiden Teile weiter voranzutreiben und zu fördern: HÖRDE INTERNATIONAL e.V.
Ein wichtiges Symbol für das neue Hörde war in den vergangenen Jahren das „BRÜCKENFEST HÖRDE INTERNATIONAL“. Das Fest zielt darauf, die Hörder City mit dem PHOENIX See und den Grünzügen der Emscher zu verbinden. Mehrere 10.000 Besucher*innen ließen sich animieren, den beeindruckenden Stadtumbau in Hörde zu begutachten und das Stadtteilzentrum mit seinem neuen Umfeld als Naherholungsgebiet zu erkunden. HÖRDE INTERNATIONAL e.V. hat dieses Fest mittlerweile mehrere Male organisiert. Der Verein hat damit einen zivilgesellschaftlichen Zusammenhang für Hörde geschaffen.
Bereits bei der Gründung zeigte sich, dass der Verein Aufgaben und Ziele über die Organisation des Brückenfestes hinaus auf seine Fahnen schreiben wird. Und so hat er in den vergangenen Jahren viele weitere – für das Image Hördes förderliche – Aktionen und Aktivitäten durchgeführt, wie die Installation von Bücherschränken, die Initiierung von Kunst- und Kulturprojekten oder auch die Unterstützung von Geflüchteten.
Die große Klammer dabei: Der Verein und die Mitglieder versuchen, Brücken zu bauen: Brücken zwischen den einzelnen Quartieren, Brücken zwischen dem alten und neuen Hörde, Brücken zwischen den Generationen, Brücken zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und sozialem Hintergrund. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kulturelle Vielfalt, die Völkerverständigung, das demokratische Staatswesen und das friedliche Gemeinschaftsleben zu fördern.
Mit bürgerschaftlichem Engagement setzen sich die Mitglieder dafür ein, dass sich die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Rahmenbedingungen für die Hörder*innen sowie das Erscheinungsbild und das Image Hördes nach innen und außen beständig verbessern.
Bildzeile: NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (l.) und Künstlerin Sylvia Liebig.
Foto: Roland Gorecki / Stadt Dortmund

World of Walas und DEW21 schließen
strategische Partnerschaft für Phoenix West
Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) und World of Walas gehen
gemeinsame Wege bei der Entwicklung von Phoenix West. Neben dem Angebot klassischer
Versorgungsleistungen wird DEW21 dabei auch im Sinne eines nachhaltigen Lebensversorgers das
komfortable und nachhaltige Leben in diesem Dortmunder Quartier mitgestalten. So wird die 100-
prozentige DEW21-Tochter “DOdata” als Treiber hinter vielen smartCity Ansätzen der Stadt das
digitale Leben und Wirtschaften auf Phoenix West bereichern. Der holländisch-kanadische
Stadtentwickler World of Walas, der in Hörde nicht nur die Hochofenanlage, das ehemalige
Schalthaus und das westlich vom Hochofen gelegene Baufeld 13 erworben hat, sondern in Kürze
auch die Entwicklung des Gasometers, der Gasgebläsehalle und Pumpenhaus beabsichtigt, geht
mit seinem Nachhaltigkeitsansatz neue Wege in der Urbanisierung alter Industrieareale. Platz
genug, um einerseits die zukünftigen Mieter optimal zu versorgen, aber auch immer wieder
Innovationen zu implementieren und auszuprobieren. Mit der Partnerschaft von DEW21 und
World of Walas wird Phoenix West zu einem Inkubator und Leuchtturm für Innovationen im
Zusammenhang mit Energie, Wasser und Abfall, einschließlich der Digitalisierung städtischer
Systeme.
“Es ist das erste Mal in der DEW21-Geschichte, dass wir so eine strategische Partnerschaft für ein
solches Areal vereinbaren. Wir freuen uns, als Partner dieses zukunftsfähige Projekt zu unterstützen
und unsere Kompetenzen gewinnbringend für die nachhaltige Entwicklung von Phoenix West
einzubringen,” erklärt Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung von DEW21. Gerben van
Straaten, CEO von World of Walas: “Diese Kooperation ist für beide Seiten sehr wertvoll. Walas
sucht nach neuen Wegen, den Nachhaltigkeitsansatz bei unseren Aktivitäten zu verstetigen – und mit
dem “World innovation Centre” durchaus in einem internationalem Umfeld.” Optimale
Energieerzeugung, -verwendung und management in Kooperation mit digitalen Lösungen spielen
dabei eine wichtige Rolle.
Beide Seiten planen innovative Energiesysteme aufzubauen und zu erproben, aber auch
Lösungsansätze zu erarbeiten, um Restwärme aus lokalen Quellen zu nutzen. Ein erster Ansatz der
Zusammenarbeit wird gerade am Walas-Standort im niederländischen Heerlen geprüft. Hierbei geht
es um ein Pilotprojekt, bei dem die Wärme eines Rechenzentrums aufgenommen werden soll, um
diese anschließend in das Heizsystem des Walas-Gebäudes einzuspeisen. Diese Innovation könnte
später auch auf Phoenix West ausgebaut werden.
Die Ansatzpunkte sind vielfältig und beinhalten auch innovative Gebäudehüllen, um die
Energieeffizienz der genutzten Räume zu verbessern und wenn möglich auch mit Photovoltaik
nachhaltig Energie zu erzeugen. Ein wesentlicher Hebel für eine optimierte Energiesteuerung ist der
Einsatz von Sensoren und intelligenten Steuerungssystemen. Hier kommt die DEW21-Tochter
DOdata ins Spiel. “SmartCity-Lösungen sind in aller Munde. Hier können wir ganz konkret die Einsatzmöglichkeiten testen, weiterentwickeln und zeigen, welchen konkreten Mehrwert Daten- und
IoT-Anwendungen bieten können,” so Heike Heim.
Interessant ist hier unter anderem die Entwicklung des AgroTech Centres in der ehemaligen
Gasgebläsehalle. In diesem Zentrum, das auch Gewächshauselemente beinhaltet, muss intelligent
und optimiert Energie, Wasser und Wärme eingesetzt und gesteuert werden. “Diese konkreten
Anforderungen auf das gesamte Areal zu skalieren und hierfür ein ganzheitlich kombiniertes Energieund
Wärmemanagementsystem zu entwicken, ist ein völlig neuer Ansatz,” berichtet van Straaten.
Mit der Partnerschaft von DEW21 und World of Walas wird Phoenix West Zug um Zug zu einem
einzigartigen Entwicklungs- und Testareal für urbane Systme im XXL-Format. Lösungen, die hier
entwickelt werden, können dann auf andere Standorte übertragen werden.
Bildzeile: v.l. Dirk van der Ven, Chief Innovation Officer World of Walas / Pascal Ledune, Chief Economic Development Officer World of Walas /
Gerben van Straaten, CEO World of Walas / Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung DEW21 / Sven Baumgarte, Leiter Strategie &
Transformation DEW21 / Dominik Gertenbach, Leiter Vertrieb DEW21)
Foto: DEW21

Fünf erfolgreiche Jahrzehnte im Lüner Elektrohandwerk
Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen gratuliert Dirk Meyer & Paul Overmann GbR in Lünen zum 50-jährigen Bestehen / Ehrenurkunde der Handwerkskammer Dortmund überreicht
Auf 50 erfolgreiche Jahre im Elektrohandwerk kann die Dirk Meyer & Paul Overmann GbR aus Lünen-Alstedde zurückschauen. Anlässlich des Jubiläums waren Obermeister Volker Conradi und Geschäftsführer Joachim Susewind von der Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen nach Alstedde gekommen und gratulierten im Namen aller Innungsbetriebe sehr herzlich. „Ein Unternehmen 50 Jahre am Markt zu halten heißt, 50 Jahre lang täglich auf hohe Qualität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu achten“, so Obermeister Conradi. „Wer es dann noch schafft, alle Innovationen und technischen Trends handwerklich perfekt umzusetzen, der hat wirklich ein großes Lob verdient. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem außergewöhnlichen Jubiläum!“
Zur Gründung boomt die Elektro-Heizung
Die Dirk Meyer & Paul Overmann GbR war im März 1971 von Paul Overmann und Norbert Meyer, dem Vater des heutigen Mitgesellschafters Dirk Meyer, gegründet worden. Beide waren Arbeitskollegen in Lünen gewesen, hatten dann beschlossen, sich selbstständig zu machen und ihre Prüfung als Elektroinstallateurmeister vor der Handwerkskammer Oldenburg abgelegt. Die ersten Jahre des Unternehmens waren geprägt von der Ölkrise und dem Trend zur elektrischen Heizung. Rund 5.000 Elektro-Nachtspeicher installierten sie in den ersten Jahren des Betriebs. Als der Boom nachließ, erweiterten sie konsequent ihren Arbeitsbereich und übernahmen neben Aufträgen für Privatpersonen auch das große Spektrum der betrieblichen Elektroinstallation.
In zweiter Generation in die Digitalisierung
Im Jahr 2006 übernahm dann Sohn Dirk Meyer die Nachfolge seines Vaters im Unternehmen. Der Elektrotechnikermeister baute den Bereich der betrieblichen Elektroinstallation aus. Gleichzeitig erweiterte er das Spektrum der Arbeiten in den Bereich der Digitalisierung bis zur heutigen Installation von komplexen programmierbaren Smart Home Systemen zum Beispiel auf Basis des KNX-Standards. Trotzdem blieb man der handwerklichen Basis verbunden und erledigt bis heute ein breites Spektrum an Installations- und Wartungsarbeiten. Treu geblieben ist das Unternehmen mit derzeit vier Beschäftigten auch seinem Standort in der Straße “Am Fuchsbach” in Alstedde. Traditionell stellt sich der Betrieb darüber hinaus auch seiner Verantwortung für den beruflichen Nachwuchs. Jedes Jahr wurde von Anfang an ausgebildet – bis heute über 50 Auszubildende.
Bildzeile: Gratulation zum Jubiläum: (v.l.) Obermeister Volker Conradi, Firmengründer Paul Overmann und Norbert Meyer mit Frau Eugenie Meyer, Sohn Dirk Meyer mit Lebensgefährtin Marina Börste und Innungsgeschäftsführer Joachim Susewind.
Foto: Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen

Ein Jahrhundert erfolgreich im Sanitär- und Elektrohandwerk
Traditionsunternehmen Dahlhaus besteht seit 100 Jahren in Lünen / Obermeister und Geschäftsführer der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen gratulieren zum Jubiläum
Ein außergewöhnliches Jubiläum konnte jetzt die Firma Dahlhaus Inh. Dipl.-Ing. Jürgen Krause e.K in Lünen feiern. Das Unternehmen, das sich auf Sanitärinstallation, Heizungs- und Elektroinstallation spezialisiert hat, wurde 100 Jahre alt. Zwar konnte aufgrund der Corona Pandemie nicht groß gefeiert werden, aber Obermeister Ralf Marx und Geschäftsführer Joachim Susewind von der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen ließen es sich nicht nehmen, nach Lünen-Süd zu kommen und dem Inhaber Jürgen Krause persönlich zu gratulieren. „Ein Unternehmen, das eine so lange Tradition hat, ist ein gutes Beispiel dafür, dass unser Handwerk goldenen Boden hat“, erklärte Obermeister Ralf Marx bei der Übergabe der Ehrenurkunde der Handwerkskammer. „Wir wünschen Ihnen im Namen aller Innungsunternehmen weiterhin viel Erfolg in unserem gemeinsamen Handwerk.”
Schritt für Schritt aufgebaut
Das Unternehmen Dahlhaus war nach dem Ersten Weltkrieg, am 15. März 1921, als Klempnerei von Karl Dahlhaus in Lünen gegründet worden. Bereits 1936 erwarb der Unternehmer nach erfolgreichen Gründungsjahren ein Grundstück an der Jägerstraße 37, auf dem die Gebäude des Betriebs noch heute stehen. Mit dem Elektroinstallateurmeister Friedhelm Krause, der 1954 die Tochter von Karl Dahlhaus heiratete, kam dann neben dem Sanitärhandwerk auch das Elektrohandwerk in den Betrieb. Um beides fachgerecht ausführen zu können, legte Friedhelm Krause 1963 zusätzlich die Meisterprüfung als Gas- und Wasserinstallateur ab. 1970 wurde er persönlich haftender Gesellschafter der Firma. Sein ältester Sohn Jürgen erlernte den Beruf eines Zentralheizungs- und Lüftungsbauers, machte seinen Diplom Ingenieur an der Fachhochschule für Versorgungstechnik und ist heute Firmeninhaber.
Ausbildung großgeschrieben
Schwerpunkte des Unternehmens sind heute alle Arbeiten im Bereich Sanitär, Heizung und Elektro von der Wartung und Reparatur bis zum Tausch kompletter Heizungsanlagen. Besonderen Wert legte das Unternehmen im Lauf seiner Geschichte stets auf die Ausbildung des beruflichen Nachwuchses. Mehr als 100 junge Menschen fanden im Unternehmen Dahlhaus den Weg in eine gesicherte Zukunft im Handwerk. Auch die Mitgliedschaft in der Innung war für das Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Sowohl Senior Friedhelm Krause als auch Sohn Jürgen Krause waren über lange Jahre hinweg ehrenamtlich im Vorstand tätig, hatten und haben bis heute das Amt des Lehrlingswartes inne. Jürgen Krause ist darüber hinaus im Berufsbildungsausschuss des Fachverbands Sanitär Heizung Klima NRW und im Prüfungsausschuss der Innung.
Innung ist starker Verbund
Die Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen ist ein starker Verbund aus Handwerksunternehmen der Region. Sie vertritt die Mitgliedsbetriebe in wichtigen regionalen und überregionalen Gremien und verleiht ihrer Stimme gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch Gewicht. Den Betrieben bietet die Innung als Dienstleister einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Sie kümmert sich um Aus- und Weiterbildung, aber auch um juristische Unterstützung, günstige Versicherungsleistungen und aktuelle Informationen zur Betriebsführung.
Bildzeile: Obermeister Ralf Marx von der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen (r.) gratuliert Dipl.-Ing. Jürgen Krause herzlich zum 100-jährigen Firmenjubiläum.
Foto: Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen

Berufsförderungswerk Dortmund als eines der besten 100 mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet
Innovatives Digitalisierungskonzept für die berufliche Rehabilitation
Die mittlerweile über ein Jahr andauernde Corona-Pandemie hat dem Digitalisierungskonzept des Berufsförderungswerks (BFW) Dortmund einen großen Innovationsschub verliehen. Bereits während des ersten Lockdowns digitalisierte die Bildungseinrichtung innerhalb weniger Tage den kompletten Unterrichtsbetrieb. Dieser konnte ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Bestätigt durch die positiven Erfahrungen entwickelte das BFW Dortmund ein für die berufliche Rehabilitation zukunftsweisendes Konzept. Klassischer Unterricht „vor Ort“ wird flexibel und zielgerichtet mit digitalem Lernen kombiniert. Für diese Leistungen wurde die Bildungseinrichtung beim deutschlandweiten Innovationswettbewerb TOP 100 als eines der besten hundert mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet: Die Fachjury würdigte das BFW Dortmund mit dem Siegel TOP-Innovator 2021.
„Mit dem neuen Konzept leisten wir für unsere Branche wichtige Pionierarbeit. Die berufliche Rehabilitation ist heute mehr denn je gefordert, dem technologischen Wandel und der digitalen Transformation in der Arbeitswelt mit neuen Lösungen zu begegnen. Nur so können auch Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, langfristig faire Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten”, erklärt Dr. Christian Vogel, Direktor des BFW Dortmund, und fügt hinzu: „Beim diesjährigen Wettbewerb konnte unser Haus in einem unabhängigen, wissenschaftlichen Prüfverfahren durch seine Innovationskraft punkten. Diese erfreuliche Auszeichnung auf bundesweiter Ebene bestärkt uns. Ein weiterer Beleg, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, sind die erfolgreichen Ergebnisse der aktuellen IHK-Prüfungen unserer Teilnehmenden.“
Das BFW Dortmund, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, qualifiziert Menschen, die ihren alten Beruf nach einer Krankheit oder einem Unfall nicht mehr ausüben können. Mit großem Erfolg: Die Vermittlungsquote der Absolventen in den ersten Arbeitsmarkt liegt seit Jahren bei mehr als 80 Prozent. Dabei besitzt die Bildungseinrichtung unter allen 28 Berufsförderungswerken in Deutschland eine besondere „Strahlkraft“: Rund ein Drittel der 1.000 Teilnehmenden zieht es aus anderen Regionen Deutschlands ins östliche Ruhrgebiet. „Bei uns finden Rehabilitanden zum Teil einzigartige Angebote, die es nur hier in Dortmund gibt. Viele der Qualifizierungen besitzen in der Wirtschaft derart hohe Anerkennung, dass unsere Absolventen direkt übernommen werden“, so Dr. Christian Vogel. Auf nahezu konkurrenzlos hohem Niveau werden zum Beispiel Fachinformatiker, Werkstoffprüfer oder Fachkräfte in CNC- und kaufmännischen Bereichen ausgebildet.
Das neue digitalisierte Angebot des BFW Dortmund ermöglicht den Rehabilitanden, einzelne Phasen ihrer beruflichen Qualifizierung „online“ von zuhause aus zu verfolgen. „Dies erleichtert gerade denjenigen die Teilnahme, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Der wesentliche Vorteil der neu geschaffenen hybriden Lernmodelle besteht in der individuellen Förderung durch einen optimalen Mix von Online- und Präsenz-Unterricht“, betont Dr. Christian Vogel. Je nach Berufsbild werden virtuelle und „reale“ Formate so kombiniert, dass die Ausbilder intensiver auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der Teilnehmenden eingehen können. Überdies würden Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien vermittelt, die in der Arbeitswelt mittlerweile unverzichtbar sind. Ebenso erweitern zusätzliche Online-Services die eigenen psychologischen und medizinischen Angebote.
„Digitalisierung ist auch ein Zeichen von zielorientiertem Management. Dies zeigt sich insbesondere in dem hohen Grad an innovativen Prozessen und der Organisation“, betont der Verwaltungsleiter und stellvertretende Direktor Jürgen Schonhoff. Das BFW Dortmund verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen in diesem Feld: Seit Jahren bietet die Bildungseinrichtung rechnergestützte Lehrgänge an, schult in einer breiten Palette von IT-Berufen und bindet digitale Komponenten in den Betrieb der eigenen Ausbildungswerkstatt ein. „Allerdings haben wir jetzt unsere wichtigsten Kompetenzen zu einem übergreifenden Konzept gebündelt und erweitert“, erklärt Christian Vogel. Ein neuer Service sind zum Beispiel virtuelle Sprechstunden mit BFW-Experten über ein eigenes digitales Studio. Zukünftig werde noch stärker in den IT-Bereich investiert.
www.bfw-dortmund.de
Bildzeile: BFW-Direktor Dr. Christian Vogel vertraut auf den Einsatz modernster Technik, um chronisch erkrankte Menschen für einen beruflichen Neustart fit zu machen.
Foto: BFW Dortmund / Stephan Schütze

Vonovia: Zwölf neue Wohnungen im Kreuzviertel
Nachhaltige Quartiersentwicklung im Kreuzviertel
Grüner Charakter des Quartiers bleibt erhalten
Fertigstellung bis Anfang 2022
In einem der beliebtesten Stadtteile von Dortmund entsteht zurzeit neuer Wohnraum: Vonovia errichtet in den kommenden 17 Monaten an der Metzer Straße im Kreuzviertel einen Neubau mit zwölf barrierefreien Wohnungen sowie Pkw- und Fahrradstellplätzen. Die Investitionen liegen bei rund 3,2 Millionen Euro.
Die 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen sind zwischen 60 und 125 Quadratmeter groß und verfügen alle über Terrassen oder Balkone. Die Badezimmer sind mit barrierefreien Duschen und zusätzlich mit Badewannen ausgestattet, ein Aufzug sorgt für einen barrierefreien Zugang zu den Wohnungen. Das Gebäude erhält eine Holzpelletheizung, die CO2-neutral arbeitet und in die Energieeffizienzklasse A+ eingruppiert ist. Ergänzend wird eine Photovoltaikanlage eingebaut.
„Bei unserer Planung haben wir auch die modernen Mobilitätslösungen berücksichtigt“, erläutert Ralf Peterhülseweh, als Regionalbereichsleiter von Vonovia zuständig für die 20.000 Wohnungen in Dortmund. „Beispielsweise wird ein von außen zugänglicher Fahrradraum errichtet, in dem Fahrräder sicher abgestellt und aufgeladen werden können. Auch eine Ladesäule für E-Autos ist vorgesehen, die neuen Garagen werden zudem für einen Anschluss vorbereitet.
Für den Neubau im Kreuzviertel wird nur ein Teil der vorhandenen großzügigen Grünfläche benötigt. Der größere Teil wird als Grünfläche erhalten bleiben. „Ein ganzheitliches Quartierskonzept stellt sicher, dass der grüne Charakter des Quartiers erhalten bleibt“, so Peterhülseweh. Zur Gestaltung der Außenanlagen und auch der Spielplätze konnten die Anwohner Vorschläge machen.
„Uns ist es wichtig bei Neubauvorhaben, die Anwohner und Mieter mit einzubeziehen und auch deren Wünsche nach Möglichkeit einfließen zu lassen“, unterstreicht Peterhülseweh.
Der Mietpreis wird bei durchschnittlich 12 Euro pro Quadratmeter liegen, die Vermarktung beginnt voraussichtlich im kommenden Januar.
Bildzeile: Vonovia baut zwölf neue Wohnungen im Kreuzviertel in Dortmund.
Grafik: Vonovia

Eine Tüte Buntes vom Jugendamt: Kostenloses Kindermagazin erschienen – zum Lesen, Entdecken, Mitmachen
Ausflugstipps, Rätsel und Rezepte, Bastelideen oder Tiergeschichten: Mit einer kunterbunten Mischung gegen die Langeweile daheim wendet sich das neue Kindermagazin „JU-CLUB“ an Dortmunder Grundschulkinder. Lesen, Mitmachen, Entdecken und Spaß haben ist das Motto des 16-seitigen Hefts, das kostenlos verteilt wird, aber auch bestellt oder heruntergeladen werden kann. Noch in diesem Jahr sollen drei weitere Ausgaben folgen. Mit dem neuen Angebot will die Kinder- und Jugendförderung des Dortmunder Jugendamts auch auf diesem Wege im Lockdown für Kinder, Jugendliche und deren Familien da sein.
Zum Heft im A4-Format gehören Rubriken wie „Der Bücherwurm stellt vor“, „Ups – das gibt’s doch gar nicht“ oder ein Ausmalposter im A3-Format mit Dortmunder Sehenswürdigkeiten. Für Eltern bietet das Magazin eine Seite mit Kontakten und Hilfen sowie dem digitalen Elterntreff. Durch die Zeitschrift begleiten „Leo & Lou“, die Maskottchen der Kinder- und Jugendförderung.
An den nächsten Ausgaben können sich Kinder gern beteiligen: Das Redaktionsteam freut sich über Anregungen und Ideen!
Noch mehr Angebote, Anregungen und Unterstützung gibt es u.a. in den Jugendfreizeiteinrichtungen in Dortmund, die ebenfalls im Heft vorgestellt werden.
Wo gibt es „JU-CLUB“?
Zum Download: Ju-club.dortmund.de
Auf dem Postweg: kostenlos anfordern unter jugendfoerderung@stadtdo.de
Abholen: in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen (bitte vorher einen Termin vereinbaren; Telefonnummern unter Jugendfreizeit.dortmund.de.
Bildzeile: Jugendamt-Redaktionsteam um (v.li.) Oliver Gernhardt, Ralf Finke, Jugendamtsleiterin Dr. Annette Frenzke-Kulbach und Johanna Stöckler.
Foto: Roland Gorecki / Dortmund Agentur

Neue Mitarbeiterin im Katholischen Forum
Thale Schmitz studierte Theologie und Niederländisch
Thale Schmitz freut sich schon auf ihre erste Fahrt mit der Rikscha, jenem Gefährt, mit dem das Katholische Forum Dortmund Passanten zur Mitfahrt und zum Gespräch einlädt. Die 26jährige Theologin ist neue Mitarbeiterin im Hauptamtlichen-Team des citypastoralen Angebots in Dortmund.
Radfahren ist neben Laufen eins ihrer Hobbys. Kein Wunder, denn die Zeit ihres Studiums mit den Fächern Katholische Theologie und Niederländisch verbrachte sie in der Fahrradstadt Münster. Aufgewachsen ist Thale Schmitz mit zwei Geschwistern im niederrheinischen Wesel. Nach dem Abitur verbrachte sie ein Jahr im flämischen Leuven, wo sie auch ihre Leidenschaft für die niederländische Sprache entdeckte. Nach einer Ausbildung im Rettungsdienst merkte sie, dass sie auch gerne in der Seelsorge und religionspädagogisch arbeiten wollte.
Musikalisch
Als nach dem Wechsel von Pastoralreferentin Karin Stump ins Bistum Limburg eine Stelle im Katholischen Forum ausgeschrieben war, hatte Thale Schmitz sofort großes Interesse. Die Offenheit und Vielseitigkeit, die Arbeit für und mit den Lebensfragen der Menschen hätten sie sehr angesprochen.
Hinzu kam, dass das Katholische Forum in seinem Angebot vermehrt auch musikalische Akzente setzt, wie zuletzt mit Musikexerzitien. „Da steige ich gerne ein“, sagt Thale Schmitz, die Klavier und Gitarre spielt und derzeit noch Cello lernt.
Im Katholischen Forum arbeitet sie mit einer vollen Stelle im Hauptamtlichen-Team zusammen mit Pastor Stefan Tausch, Stefan Kaiser und Kathrin Glanemann (Sekretariat). Erreichbar ist Thale Schmitz dort unter Tel (0231) 1848-113 und E-mail thale.schmitz@katholisches-forum-dortmund.de.
Bildzeile: Thale Schmitz ist neue Mitarbeiterin im Hauptamtlichen-Team des Katholischen Forums in Dortmund. Demnächst wird sie unter anderem mit der Rikscha unterwegs sein, mit der das Katholische Forum Passanten zur Mitfahrt einlädt.
Foto: Michael Bodin / Kath. Stadtkirche Dortmund

Seit 80 Jahren beste Qualität bei Fahrzeuglackierungen
Fachverband Lack- und Karosserietechnik Westfalen gratuliert Autolackiererei Wirtz OHG in Hamm zum Betriebsjubiläum / Familienunternehmen steht in der dritten Generation für großes fachliches Können
Besuch vom Fachverband Lack- und Karosserietechnik Westfalen konnte jetzt die Autolackiererei Wirtz OHG in Hamm begrüßen. Anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Unternehmens waren der Verbandsvorsitzende Heinz-Bernd Raue und Geschäftsführer Volker Walters in die Lange Straße gekommen und gratulierten im Namen aller Verbandsmitglieder sehr herzlich zum Jubiläum. „Sie haben es geschafft, mit Ihrem Betrieb alle Höhen und Tiefen in acht Jahrzehnten zu meistern“, so Heinz-Bernd Raue in seiner Laudatio. „Nicht nur wirtschaftliche und technische Herausforderungen haben sie mit Bravour geschafft, sondern gleichzeitig mit der hohen Qualität ihrer Arbeit viele Kunden überzeugt. Dafür spreche ich Ihnen die ganze Anerkennung unseres Handwerks aus.“
Von Wanne-Eickel nach Hamm
Die Autolackiererei Wirtz war 1941 von Heinrich Wirtz ursprünglich in Wanne-Eickel gegründet worden. Der Maler- und Lackierermeister, Großvater des heutigen Betriebsinhabers Nicolas Wirtz, baute trotz aller Schwierigkeiten in den Kriegsjahren sein Unternehmen solide auf und hatte mit dem zunehmenden Autoverkehr eine wachsende Kundschaft. Die Liebe zu seiner Frau zog ihn 1946 nach Hamm, wo er seine Autolackiererei nach dem Krieg neu eröffnete. Dank ständig wachsender Kundschaft und steigender Auftragszahlen wurden die Räumlichkeiten an der Wilhelmstraße jedoch mit den Jahren zu klein. 1970 ergriff Heinrich Wirtz darum die Initiative und zog mit dem Betrieb in einem Neubau ins Gewerbegebiet Hamm-Westen an die Lange Straße 295, wo heute noch der Unternehmenssitz ist.
Sohn und Enkel übernehmen Betriebsführung
1980 übernahm dann sein Sohn Jürgen Wirtz, ebenfalls Maler- und Lackierermeister, die Firmengeschäfte. Er baute den Betrieb weiter aus, führte ihn in die Digitalisierung und setzte mit der Lackiererei von Lkw ein besonderen Arbeitsschwerpunkt. Im Jahr 2001 trat dann Enkel Nicolas Wirtz in die Geschäftsführung ein. Seit mittlerweile drei Jahren hat er nun die Firmengeschäfte ganz übernommen und führt sie zusammen mit seiner Ehefrau Claudia Wirtz. Einer der Schwerpunkte des Unternehmens sind nach wie vor Lackierarbeiten bei Unfallreparaturen, aber auch Komplettlackierungen von Fahrzeugen. Auftraggeber sind sowohl Automobilhäuser und -werkstätten als auch Privatkunden. Rund 2.500 Quadratmeter umfasst der Hallenbereich des Betriebs heute – fast zehnmal mehr als zu Zeiten des Firmengründers. Genug Platz auch für Lkw- und Nutzfahrzeug-Lackierungen, die seit 2000 zum Spezialgebiet des Unternehmens gehören.
Rund 150 Lehrlinge ausgebildet
Zuverlässigkeit zählt seit jeher zu den großen Anliegen der Autolackiererei Wirtz. Das wissen die Kunden bis heute zu schätzen. Einige von ihnen sind dem Unternehmen bereits seit 70 Jahren treu. Und auch die Mitarbeiterschaft besteht aus langjährigen erfahrenen Fachkräften. In jüngster Vergangenheit konnten einige von ihnen sogar ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Insgesamt 14 Beschäftigte hat das Unternehmen heute, darunter drei Auszubildende. Die meisten der Gesellen haben den Beruf direkt im Betrieb erlernt. Denn Ausbildung des eigenen Berufsnachwuchses war in all den Jahren immer ein großes Anliegen des Familienunternehmens. Rund 150 junge Menschen haben in den Jahren seines Bestehens eine Lehre absolviert.
Bildzeile: Gratulation zum Jubiläum: Verbandsvorsitzender Heinz-Bernd Raue, Geschäftsführer Nicolas Wirtz mit Ehefrau Claudia Wirtz und Vater Jürgen Wirtz, sowie Volker Walters, Geschäftsführer des Fachverbands Lack- und Karosserietechnik Westfalen.
Foto: Fachverband Lack- und Karosserietechnik Westfalen

Politik ist käuflich
Klare, verbindliche Regeln und der weltbeste Politikkodex
Ehrenerklärung von Marco Bülow und Martin Sonneborn von DIE PARTEI
Korruption, Machtmissbrauch und einseitiger Profitlobbyismus sind zu einem Teil des politischen Betriebs geworden. Die letzten Skandale sind keine Einzelfälle. Es geht auch nicht nur um die Union.
Die Übergänge zwischen Profitlobbyismus, Machtmissbrauch, Einflussnahme und
Korruption sind fließend – und das seit vielen Jahren. Keine Bundestagspartei hat
wirklich etwas dagegen unternommen. Im Gegenteil: Sie haben diese Entwicklung größtenteils ignoriert, unterstützt oder sogar ausgenutzt. Halbherzige Lobbyregister und absurde Ehrenerklärungen dienen der Gewissensberuhigung, ändern aber nichts am System. Die PARTEI macht dagegen Ernst ☺
Vorlage ist der weltbeste Politikkodex der Plattform.PRO, der als einziger wirkliche Maßstäbe setzt und den die Abgeordneten Marco Bülow und Martin
Sonneborn heute unterzeichnet haben. Die PARTEI wird folgen. Und alle anderen können nun beweisen, was ihre schönen Worte wert sind.
Für den Verein Plattform.PRO stellt Sabrina Hofmann den Kodex vor:
„Der Politikkodex ist umfassend, weitgreifend und vor allem wirksam. Wir fordern alle Mandatsträger:innen und Parteien dazu auf, ihren
Lippenbekenntnissen Taten folgen zu lassen und sich an unserem Kodex zu orientieren.“
Bundestagsabgeordneter der PARTEI, Marco Bülow, betont:
„Wenn wir den Vertrauensbruch endlich stoppen wollen, brauchen wir wirksame Regeln. Dazu gehören der Kodex, Einschränkungen und volle Transparenz bei Parteispenden (Sponsoring) und Nebentätigkeiten, Lobby- und Transparenzbeauftrage im Bundestag und Regierung und den legislativen Fußabdruck in Gesetzen. Wir dürfen als Abgeordnete zudem nicht unsere eigenen Regeln bestimmen. Dafür muss eine Bürger:innenversammlung einberufen werden. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Profitlobbyismus
endlich zerstört werden muss.“
Martin Sonneborn, Vorsitzender für DIE PARTEI, kündigt an:
„Die Lobbygesetze in Deutschland sind super, noch viel weniger effektiv als in Brüssel. Ich habe mich deshalb entschlossen, zurückzukommen und im
September für den Bundestag zu kandidieren. “
Die ganze Kundgebung können Sie sich hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=-d3rFSPV4wA
Informationen zum Verein plattform.PRO: www.plattform.pro
Bildzeile: Marco Bülow (l.) und Martin Sonneborn bei der Unterzeichnung.
Foto: DIE PARTEI

Mit dem Lastenrad unterwegs: Aufsuchende Sozialarbeit in Hörde wird noch mobiler
Unter dem Namen „Rampe \“ leisten das Jugendamt der Stadt Dortmund in Kooperation mit der AWO Dortmund und dem DJK Sportverband / Diözesanverband Paderborn rund um den Hörder Bahnhof aufsuchende Sozialarbeit. Und die wird nun noch mobiler: Aus Mitteln der Bezirksvertretung Hörde ist das Rampe-Team ab sofort mit einem Lastenrad unterwegs, gut erkennbar an dem Aufdruck „MAHJA“ (Mobile aufsuchende Hörder Jugendarbeit).
Das Lastenrad kann bis zu 300 Kilogramm (inklusive Fahrer) transportieren und bietet auf seiner Ladefläche (162 x 114 cm) ausreichend Platz, um Sport- und Spielmaterialien oder Technik mitzuführen. Zudem sind alle Inhalte in der Transportbox wetterfest verstaut und sicher geschützt. Ein weiteres einfaches Fahrrad soll den „Fuhrpark“ künftig ergänzen.
Wozu dient das Lastenrad?
Sport im Freien: Mit dem Rad kann das Rampe-Team Sport- und Freizeitangebote transportieren und im öffentlichen Raum anbieten. Basketballkorb und Bälle für verschiedene Sportarten sowie Geräte für den Kraft- und Ausdauersport oder fürs Zirkeltraining wurden bereits angeschafft.
Kunst und Kultur: Das Lastenrad bringt Kunst und Kreativangebote an die Treffpunkte der Jugendlichen, z.B. ein mobiles Tonstudio mit Laptop und Mikrofon. Mit einem Beamer kann ein „Outdoor-Kino“ betrieben werden. Auch Graffiti-Projekte oder das Malen auf Leinwänden im Freien sind geplant.
Präsenz im öffentlichen Raum: Das folierte Lastenrades fällt im Stadtraum auf und sorgt dafür, dass das Team der Rampe \ gut zu erkennen ist. Dadurch soll Jugendlichen das Ansprechen erleichtert werden. Ins Lastenrad passen sogar Stühle, so dass beratende Gespräche im Freien demnächst komfortabler gestaltet werden können.
Auf diese Weise trägt das Lastenrad dazu bei, die Beziehung zwischen dem Team und den Jugendlichen zu tärken und Vertrauen aufzubauen – denn Ziel der Sozialarbeit ist es, dass die Jugendlichen sich mit ihren Sorgen, Ängsten und Problemen an die Mitarbeiter*innen wenden und auf diese Weise schnell Hilfe erhalten können.
Bildzeile: v.l. Jörg Loose (Bereichsleiter Jugend der AWO), Jugendamtsleiterin Dr. Annette Frenzke-Kulbach, Johann Zenses (Team Aufsuchende Arbeit), Harald Landskröner (Jugendamt, stellv. Bereichsleitung Kinder- und Jugendförderung), Hans Peter Esch (Geschäftsführer des DJK) und Lena Terstegge (Team Aufsuchende Arbeit).
Foto:: Katharina Kavermann, Stadt Dortmund.

Ende März wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Tierrettungseinsatz in die Straße Tremoniabogen in der südlichen Innenstadt gerufen. Die Bewohnerin der Dachgeschoßwohnung wollte die Regenrinne ihrer Dachterrasse säubern, da diese mit kleinen Zweigen und Tannennadeln gefüllt war. Im Bereich des Fallrohres bemerkte Sie aber Geräusche und schaute vorsichtig in den Wasserfangkasten des Fallrohres.
Hier lagen noch viel mehr von den kleine Äste und weiteres feines Nistmaterial drin. Da bei einem Regenschauer hier aber kein Wasser mehr abfließen kann, versuchte Sie diese Äste zu entfernen. Sie bemerkte aber direkt, dass sich die Ästchen bewegten. Schnell war ihr klar, das sich hier Tiere eingenistet haben müssen. Da Sie aber selber nicht an den Wasserfangkasten kam, um die Tiere samt Nest daraus zu befreien, bat sie die Brandschützer um Hilfe.
Diese stellten eine Leiter an die Hauswand, kletterten zu dem Wasserfangkasten und demontierten diesen. Die untere Öffnung wurde verschlossen damit nichts heraus fallen kann. Auf der Terrasse wurde dann das ganze Nistmaterial aus dem Kasten entfernt und die beiden Eichhörnchen-Babys kamen zum Vorschein. Sie wurden vorübergehend samt Nistmaterial in einem Holzkasten gelegt und später von der Bewohnerin an die Tierschutzorganisation Arche90 übergeben.
Bildzeile: Die Eichhörnchen-Babys wurden aus dem Wasserfangkasten gerettet.
Foto: Feuerwehr Dortmund

Digitale Innovationsplattform bringt Handwerksbetriebe zusammen
HSHL hat Lastenheft an HWK-Präsident Schröder übergeben
Handwerker sind innovativ. Das zeigen nicht zuletzt die digitalen Strategien, mit denen sie der Corona-Krise entgegentreten. Um neue Ideen zu fördern und Handwerksunternehmen untereinander zu vernetzen, entwickelte die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) im Auftrag der Handwerkskammer (HWK) Dortmund eine webbasierte „Innovationsplattform für das Handwerk“. Jetzt trafen sich die Projektverantwortlichen zur offiziellen Übergabe des 300-seitigen Lastenheftes.
„Der digitale Wandel bietet Handwerksunternehmern vielfältige Möglichkeiten, innovative Ideen umzusetzen und sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Innovationsplattform ist hierfür ein wertvolles Werkzeug, da sie die Möglichkeit schafft, sich mit anderen Betriebsinhabern zu vernetzen und gemeinsam an kreativen Lösungen zu arbeiten“, sagt Berthold Schröder, Präsident der HWK Dortmund. „Es wäre sicherlich eine Bereicherung für die digitale Transformation des Handwerks in NRW, wenn die Arbeitsergebnisse der Hochschule Hamm-Lippstadt in einem nächsten Schritt umgesetzt werden könnten.“
Die HSHL hat die konzeptionelle und inhaltliche Erstellung der Innovationsplattform für das Handwerk im Rahmen des Gesamtprojekts handwerk-digital.nrw übernommen. Den Auftrag dazu erhielt die Hochschule von der HWK Dortmund als einer von vier Projektpartnern – neben der HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld sowie den Fachverbänden Tischler NRW und Metall NRW.
In einem ersten Schritt wurden die Bedarfe der Handwerksbetriebe analysiert, um daran anknüpfend visuelle Module und Funktionen zu entwickeln. Neben der Durchführung von Experteninterviews wurde für die Testphase ein Online-Fragebogen entwickelt, um die Akzeptanz der Nutzer abzustecken. Das daraus entstandene Lastenheft überreichte der Leiter des Forschungsprojekts an der HSHL, Prof. Dr. Heiko Kopf, an HWK-Präsident Berthold Schröder.
Die Innovationsplattform soll den branchenübergreifenden Austausch von spezialisiertem Know-how (zum Beispiel aus der IT und dem Handwerk) ermöglichen. „Der digitale Wandel stellt unsere Gesellschaft und Wirtschaft vor besondere Herausforderungen. Unternehmen haben keine andere Möglichkeit, als sich individuell mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen, wenn sie auch zukünftig am Markt bestehen wollen. Das gemeinsame Projekt ‚Innovationsplattform für das Handwerk‘ kann hierbei den Handwerksunternehmen neue Wege des Ideen- und Innovationsmanagements eröffnen, mit Hilfe derer die digitale Transformation gelingen kann“, sagt Kopf. „Daher hoffen wir, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der HWK Dortmund nun in die nächste Phase zu überführen, um den Unternehmen neue Möglichkeiten der eigenen Zukunftsgestaltung anbieten zu können.“
Das Arbeitspaket der HSHL ist Teil von vier Handlungsschwerpunkten und wird wie das Gesamtprojekt handwerk-digital.nrw vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Wirtschaft, Digitalisierung, Innovation und Energie über einen Zeitraum von 36 Monaten gefördert.
Bildzeile: v.l. Christof Wenglorz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der HSHL, Prof. Dr. Heiko Kopf (Projektleiter HSHL), HWK-Präsident Berthold Schröder und Carsten Harder, Hauptgeschäftsführer der HWK Dortmund.
Foto: HWK Dortmund

Besser heizen ohne fossile Brennstoffe
Verbraucherzentrale NRW berät bei Planung einer neuen Heizanlage
Vom Keller aus jagt der Heiz-Dino jährlich
fässerweise Öl durch den Schornstein? Realität in gut einem Viertel der NRW-Haushalte, die noch auf den fossilen Brennstoff setzen. Noch mehr, nämlich rund 55 Prozent, heizen mit Gas. Zahlreiche Gründe sprechen dafür, sich jetzt mit dem Einbau von moderner
Heiztechnologie zu beschäftigen: eine zehnprozentige Teuerung von Öl und Gas, das Aus per Gesetz für veraltete Technik und gleichzeitig
attraktive Fördermöglichkeiten für die Modernisierung. Um Haus- und
Wohnungseigentümer beim Wechsel zu klimafreundlicheren Technologien zu unterstützen, bietet die Verbraucherzentrale NRW ab sofort mit ihrer Aktion „Besser Heizen“ ein breites Informations- und Beratungsangebot.
Wichtig: sorgfältige Planung des Heizungstausches
19 Jahre – das ist das durchschnittliche Alter der rund eine Millionen
Ölkessel in Nordrhein-Westfalen. Als eine Maßnahme zur Erfüllung
der Klimaziele sieht der Gesetzgeber vor, dass betagte Geräte ersetzt
werden sollen. Schon jetzt kennzeichnet der Schornsteinfeger Systeme, die älter als 15 Jahre sind, mit einem Energielabel als ineffizient. Ab 2026 ist der Einbau reiner Ölheizungen überhaupt nicht mehr erlaubt. Für Eigentümer eines alten Ölbrenners stellt sich nun die Frage nach der Alternative. „Jetzt ist genau der richtige Moment mit noch
ausreichend Zeit, um sich in Ruhe über die individuell beste Heizmethode für die Zukunft Gedanken zu machen. Es gibt einige technisch ausgereifte und erprobte Lösungen mit nachhaltigen Energiequellen wie Sonne, Erdwärme oder erneuerbaren Brennstoffen“, erklärt der
Beratungsstellenleiter Rafael Lech. „Wichtig beim Austausch der
Technik ist eine sorgfältige Planung. Neben der Energiequelle beeinflussen nämlich zahlreiche Faktoren, wie zum Beispiel die Wärmedämmung des Hauses, die Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz des
Systems.“
Fördermöglichkeiten so günstig wie nie
Das Heizen mit fossilen Brennstoffen nicht mehr zeitgemäß ist, merken
Verbraucher spätestens seit Beginn des Jahres auch am Geldbeutel.
Mit der neuen CO2-Bepreisung ist der Preis für Öl und Gas deutlich angestiegen. Dem gegenüber stehen finanzielle Anreize für
den Umstieg auf klimaschonende Alternativen. „Wer jetzt umsteigen will, bekommt so gute Bedingungen wie noch nie. Es gibt unterschiedliche
Fördermöglichkeiten über Steuerersparnis oder einen Zuschuss
für den Heizungsaustausch bis zu 45 Prozent“, so Joachim Müller, städtischer Energieberater im dlze-Dienstleistungszentrum
Energieeffizienz und Klimaschutz der Stadt Dortmund. „Um herauszufinden
welche Heizgeräte und Heizsysteme zur Nutzung erneuerbarer Energien optimal zum eigenen Haus passen, sollten sich die Hausbesitzer*innen fachlich beraten lassen.“
Unter www.verbraucherzentrale.nrw/besser-heizen können sich Verbraucher*
innen einen Überblick über Förderung, Planung und Durchführung eines Heizungstausches verschaffen. Für Interessierte besteht
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung vor Ort und in der
Beratungsstelle. Anmeldung dazu unter 0231 / 720 917-01 und unter 0211 / 33 996 555.
Das dlze des Umweltamtes der Stadt Dortmund bietet eine kostenfreie Erstberatung durch erfahrene Energieberater an. Informiert wird hier zu den Themen energetisches Modernisieren bzw. energieeffizientes
Bauen. Die Initialberatung ermöglicht einen Überblick über die
vorhandenen Einsparpotenziale des Gebäudes. Welche erneuerbaren
Energien am Objekt eingesetzt werden können, ist ebenso Bestandteil der Beratung wie grundlegende Informationen zu konkreten
Modernisierungsmaßnahmen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dlze.dortmund.de oder telefonisch bei Energieberater
Joachim Müller, Tel. (0231) 50-2 52 81.
Foto: Verbraucherzentrale NRW Silvia Strater

Viel dazulernen, wenig dafür ausgeben
Mit einem Weiterbildungsstipendium kam Goldschmiedin Lara Servais zu mehr beruflicher Handlungsfähigkeit
Es war reiner Zufall, dass Lara Servais sich dafür entschied, Goldschmiedin zu werden. „Eigentlich ging es mir während meiner beruflichen Orientierungsphase vor allem darum, mit meiner künstlerischen Begabung im besten Fall auch meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können“, sagt die junge Frau, die aus Paderborn stammt, nun aber in Hamm arbeitet. Doch das schien zunächst gar nicht so einfach. Durch ihr Umfeld wurde sie irgendwann auf jenen Handwerksberuf aufmerksam, in dem sie sich nach einem kurzen Praktikum ihre berufliche Zukunft vorstellen konnte. Ihre Ausbildung zur Goldschmiedin begann sie unmittelbar danach. „Die Mischung aus Kreativität, chemischen Elementen und filigransten Handarbeiten hat es mir angetan“, erzählt Servais. Kaum verwunderlich, dass sich die Leidenschaft für ihren Beruf auch in den sehr guten Abschlussnoten ihrer Gesellenprüfung widerspiegelte. Damit hatte Servais beste Voraussetzungen, um sich für ein Weiterbildungs-stipendium zu bewerben. Das wusste sie, tat es – und bekam es. Ein Prozess, bei dem ihr Cornelia Teipel, Mitarbeiterin der Handwerkskammer (HWK) Dortmund und Ansprechpartnerin für das Weiterbildungsstipendium, zur Seite stand.
„Frau Servais legte ihrer Bewerbung ein kurzes Motivationsschreiben bei, was noch einmal unterstrich, mit wie viel Engagement und Antrieb sie ihr Handwerk ausübt. Darüber hinaus war sie sich schon sehr im Klaren darüber, welche ambitionierten Pläne sie mit dem Stipendium realisieren wollte“, erinnert sie sich. Mit der Zusage standen Servais über einen Zeitraum von maximal drei Jahren jährlich bis zu 2.700 Euro für anspruchsvolle Weiterbildungen zur Verfügung. „Am 1. Januar 2020 wurde der Förderbetrag von insgesamt 7.200 Euro auf 8.100 Euro angehoben. Zwar bekam Frau Servais das Weiterbildungsstipendium bereits zwei Jahre zuvor, trotzdem wurde ihr Verfügungsrahmen auf die aktuelle Summe angehoben“, so Teipel.
Lara Servais nutze das Stipendium in vollen Zügen. Von der CAD-Fortbildung über Scherer-Kurse bis hin zu Filigrantechniken – die 27-Jährige wusste, was sie will. Sechs Mal hat sie sich bereits seit Erhalt des Stipendiums in unterschiedlichsten Richtungen weitergebildet. „Die Kurse habe ich mir selbst gesucht. 90 Prozent der Kosten dafür wurden durch das Stipendium abgedeckt, darin waren auch Fahrt- und Unterkunftskosten enthalten“, sagt Servais. 10 Prozent der Kosten habe sie selbst getragen. Für den verbleibenden Betrag von über 2.500 Euro gab es auch schon Pläne, doch das Leben der jungen Goldschmiedin änderte sich unerwartet. Im Juli 2020 wurde sie Mutter. Ein Ereignis, das berufliche Prioritäten zumindest für einige Zeit in den Hintergrund rückte. Servais: „Ich habe mich kurz nach der Geburt meines Kindes gleich bei der HWK Dortmund danach erkundigt, ob mein Anspruch auf das Weiterbildungsstipendium auch noch mit Elternzeit-Unterbrechung bestünde.“ Die Antwort lautete „Ja“. So kann sie ihr Stipendium unter Abzug der Elternzeit für die verbleibende Zeit trotzdem weiternutzen. Und sie weiß auch schon wie: „Im kaufmännischen Bereich möchte ich unbedingt noch dazulernen und tiefer in unternehmerische Prozesse blicken.“ Servais hat bereits zwei von vier Modulen im Intensiv-Meisterkurs für Goldschmiede absolviert, der Rest soll in naher Zukunft folgen.
Bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber, einem Juwelier, fühlt sich Servais als einzige Goldschmiedin sehr wohl. „Mir wurde von meinem Chef viel Verantwortung übertragen aber auch eben so viel Vertrauen entgegengebracht, daran konnte ich wachsen und wurde auch durch die ganzen Fort- und Weiterbildungen immer handlungsfähiger“, betont sie. Den Weg in die Selbstständigkeit könne sie sich theoretisch auch vorstellen. Als erstes stünde nach der Elternzeit aber erst einmal wieder die Praxis an, begleitet durch die anstehenden Weiterbildungen.
Hintergrund
Seit 1991 unterstützt das Förderprogramm der Bundesregierung begabte junge Absolvent*innen einer Berufsausbildung mit einem Weiterbildungsstipendium. Finanziert wird das Programm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Durchgeführt wird es von den Kammern und zuständigen Stellen für Berufsbildung. Im Kammerbezirk befinden sich durchschnittlich rund 100 Stipendiaten in der Förderung, die über drei Jahre läuft Jedes Jahr können zwischen 35 und 40 Neuaufnahmen erfolgen Etwa 200.000 Euro stehen jährlich an Fördermitteln zur Verfügung.
Bildzeile: Goldschmiedin Lara Servais hatte die besten Voraussetzungen, um sich für ein Weiterbildungsstipendium zu bewerben. Dies tat sie auch – mit Erfolg.

Hermann-Keiner-Haus Projekt –Miteinander und nicht allein–
– Gottesdienst bringt Hoffnung
Das Hermann-Keiner Haus sendet ein herzliches „Danke schön“ an die Philippus-Kirchengemeinde in Brünninghausen, denn…
…Hoffnung ist wichtig. Gerade jetzt, wenn zur Pandemie soziale Kontakte extrem schwer zu pflegen sind. Daher ist die Freude groß, wenn Hoffnungsträger positive Botschaften überbringen.
So wie an einem Tag Mitte April, einem ganz normalen Wochentag im Frühling nach Ostern im Laufe des Vormittags. An diesem Tag kehrt die evangelische Kirche in das Hermann-Keiner-Haus (HKH) ein und bereitet sich nach dem Schnelltest auf einen Gottesdienst vor. Gekommen ist die seit 23 Jahren aktive Küsterin Heike Bröckelmann. „Ich kümmere mich um alles vor Ort, damit es rund läuft“, erklärt sie mit einem Strahlen im Gesicht. Weiterhin findet sich der Organist Martin Grundhoff ein, Stellvertreter für Britta von Domarus, die nicht anwesend sein kann. Grundhoff spielt im Hermann-Keiner-Haus an diesem Tag Klavier und begleitet den Gottesdienst musikalisch.
Hochbeschäftigt kehrt auch Pfarrer Andreas Garpow ein. Er freut sich, dass er da sein kann. „Unsere Kirche ist salopp gesagt dicht, da können wir nicht für die Menschen da sein. Also kommen wir zu den Menschen“, erklärt er hoffnungsvoll. Seit 21 Jahren steht er im Dienst der Evangelischen Kirche im Stadtbezirk Hombruch.
Der Gottesdienst findet Parterre im Hermann-Keiner-Haus, Paritätischen Altenwohnheim Dortmund e. V. (PAV), Mergelteichstr. 47, 44225 Dortmund statt. „Für den Raum sind immer ein paar wenige Personen vorgesehen, da mehr mit den Covid-19 Beschränkungen nicht möglich sind“, erklärt Andrea Bergstermann, Geschäftsführung des Hermann-Keiner-Hauses (PAV) und freut sich über die Kooperation mit der evangelischen Kirche zu dieser schweren Zeit. Natürlich alles mit AHA- Effekt und Belüftung des Raumes.
Pastor und Organist singen, die Gemeinde summt. So wird auch bei jedem Lied Corona- gerecht mitgeschwungen. „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ oder „auf, auf, mein Herz mit Freuden“ ein Osterlied von Paul Gerhard und „O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit“.
Lukas 24 ist der biblische Mittelpunkt des Gottesdienstes an diesem Tag mit dem Ziel, Hoffnung für alle zu geben, die gekommen sind. Denn Verunsicherung lässt die Menschen verzweifeln.
Fürchtet euch nicht. Das waren die Worte des gekreuzigten Jesu nach der Auferstehung und er machte damit dort weiter, wo das Leben sich abspielt, um der Erde ein menschliches Angesicht zu geben.
Geschlossen wird der Gottesdienst mit dem Gesang „Wir wollen alle fröhlich sein“. Der nächste Gottesdienst ist am Mittwoch, 5. Mai 2021 im Hermann-Keiner-Haus.
Bildzeile: Pfr.A.Garpow / Ev.Philippus-Kirchengemeinde Dortmund / Bezirk Brünninghausen beim Gottestdienst in der Caféstube im Hermann Keiner Haus.
Foto: Claudia Hiddemann-Holthoff/ Hermann-Keiner-Haus

Girls‘ Day: Schweißen und Schneiden statt Schulbank drücken
Zwei Schülerinnen erhielten Einblick in die HWK-Schweißwerkstatt
Celine Sellathurai (2.v.l.), Schülerin der achten Klasse an der Josef-Reding-Hauptschule in Holzwickede, und
Yelisa Born cabera (r.) aus der siebten Klasse der Bochumer Erich Kästner Gesamtschule erhielten im April einen Einblick in die Schweißwerkstatt des Bildungszentrums Ardeystraße der Handwerkskammer (HWK) Dortmund. Am Girls‘ Day, der im Rahmen des Projekts „JOBSTARTER plus“ stattfand, konnten sich die jungen Damen einen Eindruck vom Beruf des Metallbauers verschaffen. Ausgerüstet mit Flammschutzkleidung durften sie natürlich selbst mit anpacken.
Werkstattleiter Timur Anafarta (2. v.r.) und HWK-Ausbildungsberater Volker Rückert (l.) begleiteten die Schülerinnen: „Wir wissen, wie herausfordernd diese besondere Pandemiesituation für die Unternehmen ist und teilen die Sorgen. Aber gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die Berufsorientierung für Jugendliche nicht aus den Augen zu verlieren. Aus diesem Grund bieten wir Schülerinnen die Möglichkeit, Handwerksberufe kennen zu lernen, in der Hoffnung den Kreis möglicher Ausbildungsplatzinteressenten zu erweitern.“
Bildzeile: Werkstattleiter Timur Anafarta, Celine Sellathurai und Yelisa Born cabera.
Foto: HWK Dortmund

Prof. Julia Frohne wird Geschäftsführerin der Business Metropole Ruhr
IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Schreiber gratuliert: „Eine sehr gute Wahl.“
Prof. Dr. Julia Frohne wird neue Geschäftsführerin der Business Metropole Ruhr GmbH (BMR). Die 51-Jährige ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Sie arbeitete zuvor für internationale Konzerne, aber auch schon für die Metropole Ruhr: Als Direktorin Marketing & Kommunikation war sie für die strategische Ausrichtung und Planung der Marketingkampagne der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 verantwortlich.
Stefan Schreiber, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund und Vorsitzender des Beirats der BMR, gratuliert Prof. Julia Frohne herzlich und betont: „Frau Professorin Frohne ist sicherlich eine sehr gute Wahl für diese wichtige Position. Als renommierte Management-Expertin verfügt sie über herausragende Kenntnisse und Erfahrungen im Standortmarketing. Sie hat ein exzellentes Netzwerk und ist mit den Wirtschaftsstrukturen des Ruhrgebiets bestens vertraut. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit.“
Thomas Eiskirch, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BMR, sagt: „Ich freue mich, dass der Aufsichtsrat dem Vorschlag der Findungskommission einhellig zugestimmt hat. Mit dieser breiten Unterstützung wird es gelingen, die großen Potenziale des Wirtschaftsstandortes den Investoren und Unternehmen deutlich zu machen.“
Der Aufsichtsrat schlägt Prof. Dr. Frohne einstimmig dem Verbandsausschuss des Regionalverbandes Ruhr vor, der über die Personalie entscheiden wird. Der Aufsichtsrat folgte damit dem Vorschlag der Findungskommission, in der neben Vertretern der Politik und des Regionalverbandes Ruhr auch ein Vertreter der kommunalen Wirtschaftsförderungen sowie der Beiratsvorsitzende der BMR vertreten waren.
„Das Ruhrgebiet kann wieder eine Spitzenposition als Wirtschaftsstandort in Deutschland und Europa erobern. Damit das gelingt, müssen wir die Stärken unserer Region in Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität deutlicher herausstellen und international sichtbar machen“, sagt Prof. Dr. Julia Frohne.
Die Grundlage für Wachstum nach der Coronakrise seien kreative Konzepte für interkommunale Kooperationen, attraktive Flächen für Ansiedlungen, die Ansprache internationaler Investoren sowie die konsequente Ausrichtung an Wachstumsbranchen, so Prof. Dr. Frohne: „In der Metropole Ruhr ist vieles in Bewegung, der Wandel ist Konstante. Dieses Innovationspotenzial sieht man an den 22 Hochschulen, der Dichte an Forschungseinrichtungen und am wachsenden Start-up-Ökosystem, aber auch in starken Branchen wie Energie, Umwelttechnik oder Cybersecurity. Ich freue mich sehr darauf, diese Potenziale gemeinsam mit dem Team der BMR und unseren Partnern in Kommunen, Verbänden und Unternehmen zu entwickeln.“
Mit Prof. Dr. Julia Frohne steht erstmals eine Frau an der Spitze der regionalen Wirtschaftsförderung Business Metropole Ruhr GmbH. Sie tritt die Nachfolge von Rasmus C. Beck Mitte August an.
Foto: IHK Dortmund

DIE LINKE.Dortmund: US-Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden
Der Kreisverband der Partei DIE LINKE in Dortmund hat sich der europäischen Solidaritätskampagne „Unblock Cuba“ angeschlossen. Am 24. April 2021, dem weltweiten Solidaritätstag mit der karibischen Insel, forderten LINKE-Mitglieder zusammen mit den mehr als 100 an der europäischen Solidaritätskampagne beteiligten anderen Organisationen aus 27 Ländern ein Ende der seit rund 60 Jahren andauernden Wirtschaftsblockade der USA gegen Kuba. Die Kampagne steht im zeitlichen Zusammenhang mit der für den 23. Juni 2021 erwarteten 29. Verurteilung der US-Blockade durch die UNO-Vollversammlung.
„Unter der US-Regierung Donald Trump ist die völkerrechtswidrige US-Blockade gegen Kuba auch während der Corona-Pandemie
mehrfach verschärft worden. Eine Rücknahme oder gar eine Beendigung der Blockade stehen derzeit nicht auf der Agenda des
neuen US-Präsidenten Josef Biden. Kuba entstehen jährlich Milliardenverluste mit schwerwiegenden Folgen für die Bevölkerung.
Bis hin zu Todesfällen, da die Blockade auch Lebensmittel, Medikamente und sogar Beatmungsgeräte sowie Impfstoff einschließt.
Trotz der eigenen Probleme schickt Kuba 3.000 Beschäftigte aus dem medizinischen Bereich in 28 Länder, darunter auch europäische, um bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie mitzuhelfen. Daher muss dieser Wirtschaftskrieg gegen das kubanische Volk endlich beendet werden.“, erklärt die LINKE-Kreisvorsitzende Cornelia Wimmer.
In der letzten Abstimmung der UNO-Vollversammlung im Jahr 2019 stimmten lediglich die USA, Israel und Brasilien mit Nein.
Kolumbien und die Ukraine enthielten sich. Die Resolution wurde daher mit 187:3 Stimmen angenommen. Die Mitgliedsstaaten der EU sowie die Schweiz votieren seit Jahren gegen die Blockade und verurteilen deren exterritoriale Ausdehnung, die auch europäische Unternehmen und Institutionen trifft.
Foto: Die Linke Dortmund

Daten und IT-Systeme absichern
VOLKSWOHL BUND Versicherungen nutzen
VIP-Fläche im DOKOM21 Rechenzentrum
Bei dieser Partnerschaft von zwei
Unternehmen aus Dortmund steht die Sicherheit im Mittelpunkt: Zur
Absicherung ihrer Daten und IT-Systeme nutzen die VOLKSWOHL
BUND Versicherungen eine VIP-Fläche im DOKOM21
Rechenzentrum in Dortmund-Huckarde.
Die VOLKSWOHL BUND Versicherungen mit Hauptsitz in Dortmund betreiben
zwei aktive Rechenzentren, die über redundante Glasfaserleitungen von
DOKOM21 miteinander verbunden sind. Ein Rechenzentrum arbeitet in der
Hauptverwaltung des VOLKSWOHL BUND in Dortmund am Südwall 37-41. Das
zweite Rechenzentrum ist auf einer exklusiven VIP-Fläche im DOKOM21
Rechenzentrum in Dortmund-Huckarde untergebracht.
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit der Systeme
Die beiden gleichwertig aktiven Rechenzentren sind durch eine synchrone
Spiegelung vollständig redundant. „Die hohe Verfügbarkeit aller IT-Systeme ist
für uns als Versicherungsunternehmen von existenzieller Bedeutung. Dank der
langjährigen Zusammenarbeit mit DOKOM21 profitieren wir bei unseren Aktiv-
Aktiv-Rechenzentren von Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit unserer Systeme“, erklärt Andreas Syldatke, Abteilungsleiter IT- Serversysteme und
Netze bei VOLKSWOHL BUND Versicherungen.
Lebensversicherer hat sehr hohe Ansprüche an Datenschutz
Insgesamt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VOLKSWOHL BUND
Versicherungen in der Hauptverwaltung in Dortmund und an sechs weiteren
Unternehmensstandorten in Deutschland greifen auf die Daten und IT-Systeme
in diesen beiden Rechenzentren zu. Zudem nutzen rund 14.000 selbstständige
Versicherungsmakler und Vertriebspartner in Deutschland die Systeme und
Daten.
„Alle Bestandsführungssysteme und alle Kunden- und Vertragsdaten der über
zwei Millionen Versicherungsnehmer in Deutschland liegen in unseren eigenen
Rechenzentren. Wir haben keine Daten in der Cloud gespeichert“, betont
Syldatke. „Als Lebensversicherer unterliegen wir nicht nur aufgrund des
Paragraphen 203 Strafgesetzbuch, Verletzung von Privatgeheimnissen, sehr
hohen Ansprüchen an den Datenschutz. Daher werden alle Daten Dritter und alle
sensiblen Applikationen ausschließlich in unseren eigenen Rechenzentren
gehostet.“
VIP-Raum mit Sichtschutz, Zugangskontrolle und Kameraüberwachung
Der VOLKSWOHL BUND hat im DOKOM21 Rechenzentrum einen so genannte
VIP-Raum angemietet. Hier wird die Fläche nicht durch Gitterwände, sondern
durch metallbeschichtete Trockenbauelemente abgeteilt. Dadurch besteht voller
Sichtschutz. Zudem hat der Versicherer in seinem VIP-Raum eine individuelle
Kameraüberwachung installiert. Neben den Zugangskontrollen zum
Rechenzentrum an sich benötigen die Mitarbeiter des VOLKSWOHL BUND
zusätzlich elektronische Zugangskarten und PIN-Nummern, um den VIP-Raum
betreten zu können. „Der Raum ist unser eigener, abgeschlossener
Hoheitsbereich“, betont Syldatke. „Wir haben unsere Geräte und IT-Systeme dort
eingebracht und betreiben sie auch selber.“
Effiziente Stromversorgung und Klimatisierung
„Im DOKOM21 Rechenzentrum in Dortmund-Huckarde profitieren wir unter
anderem von der Zuverlässigkeit und Effizienz in den Bereichen
Stromversorgung und Klimatisierung“, erklärt der Abteilungsleiter ITServersysteme
und Netze. Neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung
(USV) ist das zweigeschossige Gebäude mit einem hochmodernen Sicherheitsund
Brandschutzsystem, energieeffizienter Kühlung und einer leistungsstarken
Anbindung an die Internetbackbones wie Frankfurt und Amsterdam ausgestattet.
Zudem sorgt im DOKOM21 Rechenzentrum der Internetknoten Ruhr-CIX für
optimale Anbindungsvoraussetzungen.
Größter Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet
Mit aktuell insgesamt 6.200 Quadratmetern Fläche ist DOKOM21 der größte
Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet. Neben Volkswohl Bund
Versicherungen profitieren renommierte Unternehmen wie WILO, Materna oder
Leifheit von den Rechenzentrums-Dienstleistungen. DOKOM21 bietet
Unternehmen Platz für die komplette oder teilweise Auslagerung der eigenen
Serversysteme und für die Einrichtung von parallel betriebenen Notfall-Rechenzentren.
Bildzeile: Zur Absicherung ihrer Daten und IT-Systeme nutzen die VOLKSWOHL BUND
Versicherungen eine VIP-Fläche im DOKOM21 Rechenzentrum in Dortmund-
Huckarde. Andreas Syldatke (re.), Abteilungsleiter IT- Serversysteme und Netze
bei VOLKSWOHL BUND Versicherungen, und Jörg Figura, DOKOM21-
Geschäftsführer, setzen auf die Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit des DOKOM21 Rechenzentrums.
Foto: Roland Kentrup
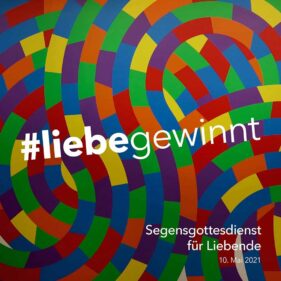
#liebe gewinnt – Segnungsgottesdienst für alle Liebenden
Am 10. Mai 2021 laden katholische Kirchengemeinden an unterschiedlichsten Orten in Deutschland zu Segnungsgottesdiensten ein. Dabei wollen die Verantwortlichen keinen ausschließen, sondern die Vielfalt der verschiedenen Lebensentwürfe und Liebesgeschichten von Menschen soll sichtbar werden. Alle können um den Gottes Segen bitten.
Ganz ohne Heimlichkeit.
Auch die Pfarrei Heilige Dreikönige in der Dortmunder Nordstadt beteiligt sich mit einem Gottesdienst an dieser Aktion. Der Gottesdienst findet am Montag, 10. Mai, um 19:00 Uhr in der
Kirche St. Antonius, Holsteiner Straße 21, statt. Alle Liebenden sind herzlich eingeladen.

Gemeinsam musizieren, tanzen, singen: Jetzt für JeKits im nächsten Schuljahr anmelden!
Gemeinsam musizieren, tanzen und singen – rund 6000 Kinder an über 70 Grund- und Förderschulen in Dortmund nehmen jedes Jahr an JeKits teil, dem Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ des Landes NRW. Dabei kooperieren die Grundschulen mit der Musikschule Dortmund. Da die Kinder in diesem Schuljahr nur wenige Gelegenheiten hatten, gemeinsam Musik zu erleben, dürfen sie im nächsten Schuljahr noch einmal teilnehmen. Die Musikschule Dortmund will Schüler*innen an allen JeKits-Grundschulen ein weiteres JeKits-Jahr ermöglichen.
Im April und Mai können Eltern ihr Kind an den Schulen für das Programm anmelden. Informationen dazu gibt es auch auf der Homepage der Musikschule Dortmund: jekits-dortmund.de.
Kinder, die noch kein Instrument spielen, dürfen sich bis Ende April entscheiden, welches Instrument sie erlernen möchten.
Kinder, die schon ein Instrument spielen, können noch einmal an JeKits teilnehmen.
Die Instrumente ihrer Wahl können die Kinder kostenlos in der Musikschule ausleihen.
Information und Beratung
Musikschule Dortmund, Steinstr. 35, 44147 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 77-12 oder -13
musikschule@dortmund.de
jekits-dortmund.de
musikschule.dortmund.de
Bildzeile: JeKits-Orchesterprobe.

Freundeskreis Hoeschpark: Neuer Vorstand startet mit frischem Elan
Im April hat die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Hoeschpark e.V. stattgefunden, dieses Mal aufgrund der Corona-Bestimmungen als Video-Meeting. Neben der Aussprache zu aktuellen Themen – darunter die Zukunft des Freibads Stockheide – ging es dabei um die Wahl der Vorstands-Mitglieder.
Der auf allen Positionen einstimmig gewählte neue Vorstand setzt sich zusammen aus:
Ute Ellermann, Vorsitzende
Carola Hiby-Asianowaa, stellvertretende Vorsitzende
Franz-Josef Ingenmey, Schriftführer
Birgit Nau, Kassiererin
Zum Beisitzer/zur Beisitzerin wurden gewählt: Thomas Bahr, Karin Beher, Ubbo de Boer, Susanne Schulte und Franz Stengert.
Kassenprüferinnen sind zukünftig Irmgard Wegener und Magdalena Ryczek. Annette Kritzler steht als stellvertretende Schriftführerin zur Verfügung.
Der Vorstand geht mit frischem Elan und Optimismus an die Arbeit und freut sich schon auf die Zeit ohne weitreichende Corona-Einschränkungen, wenn der Park wieder stärker als „grüne Lunge“ der Nordstadt genutzt und besucht werden kann.
Bildzeile: v.l. Ute Ellermann (Vorsitzende), Carola Hiby-Asianowaa (stellv. Vorsitzende), Birgit Nau (Kassiererin), Franz-Josef Ingenmey (Schriftführer)
Foto: Freundeskreis Hoeschpark

Digitaler Kongress: Junge Liberale Ruhr stimmen sich auf Wahljahr ein
Ende April traf sich die FDP-Jugendorganisation „Junge Liberale“ (JuLis) im Ruhrgebiet zu ihrem Bezirkskongress. Da aufgrund der aktuellen Coronapandemie auch politische Veranstaltungen nur Online stattfinden können, fand der Kongress das rein digital als Stream statt. Trotz bestem Wetter am Sonntagmittag hatten sich 110 Mitglieder der JuLis zum Kongress angemeldet. Die Teilnehmer konnten entweder im Livestream auf YouTube zusehen oder über das Videokonferenztool „GoTo-Meeting“ teilnehmen, worüber auch Redebeiträge eingebracht werden konnten.
Der rund viereinhalbstündige Kongress war rein programmatisch. Insgesamt waren 30 inhaltliche Anträge zu unterschiedlichen Themen eingegangen.
Zu Beginn des Kongresses leitete der Bezirksvorsitzende Nils Mehrer in den Kongress ein. Er kritisierte in seiner Rede die Coronapolitik der Bundesregierung, das Impfmanagment und die pauschalen Ausgangssperren des neuen Infektionsschutzgesetzes. Besonders die junge Generation leide unter den Maßnahmen und müsse in der Debatte ernst genommen werden. „Wären wir beim Impfen nur halb so schnell vorangekommen, wie beim Durchpeitschen dieses verfassungswidrigen Infektionsschutzgesetzes, wären wir in der Pandemiebekämpfung deutlich weiter“, so Mehrer in seiner Rede.
Im Anschluss wurden zehn Anträge beschlossen. Im Fokus stand zu Beginn die Unterstützung der Studierenden. Konkret fordern die JuLis langfristige Planungssicherheit in Bezug auf Prüfungsformate und Freisemester sowie eine finanzielle Entlastung und Flexibilisierung bei Höchstarbeitszeiten. Alle Beschlüsse finden sich Online auf der Website der JuLis Ruhr.
Zu Gast beim Kongress war auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann MdB. Der Gelsenkirchener motivierte in seiner Rede zur Beteiligung im Bundestagswahlkampf und betonte die konstruktive Oppositionsarbeit der FDP im Bundestag. In der anschließenden Fragerunde trat Buschmann in den Dialog mit den Teilnehmern.
Moderiert wurde der Kongress durch Nils Mehrer und Vorstandsmitglied Maik Pagiewski. Beide saßen mit negativem Coronatest live vor der Kamera und moderierten aus ihrem Studio, während im Hintergrund die Technik Redner aus der Videokonferenz und das Kongressstudio im Stream zusammenschaltete. Die Jungen Liberalen trafen sich erstmalig in diesem neuen Tagungsformat. Die rechtliche Grundlage für digitale Kongresse ist das das sogenannte „COVMG“ Gesetz. Befristet bis zum 31.12.2021 können dadurch Verbände wie die JuLis aufgrund der Pandemie auch digital tagen – unabhängig davon, ob ein solches Format in der Vereinssatzung überhaupt vorgesehen ist.
Bildzeile: JuLi-Bezirksvorsitzender Nils Mehrer kritisiert in seiner Rede pauschale Ausgangssperren
Foto: Frank Fliessner

Broschüre „Katholische Friedhöfe“ neu aufgelegt
Orte christlicher Trauer und Hoffnung
In Dortmund gibt es 17 katholische Friedhöfe inklusive der Grabeskirche Liebfrauen. In einer neu aufgelegten Broschüre der Katholischen Stadtkirche Dortmund werden diese mit Adressen, den Namen der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie Fotos vorgestellt.
Das 36-seitige kostenlose Heft ist erhältlich im Katholischen Centrum am Propsteihof 10, in der Verwaltung der Grabeskirche Liebfrauen an der Amalienstraße 21a sowie in den Pfarrbüros der Kirchengemeinden mit eigenen Friedhöfen und bei den Bestattungsunternehmen. Auf der Internetseite www.stadtkirche-dortmund.de gibt es eine Online-Version als Blätterkatalog und eine Download-Möglichkeit.
„Die katholischen Friedhöfe in Dortmund stehen für die Verkündigung der christlichen Botschaft von Tod und Auferstehung“, schreibt Propst Andreas Coersmeier im Vorwort. Der Glaube an die Auferstehung der Toten sei eine zentrale Aussage der christlichen Religion. So sei es eine Aufgabe der christlichen Gemeinde, ihre Toten zu bestatten und den Angehörigen und Freunden in ihrer Trauer beizustehen. Die katholischen Friedhöfe sollten vorbildliche Orte von christlicher Trauer und Hoffnung sein, was auch durch ihren Charakter und ihre besondere Gestaltung deutliche werde.
Auf vielen katholischen Friedhöfen können auch Verstorbene, die nicht katholischen Glaubens sind, bestattet werden. Dabei wird jedoch erwartet, dass der christliche Charakter des Friedhofes wertgeschätzt und anerkannt wird.
Bildzeile: Die Grabeskirche Liebfrauen zählt zu den insgesamt 17 katholischen Friedhöfen, die in der neu herausgegebenen Broschüre „Katholische Friedhöfe in Dortmund“ verzeichnet sind.
Foto: Michael Bodin / Kath. Stadtkirche Dortmund

Konrad-Klepping-Berufskolleg erhält eTwinnung-Schulsiegel
Das Siegel würdigt europäisch ausgerichtete Schulen, die sich besonders für eTwinning engagieren, einem Angebot im Programm Erasmus+, und dies bei der Schulentwicklung berücksichtigen.
Das Konrad-Klepping-Berufskolleg ist eine von 17 Schulen bundesweit, die mit dem Siegel ausgezeichnet wurden. Das Siegel würdigt den gemeinsamen Einsatz von Schüler*innen, Lehrkräften und Schulleitungen. Ausgezeichnete Schulen nehmen eine Vorbildfunktion in Sachen digitales Lernen und Internetsicherheit ein und verfolgen innovative pädagogische Ansätze.
Seit 2017 führt das Konrad-Klepping-Berufskolleg etwinning-Projekte durch und setzt sich mit den Möglichkeiten einer digitalen Welt und der kulturellen Vielfalt auseinander.
Über die Auszeichnung freuen sich gemeinsam mit den beteiligen Klassen die betreuenden Lehrkräfte Indra Jagiella und Stefan Koböke: „Unsere eTwinning-Projekte ermöglichen unseren Schüler*innen genau die Fertigkeiten zu erwerben, die sie später für einen erfolgreichen Einstieg in einen Beruf mit Zukunft brauchen. Über das eTwinning-Netzwerk arbeiten die Schüler*innen gemeinsam mit anderen europäischen Schulklassen an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen. Auf diesem Wege entwickeln sie ein Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt in Europa und die Bedeutung des europäischen Wirtschaftsraumes. Sie lernen, wie man neue Medien zielgerichtet für die Teamarbeit einsetzen kann, und verbessern ihr Fachvokabular in Wirtschaftsenglisch, da der Austausch mit Partnerschulen in ganz Europa in Englisch erfolgt.“

Start der Tarifrunde – Dortmunder SPD-Landtagsabgeordnete stehen an der Seite der Beschäftigten im Einzelhandel
Gemeinsam mit Beschäftigten, Reiner Kajewski, Philip Keens und Karsten Rupprecht von der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di NRW) fand sich heute Volkan Baran, stellvertretend für alle vier Dortmunder SPD-Landtagsabgeordneten, vor der Regionalgeschäftsstelle des Arbeitgeberverbands ein, um die Forderungen für die diesjährige Tarifrunde zu übergeben. Gleiches fand vor den anderen Geschäftsstellen der Regionalverbände in NRW statt, denn am 5. Mai beginnen die Tarifverhandlungen im nordrhein-westfälischen Einzelhandel.
Die Forderungen der Gewerkschaft umfassen 4,5 % plus, 45 Euro mehr Gehalt, Lohn und Auszubildendenvergütung sowie ein Mindeststundenentgelt von 12,50 Euro für die rund 700.000 Beschäftigten, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem fordert ver.di von den Arbeitgebern des Einzelhandels die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit (AVE) der Tarifverträge.
Volkan Baran erklärt sich solidarisch mit den Beschäftigten: „Die Pandemie fordert uns alle heraus, aber besonders im Einzelhandel arbeiten die Beschäftigten seit März 2020 täglich an vorderster Front, riskieren ihre Gesundheit und versorgen uns als Gesellschaft. Zahlen zeigen, dass Lebensmitteleinzelhandel, Baumärkte, Elektrofachmärkte und Möbelmärkte deutliche Zuwächse verbuchen konnten. Wir als Dortmunder Landtagabgeordnete wünschen uns, dass die Arbeitgeber ein Angebot machen, das diese Leistung honoriert. Sie verdienen eine deutliche Erhöhung, deshalb bin ich heute hier.“
Foto: ver.di Westfalen