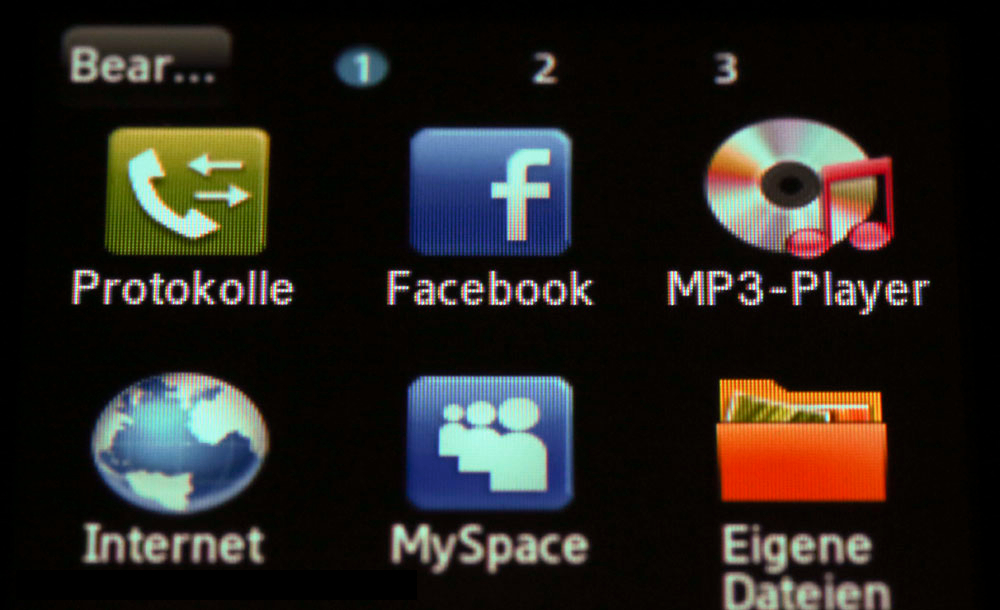
Um „den Menschen“ bei der unumgänglichen digitalen Transformation Dortmunds in den Mittelpunkt zu stellen, hat die Stadt „Werteleitbilder“ entwickelt, um möglichst flächendeckend Akzeptanz zu erzeugen. – Daten zu den Fahrradverkehren dagegen brauchen die Planer*innen zur Festlegung von Vorrangrouten, damit Dortmund auch wirklich zur anvisierten „Fahrradstadt“ werden kann. Unter anderem eine zu entwickelnde App soll’s richten. – Die Stadtverwaltung wiederum ist per Gesetz verpflichtet, bis 2022 für hunderte ihrer Verwaltungsleistungen Online-Zugänge zu schaffen: das soll nicht als Knebel, sondern als Chance begriffen werden. – Willkommen im Morgen.
Leitbild zur Digitalisierung der Stadt: Menschen sollen im Mittelpunkt stehen
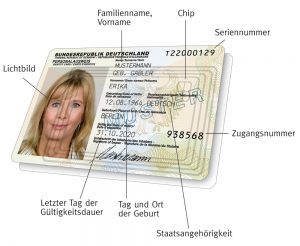
Bei der Digitalisierung in den Städten handelt es sich nach den durchaus ambitionierten Vorstellungen des Verwaltungsvorstands um einen fortlaufenden Prozess, der nicht die Technologien in den Mittelpunkt stellt, sondern die Menschen und die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Zur Sicherung digitaler Zukunftsfähigkeit braucht es Zusammenarbeit: zwischen unterschiedlichen Bereichen und Akteuren der Stadtgesellschaft sowie eines Ökosystems aus Verwaltung, Politik, Institutionen, Wissenschaft und Wirtschaft.
___STEADY_PAYWALL___
Vernetzt wird die Strategie in Dortmund vom Chief Information/Innovation Office (CIIO). Damit all die wunderbaren Neuerungen, die da auf uns zukommen, nicht aus dem Ruder laufen, hat sich die Stadtspitze ein „Werteleitbild“ ausgedacht, das gewissermaßen den ethisch legitimierbaren Handlungsrahmen für die Zukunft abstecken soll. Neben der Akzeptabilität geht es aber auch um faktische Akzeptanz:
„Ein solches Werteleitbild ist maßgeblich für die breite Akzeptanz der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen der Stadt und wird für uns ein wichtiger Kompass für die Arbeit der nächsten Jahre“, betont OP Ullrich Sierau. Sein Leiter des CIIO, Dr. Jan Fritz Rettberg, macht klar: „Unser europäischer Werterahmen stellt den Menschen in den Mittelpunkt. […] Die entwickelten Leitsätze zur Digitalisierung sind unser Bekenntnis zu einer Digitalisierung, die die Menschen in eben diesen Mittelpunkt stellt.“
Die Leitsätze der Stadt Dortmund im Kern: eine Armada hehrer Absichten

Digitalisierung wird grundsätzlich als Chance für positive Veränderungen betrachtet. In dem Prozess sollen alle Menschen „gleichbehandelt, nicht diskriminiert“ werden. Sie soll dazu beitragen, „Beteiligung von Minderheiten in der Gesellschaft in der Entscheidungsfindung fortzusetzen und zu stärken“. Zudem erhofft sich die Stadt, dass sie „sozialer Ausgrenzung in Bildungsprozessen entgegenwirkt“, heißt es an Ort und Stelle.
Digitalisierung als Querschnittsthema soll nachhaltig sein wie sie „ein wesentliches Instrument zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele“ sei. Ausdrücklich wird sie in den Leitsätzen nicht als „Selbstzweck“ betrachtet, sondern mit ihr sollen in der Stadtverwaltung „Prozesse und Dienstleistungen“ verbessert werden, auch zum Vorteil der Angestellten dort.
Und für alle, die analog bleiben möchten: Wahlmöglichkeiten werden prinzipiell erhalten bleiben – ein digitaler Modus also quasi nicht zur Pflicht werden. Mit der bereichsübergreifenden Nutzung von Daten möchte der Verwaltungsvorstand eine bessere Steuerung der Stadt erreichen ebenso wie mit der Digitalisierung die „kommunale Daseinsvorsorge“ unterstützen.
Zwischenbemerkung: unangenehme Folgen der Digitalisierung – entscheidende Kompetenzen beim Bund

Hehre Ziele. Wie realistisch sie sind, steht im Einzelnen freilich auf einem anderen Papier. Das wird an einem anderen Leitsatz deutlich: „Datenschutz, Datensicherheit und informelle Selbstbestimmtheit sind für uns eine Selbstverständlichkeit.“
Die Bereitstellung entscheidender Einfallstore für eine De-facto-Aushöhlung solcher „Werte“ und Rechte, die seit Jahren in der Bundesrepublik zu beobachten ist, entziehen sich nämlich schlicht dem kommunalen Kompetenzbereich. Sie werden vielmehr durch Legislation in Berlin geschaffen.
Beispiel der jüngeren Zeit ist etwa das Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises (2017), mit dem der automatisierte Online-Abruf biometrischer Lichtbilder für Nachrichtendienste und Polizeibehörden u.a. möglich wurde. – Da kann der Stadt noch so viel heilig sein: über den Weg etwa in den Überwachungsstaat entscheidet nicht sie, sondern andere.
Digitalisierung des Radverkehrs: Stadt plant Fahrrad-App mit Navigationsfunktion und Bonusaktionen
 Erheblich größer ist der kommunale Handlungsspielraum, wenn es um die Mobilität in der Stadt geht, Stichwort: Wende hin zum ökologisch Verträglichen. Aus Dortmund soll eine „Fahrradstadt“ werden. Allerdings liegen für den Radverkehr nur rudimentäre Daten über Verkehrsmengen bzw. Fahrtenaufkommen vor. Solche Daten aber bilden eine wichtige Grundlage für notwendige Infrastrukturmaßnahmen und Priorisierungen sowie zur Evaluation.
Erheblich größer ist der kommunale Handlungsspielraum, wenn es um die Mobilität in der Stadt geht, Stichwort: Wende hin zum ökologisch Verträglichen. Aus Dortmund soll eine „Fahrradstadt“ werden. Allerdings liegen für den Radverkehr nur rudimentäre Daten über Verkehrsmengen bzw. Fahrtenaufkommen vor. Solche Daten aber bilden eine wichtige Grundlage für notwendige Infrastrukturmaßnahmen und Priorisierungen sowie zur Evaluation.
Hier sollen zukünftig Daten über eine App gesammelt werden. Sie bilden eine wesentliche Grundlage zur Festlegung von Vorrangrouten für den Radverkehr. Um valide Daten für die Radverkehrsplanung zu erhalten, bedarf es einer breiten Nutzung der App durch die Radfahrenden. Zum Aufbau der Teilnehmergemeinde und zur Steigerung der Nutzerzahl soll zur Einführung der App in 2020 unter anderem eine Bonuskampagne durchgeführt werden.
Für die Nutzenden ist die App ein qualitativ hochwertiges Radverkehr-Navigationsprogramm mit einem besonderen Anreiz. Der wird durch ein Bonussystem gegeben, welches in die App integriert sein soll und z.B. Rabatt-Codes und spezielle Aktionen von assoziiertem Einzelhandel, Betrieben und Institutionen zur Verfügung stellt. Auf diese Weise soll die Bereitschaft zur Installation der App gestärkt und die Motivation zum Radfahren permanent hochgehalten werden.
Bis 2022 müssen etwa 575 Verwaltungsleistungen auch digital angeboten werden
 Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Mit dem zudem obligatorischen Portalverbund auf Bundes- und Landesebene wird sichergestellt, dass Nutzer über alle Verwaltungsportale einen barriere- und medienbruchfreien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen erhalten.
Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Mit dem zudem obligatorischen Portalverbund auf Bundes- und Landesebene wird sichergestellt, dass Nutzer über alle Verwaltungsportale einen barriere- und medienbruchfreien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen erhalten.
Die sogenannten OZG-Leistungen umfassen ca. 575 zu digitalisierende Verwaltungsleistungen. Für die Umsetzung in der Stadtverwaltung soll nun eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe gebildet werden. Sie berät und unterstützt die Stadtverwaltung Dortmund und entwickelt Handlungsempfehlungen.
Vom OZG sind alle Fachbereiche betroffen, auch die Bürgerdienste. Diese bieten bereits einige Leistungen auf digitalem Wege an. So können Termine online vereinbart werden, das Kfz-Wunschkennzeichen herausgesucht und reserviert werden oder die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen automatisiert erfolgen.
In den kommenden Wochen: weitere Leistungen der Bürgerdienste sollen online verfügbar sein

Auch der Antragsstatus für beantragte Reisepässe und Personalausweise ist online verfolgbar. Die Bürgerdienste der Verwaltung bieten u. a. noch die einfache Melderegisterauskunft, Leistungen des Fundbüros, die Beantragung des Bewohnerparkausweises oder die Beantragung von Führungszeugnissen über das Internet an.
In den kommenden Wochen und Monaten werden noch weitere Leistungen der Bürgerdienste online angeboten: die Beantragung von Personenstandsurkunden, die Voranmeldung von Eheschließungen sowie ein Trau-Terminkalender. Darüber hinaus wird aktuell der Einsatz einer neuen Terminmanagementsoftware geprüft.
Das OZG versetzt die Verwaltungen in die Lage, sich mit ihren eigenen Prozessen und Leistungen im Interesse der Kundengruppen (Bürger*innen und Unternehmen) auseinander zu setzen und moderne Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten.
Christian Uhr: Onlinezugangsgesetz als Chance wahrnehmen, aber gewohnte Zugangswege offen halten

Die Möglichkeit, aktuell oder zukünftig mit der Verwaltung elektronisch zu kommunizieren, Anträge zu stellen und Leistungen auch online zu bezahlen, werden als zusätzlicher Eingangskanal der Verwaltung angeboten und ersetzen nicht die herkömmlichen Wege in Papierform oder auf dem persönlichen Weg.
Personal- und Organisationsdezernent Christian Uhr sieht das OZG als Chance: „Wir haben nicht nur den Anspruch die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, vielmehr wollen wir unsere eigenen Vorstellungen einer modernen Verwaltung in den Prozess einfließen lassen und so Verwaltungsabläufe optimieren und bürgerfreundlicher gestalten. Bei aller Digitalisierungsdynamik wird die bürgerfreundliche Verwaltung immer auch die gewohnten Zugangswege bereithalten.“
Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:
Bürgerdienste haben ein Selbstbedienungsterminal zur Beantragung von Personalausweis und Reisepass

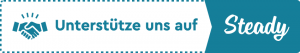


Reaktionen
Digitalisierung der Stadtverwaltung: FDP/Bürgerliste will Impulse von außen – Forderung nach Nachbesserungen am Beschluss des Digitalisierungsausschusses des Rates (PM FDP/ Bürgerliste)
Digitalisierung der Stadtverwaltung: FDP/Bürgerliste will Impulse von außen – Forderung nach Nachbesserungen am Beschluss des Digitalisierungsausschusses des Rates
Die Stadt Dortmund ist im digitalen Städte-Ranking des Branchenverbands Bitkom vom 9. Platz (2019) auf den 23. Platz (2020) abgerutscht. Bei der Verwaltung hat sich Dortmund sogar vom 4. auf den 41. Platz verschlechtert. „Die Stadtverwaltung hat offenkundig zuletzt die Digitalisierungsdynamik anderer Städte verschlafen“, meint Michael Kauch, Fraktionsvorsitzender von FDP/Bürgerliste im Rat. „Deshalb zieht der Rat jetzt die Konsequenzen und fordert vom Oberbürgermeister eine Roadmap mit klaren Fristen und Verantwortlichkeiten. Dortmund muss endlich digitaler werden.“
Mit einem „Memorandum zur Digitalisierung“ bis 2025 sollen klare Ziele definiert und die Umsetzung von Maßnahmen kontrolliert werden. In Gesprächen fast aller Fraktionen wurde ein Antrag erarbeitet, der gestern im Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung beschlossen wurde.
Auch die Fraktion FDP/Bürgerliste hatte daran aktiv mitgewirkt. „Wir haben die Vorgaben für eine nachprüfbare Roadmap geschärft, die Prozesse nicht nur digitalisiert, sondern auch vereinfacht werden. Wir freuen uns, dass unsere Vorschläge für die Homeoffice-Fähigkeit aller geeigneten Arbeitsplätze, die Umsetzung zentraler Apps für Bürger und Unternehmen, die Überarbeitung der städtischen Website sowie die Nutzung von Open-Source- und Open-Data-Lösungen aufgegriffen wurden“, so Frieder Löhrer (FDP), sachkundiger Bürger im Ausschuss.
Doch Löhrer übt auch massive Kritik, die dazu führte, dass die FDP/Bürgerliste dem Antrag am Ende nicht zustimmen konnte: „Wie das Städteranking zeigt, ist die bisherige Strategie, auf stadtinterne Ressourcen zu setzen, gescheitert. Diese schlechte Leistung muss sich auch der zuständige Fachbereich zurechnen lassen. Daher halten wir es für einen Fehler, die Rolle des Dosys noch aufzuwerten, wie es der Ausschuss will.“
Zumindest müsse bei einer Stärkung des Dosys eine durchgängige externe Beratung für eine effiziente Digitalisierung erfolgen. Letzteres war auch das ursprüngliche Ergebnis der interfraktionellen Beratungen. Frieder Löhrer: „Erfolgreiche Fußballmannschaften holen sich den erfahrenen Coach auch am Markt. Leider wurden die Formulierungen auf Betreiben von Grünen und CDU so aufgeweicht, dass die externe Beratung nicht mehr durchgängig abgesichert ist. Als Hintertür sollen sich Teile der Verwaltung wechselseitig beraten, so die Intention der Änderung in letzter Minute. Dies gefährdet einen kritischen Blick auf die Anstrengungen der Stadt – und damit den Erfolg des Gesamtprojekts.“ Michael Kauch kündigte daher an, seitens FDP/Bürgerliste auf Änderungen für mehr Impulse von außen hinzuwirken.
Mit freundlichen Grüßen