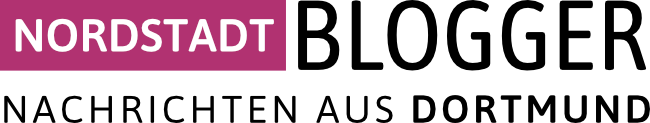Von Angelika Steger
Premiere der Oper „Turandot“ am Opernhaus Dortmund. Die Oper von Giacomo Puccini fand beim Publikum großen Anklang – aber nicht bei allen.
Entstehung und Aufbau von „Turandot“
Gewalt stößt ab und fasziniert gleichermaßen. Das orientalische Sujet von der schönen, aber grausamen Prinzessin, die ihre Bewerber, können sie ihre Rätsel nicht lösen, allesamt hinrichten lässt, hat nach der Übersetzung von François Petit de la Croix 1710/12 mehrere Dichter und Komponisten inspiriert.
Auch Friedrich Schiller hat den Stoff für das Weimarer Nationaltheater bearbeitet, Andrea Maffei hat Schillers Text dann 1857 ins Italienische übersetzt, dieser hat Giacomo Puccini wiederum zu seiner Oper inspiriert. Bei Puccinis Turandot war es auch der Exotismus, der die ZeitgenossInnen bei der Uraufführung am 25. April 1926 so fasziniert haben muss.
Musikalische Stilmittel, die fremd und faszinierend klingen
Der Komponist verwendet pentatonische Melodien, lässt die SängerInnen unisono oder im ostinato singen, flechtet rhythmische Akzentverschiebungen ein, was für das europäische Ohr wie aus einer fremden und deshalb faszinierenden Welt klingt. Doch gerade im Exotismus liegt die Versuchung, die Inszenierung mit Klischees des fremden Landes (bei Turandot: China) zu überziehen.

Regisseur Tomo Sugao hat sich nur stückweise am Libretto orientiert, das Bühnenbild ist fast durchgehend gleich, es gibt keinen weiten Garten im kaiserlichen Palast, wie im 3. Akt vorgesehen, auch die Marmortreppe in Akt 2 fehlt. Es gibt keine Pfähle, auf denen die Köpfe der Verurteilen aufgesteckt sind, nur einmal wird der Leichnam des letzten Hinrichtungsopfers in giftgrünem Licht vorgeführt. Dennoch tappt er in die Klischeefalle.
___STEADY_PAYWALL___
Mittelpunkt ist ein Podest in der Bühnenmitte, das abwechselnd als Richtplatz und für die Repräsentation von Kaiser und Prinzessin dient. Das Volk sitzt oder kniet oder läuft um das Podest herum, in schwarzen und dunkelgrauen Arbeitsuniformen mit runden Spitzhüten oder Schirmmützen gekleidet. Hier gilt nur die Masse, die als Untertanen ihre Pflichten gegenüber den Regierenden zu erfüllen hat. Individuell darf nur ein Herrscher sein.
Sensationsgier der Massen damals und heute
Wie im Kino verfolgen die Menschen das Geschehen auf dem Podest: sensationsgierig, lüstern nach Neuigkeiten aus der „Promi-Szene“ im Palast, der Skandal-Prinzessin, dem alten, sterbenden Kaiser und den zahlreich eintreffenden fremden Prinzen, der folgenden Hinrichtung. Es wird gefeixt, gewettet, wer dieses Mal sterben muss, Schaukämpfe werden ausgetragen.

Der Chor agiert dabei hervorragend: immer ist Bewegung sichtbar, ohne dass es unruhig wird. Die ChorsängerInnen sind auch diejenigen, die die dynamischen Nuancen im Gesang (litaneiartig und leise-andächtig beim Totengesang, laut und schrill bei der Todesforderung für den Verurteilten) beherrschen. Einmal fordert das Volk den Tod, dann Gnade für den Verurteilten.
Das sind die Boulevardzeitungsleser von damals, Mitleid und Hate-Speech wechseln sich ab. Sensationslust besteht bis heute, Psychoterror für die Beobachteten inklusive. Ständig recken sie ihre Hände nach dem Todeskandidaten, schreien, rufen, laufen hin und her, bis sie von den Höflingen, bzw. Ministern Ping, Pong und Pang wieder zur Ordnung gezwungen werden.
Bühne und Kostüme: übertrieben und voller Klischees
Hohe, schwarz-rot gemusterte Wände beschränken die Bühne, wenn die schräge Decke, die an eine große Grabplatte erinnert, sich hebt, kommt auch die unerreichbare Prinzessin Turandot zum Vorschein. In blauem Licht und eiseskalt mit breiter Krone, hoch aufgerichtet und in viele Schichten von Kleidern eingehüllt, taucht sie im Hintergrund auf. Unerreichbar, fast wie ein Traumbild.

Das ist dem Bühnenbildner Frank Philipp Schlößmann und Regisseur Tomo Sugao gut gelungen. Weshalb aber noch drei andere Prinzessinnen, die Turandot als Kind, Jugendliche und junge Frau darstellen sollen, als eine Art Geister der Ahnen auftauchen müssen, ist nicht schlüssig. Die Kronen schienen für die Kinder auf Dauer auch sehr schwer gewesen zu sein, bei allem möglichen Spaß am Prinzessinnen-Sein. Das Bild einer jungen Prinzessin an der Wand hätte völlig gereicht.
Übertrieben auch die Kostümierung der „Minister“ Ping, Pong und Pang: ihr „Dutt“ inklusive einer Art Samurai-Gewand wirkt klischeehaft. Einfache Hosenanzüge, vielleicht mit einem goldenen chinesischen Buchstaben auf dem Revers wären besser gewesen.
Bühnenausstattung hat nichts mit der Musik zu tun: nur goldener und roter Bombast

Was das Blockbuster-Kino auf der Opernbühne aber auf die Spitze treibt, ist das Hintergrundbild: ein riesiger goldener Drache mit aufsteigendem Rauch. Klischee-China wie im Import-Export-Laden. Auch die zahlreichen roten runden Lampen aus dem China-Imbiss in den Gemächern von Turandot wirken zu dick aufgetragen. Hier wäre weniger mehr gewesen.
Die Hinrichtung des persischen Prinzen selbst wird nicht direkt gezeigt, dafür muss aber einer der drei „Minister“ ein großes, extra blutverschmiertes Schwert immer wieder hervorholen. Hollywood-Action-Film auf der Opernbühne. Nur die Schwert-Kämpfer fehlen noch.
Der Musik Puccinis dient das nicht. Überzeugend hingegen ist das Schauspiel und die Stimme von Sae-Kyung Rim als Sklavin Liú, als sie ihre unglückliche Liebe zum Prinzen Calaf besingt. Ergreifend und glaubwürdig singt sie von ihrem Schmerz.
Jede und jeder, die oder der schon einmal sehr in einen desinteressierten Mann verliebt war, wird diesen nachvollziehen können. Nur einmal kommt es zu einem schüchternen Kuss zwischen Liu und Calaf, für den sich die Sklavin sofort schämt. Weil es eben eine nicht standesgemäße Liason ist.
Beeindruckendes Schauspiel und Gesang mit pompöser Ausstattung
Eine Freude ist auch das Zusammenspiel der 3 „Minister“ und Höflinge Ping, Pong und Pang: wie Pingpong-Bälle hüpfen sie hin und her, man weiß nie, ob aus ihren Händen im nächsten Moment ein roter Fächer oder ein Messer blitzt. Dazu passend erklingt Unisono-Gesang mit Xylophon-Begleitung. Stimmlich ergänzen sich Morgan Moody Sunnyboy Dladla und Fritz Steinbacher ebenfalls, nur gelegentlich sind leichte Abweichungen bei den Einsätzen zu erkennen.
 Im zweiten Akt nehmen sie die strengen breiten Tuchgürtel ab, so dass das Dekolletee zum Vorschein kommt; fast könnte man annehmen, sie befänden sich in einem gemütlichen Club für Homosexuelle. Das macht sie ebenfalls sympathisch. Ping, Pong Pang sind jedoch nicht nur lustig und sympathisch: sie sind gefährliche Witzbolde mit nicht immer sichtbaren Henkerbeil.
Im zweiten Akt nehmen sie die strengen breiten Tuchgürtel ab, so dass das Dekolletee zum Vorschein kommt; fast könnte man annehmen, sie befänden sich in einem gemütlichen Club für Homosexuelle. Das macht sie ebenfalls sympathisch. Ping, Pong Pang sind jedoch nicht nur lustig und sympathisch: sie sind gefährliche Witzbolde mit nicht immer sichtbaren Henkerbeil.
In Tomo Sugaos Inszenierung wird auch deutlich, dass sexueller Mißbrauch auch gegenüber der Prinzessin Turandot, nicht nur ihrer Ahnin, widerfahren sein könnte. Ping, Pong und Pang stellen ihr nach, als sie durch ihre Gemächer streift, umgreifen sie ungefragt an der Taille. Frauen sind im Patriarchat nur Lustobjekte, selbst wenn sie ungestraft mögliche Heiratskandidaten umbringen (lassen dürfen). In dieser Oper geht es eben auch um Macht von Männern über Frauen.
Das große Kaiserreich China soll weiterbestehen – aber nicht allein mit Turandot

Dabei wird klar: es geht in Puccinis Oper Turandot nicht nur um Liebe. Es geht vor allem um Macht. Der Kaiser Altoum benötigt dringend einen Nachfolger, weshalb er froh ist, dass Prinz Calaf die drei Rätsel löst. Turandot selbst ist wie jedes Missbrauchsopfer hin- und hergerissen zwischen erlebten Traumata, dem daraus resultierenden Hass auf Männer und dem Rest-Glauben, dass es so was wie Liebe (in einer gleichberechtigten Partnerschaft) geben könnte. Bezeichnend, dass am Ende Calaf nur sich selbst feiert, während Turandot von der Bühne verschwindet. Dass der Regisseur hier vom Libretto abweicht, ist zu begrüßen. Diese Interpretation ist schlüssig und vermeidet das Rollenklischee einer immer liebenden, unterwürfigen Frau.
Stéphanie Müther als Turandot überzeugt an diesem Abend nicht ganz; sie schafft es nicht, die Ambivalenz von Turandot, nachdem Calaf gesiegt hat, sichtbar in Ton und Spiel darzustellen, sie bleibt kühl und zurückhaltend, feindlich. Ihre Stimme ist immer laut, ohne Facetten und mit zu viel Vibrato.
Auch wenn dies in der Partitur so angelegt ist, gilt im Gesang wie bei der Inszenierung: weniger wäre mehr gewesen. Dagegen hat Sae-Kyung Rim als Sklavin Liú auf voller Linie überzeugt. Die Dortmunder Philharmoniker bringen guten Klang, aber im gesamten ist die Musik zu laut.
Puccinis Absicht mit seiner Oper Turandot: kein Blockbuster sein
Puccini ging es bei seiner Musik nicht zwangsläufig um Bombast wie bei Soundtracks für Hollywood-Action- und Melodram-Filme üblich, sondern darum, das Seelenleben und die Gefühle, die aus der Erinnerung heraus entstehen, zu zeigen; also eben auch, zu welchen Handlungen früher erlebte Traumata führen können: Rache zu üben für das Leid der eigenen Vorfahren.
Das gesamte Sujet von „Turandot“ verleitet gern zur Übertreibung, die Musik Puccinis ist auch so angelegt, mit u.a. Streichersätzen einen vollen Klang zu erzielen. Allerdings müssten dann nicht noch goldene Drachen, keine drei Prinzessinnen und zusätzlicher Goldschmuck im Hintergrund auftauchen.
Die Dortmunder Inszenierung von Tomo Sugao erschlägt die KonzertbesucherInnen mit Bombast in Bild und Klang. Die Standing ovations waren nicht nachvollziehbar. Gewaltige Klänge und Bilder, Gewalt, die beeindruckt, aber auch abstößt, so wie es die Titelfigur der Oper auch tut. Schade nur, dass es an der (Kino-)Kasse kein Popcorn zu kaufen gab.
Laut dem Intendanten Heribert von Germeshausen war dies die fünfte von insgesamt acht Premieren. „Innovativ“ und „visionär“ sollten die Inszenierungen seiner Intendanz sein. „Turandot“ ist weder das eine noch das andere. Man darf gespannt sein, wie die letzten drei Inszenierungen sein werden.
- Rezension von opernmagazin.de hier.
- Kritik des Bayerischen Rundfunks hier.
- Kritik der Iserlohner Kreiszeitung hier.