
Von den „Unsichtbaren“ im Schatten der Gesellschaft ist die Rede. Von der Stadt unter der Stadt. Einer Parallelwelt, Schattenwelt. In ihr befinden sich jene, die du nie wirklich siehst, wenn du an ihnen vorübergehst. Oder nicht sehen willst. – Wie leben sie, was brauchen sie, wie kann ihre Lage verändert werden? Eine Studiengruppe an der FH Dortmund hat sich des Themas angenommen. Das Besondere: Obdach- und Wohnungslose sind nicht Gegenstand, Objekt der mit großem Engagement durchgeführten Untersuchung. Sondern die Wissenschaftler*innen und Studierenden haben ihnen zugehört. Es geht um die Perspektive der Betroffenen, ihre eigene Geschichte, ihr persönliches Leben auf der Straße, tagein tagaus.
Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwächsten umgeht
Wenn eine Gesellschaft daran zu messen ist, wie sie mit den Schwächsten umgeht, so wird niemand behaupten können, dass es irgendwo auf der Welt in einer größeren Community keinen Handlungsbedarf gäbe. Denn nahezu überall leben vermutlich Menschen über einen langen Zeitraum in einem Zustand der Machtlosigkeit. Etwa, weil sie ohne Obdach, jedenfalls ohne eigene Wohnung sind. ___STEADY_PAYWALL___

Wenn eine sichere Unterkunft, Wohnen in Würde zu den unveräußerlichen Menschenrechten gehört, dann liegt vieles im Argen, auch in der Bundesrepublik: 2018 waren hier nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. gut 678.000 Menschen ohne Wohnung, 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu diesem Hellfeld kommt eine Dunkelziffer, die definitionsgemäß niemand genau abschätzen kann.
Und neben den nackten Zahlen sind da vor allem die Menschen selbst. Schicksale, intime Gründe wie objektive Ursachen dafür, dass sie irgendwann einmal den Boden unter den Füßen verloren haben. Vor Jahren vielleicht schon. Um hier auf der Straße zu sterben. Oder wenig später in der Notaufnahme eines Dortmunder Krankenhauses.
Die Annäherung an die Gestrandeten, die mit einem offenen Ohr, sie ist immer verbunden mit ihren besonderen Geschichten, die sie zu erzählen haben. Wie alles kam. Wie es jetzt ist. – Oder zu erzählen hätten, fragte jemand danach. Was aber niemand tut, weil keiner herantritt. Weil „es“ nicht interessiert. Eigentlich stören sie die meisten nur; sie sind lästig.
Von den Namenlosen, die keiner sehen will, weil es sie eigentlich nicht geben dürfte
Szenenwechsel: Jedes Jahr verlas bislang – bis die Pandemie kam – der Dortmunder Oberbürgermeister in der Reinoldikirche bei einer schlichten Zeremonie wechselseitig mit einem evangelischen und katholischen Pfarrer die Namen der verstorbenen Unbedachten, quasi Namenlosen in der Stadt, mitsamt ihres Todesalters. Auffällig: Es waren hauptsächlich Menschen im Alter um die sechzig.

Und – gemessen am Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt – viele mit Vornamen, die in diesem Lande in den 50er und 60er Jahren vergeben wurden. Vorläufige Schlussfolgerung: Abgesehen davon, dass Großfamilien scheinbar vieles auffangen, wirst du ohne Angehörige, und dazu auf der Straße, nicht sonderlich alt.
Obdachlose seien offensichtlicher Teil unserer Städte, schreiben die Autor*innen einer jetzt veröffentlichten Studie, durchgeführt an der FH Dortmund. Ja, das sind sie. Doch eigentlich dürften sie gar nicht existieren, die Unsichtbaren, die keiner sehen will. Weil es sie eigentlich nicht geben darf im Sozialsystem des sog. Wohlfahrtsstaats. – Doch sie sind irgendwie durchgefallen. Durch unsere Sicherungsnetze, die offenbar zu großmaschig sind, als dass in einer erheblichen Anzahl von Fällen menschliche Kraft ausgereicht hätte, in ihnen Rettung, rechtzeitige Hilfe zu finden. Es stimmt also ersichtlich was nicht.
Untersuchungsdesign: Perspektiven der Betroffenen bilden den eigentlichen Fokus
Was ist das? Was müsste sich ändern? Die Wissenschaftler*innen von der FH hätten mit ihrer empirischen Untersuchung in Dortmund über die Interviews vor allem zwei Ziele verfolgt, erläutert Projektleiter Prof. Dierk Borstel vom Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften.

Wie viele Betroffene gibt es? Vor allem aber, zweitens, um zu erhellen: Was ist in der Vergangenheit passiert, dass sie irgendwann ihre Wohnung verloren? Was sind die Lebensverhältnisse dieser Menschen? Und am Ende: Welche Handlungsempfehlungen können aus den gewonnen Erkenntnissen an die Politik weitergereicht werden?
Das Besondere an diesem Teil: Hier sollten nicht schlicht objektiv Daten erhoben werden. Sondern es ging um die ausschließliche Perspektive jener, die tagein tagaus auf der Straße (üb-)erleben müssen. Eben um die Betroffenenperspektive. Darum, mit ihnen zu reden, statt über sie. Zuhören war angesagt.
Eine Herausforderung. Denn viele, so der Politikwissenschaftler von der FH, nähmen sich ob der unwürdigen Bedingungen in ihren konkreten Lebenswelten nicht mehr als Subjekt wahr. Also als das Ich, das ich bin. Das ich geworden bin, das träumt, vielleicht noch hofft, verzweifelt oder gar apathisch wurde. In einer Lebenswelt, in der es in erster Linie schlechterdings ums Überleben geht. – Möchten Wohnungs- oder Obdachlose überhaupt über diesen ihren Alltag zwischen den Häusern der Stadt berichten?
Obdach- und Wohnungslose Menschen bilden eine überaus heterogene Szenerie
Es sind an die 80 Studierende der Fachhochschule, die am 20. Mai letzten Jahres in Dortmund ausschwärmen – ehrenamtlich, d.h. ohne Vergütung oder Credit-Points im Studium. Und sie agieren nach einem Plan. Den hatten sie sich aber analog zum Untersuchungsdesign nicht einfach ausgedacht. Sondern er wurde im Vorfeld zusammen mit Obdach- und Wohnungslosen entworfen, weil deren Insiderwissen unersetzbar ist, wenn es darum geht, eine möglichst große Anzahl von ihnen anzutreffen, um sie zu interviewen.

Denn es war klar: Nur etwa zum Gasthaus, zur Kana-Suppenküche zu gehen oder mit dem Straßenmagazin bodo Kontakt aufzunehmen etc. – das würde nicht reichen. Weil nicht alle Obdachlosen an die Regelstrukturen der kommunalen und ehrenamtlichen Hilfsangebote angebunden sind. Außerdem: Die Szene sei ausgesprochen heterogen, bedeutet Tim Sonnenberg, Doktorand an der FH und Mitherausgeber des im Springer-Verlag erscheinenden Bandes über die Studie.
Da gäbe es den ehemaligen Arbeiter, der dem Strukturwandel zum Opfer gefallen ist, psychisch Erkrankte oder ehemalige jugendliche Straffällige oder aus dem Elternhaus Ausgerückte ebenso wie Zugewanderte aus Osteuropa (ein Ruhrgebietsspezifikum) und viele mehr.
In 12 Stunden konnten die Wissenschaftler*innen und Studierenden 609 Personen erreichen. 396 waren obdachlos, 13 wohnungslos (die in unsicheren Verhältnissen leben, indem sie bei Bekannten schlafen) und weitere an die 200 Menschen, die unmittelbar von Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit bedroht waren: in einer Wohnung ohne Strom, Tür o.ä.
Obdachlos zu werden, ist nicht schwer – es (nicht mehr) zu sein, hingegen sehr …
Die 1103 Postfächer hinzugenommen, die im letzten Jahr von Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege wie der Diakonie Obdachlosen zur Verfügung gestellt wurden, sowie angesichts des Umstandes, dass sie an dem Aktionstag viele Personen nicht hätten zählen können, so der FH-Doktorand, weil sie nicht reden wollten oder wegen Sprachbarrieren nicht konnten, andere erst gar nicht fanden: Ca. 1600 Personen, schätzt er, dürften es sein, die sich in Dortmund in dieser misslichen Lage befinden.

Was sie zumeist einte: frühe Brüche, eine zugespitzte biographische Krise, vielleicht eine Trennung, ein Todesfall in der Familie als Auslöser – bis das Wohnen nicht mehr funktioniert. Zwar sind in der nachfolgenden Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit die individuellen Lebenswelten wieder sehr unterschiedlich. Doch würden die betreffenden Menschen auf der Straße als eine Gruppe wahrgenommen, wiewohl sie häufig wenig miteinander zu tun hätten. Sicher: Eine Gruppe abgehauener Jugendlicher hat – neben der Straße – kaum was mit einer osteuropäischer Zugewanderter zu tun.
Doch klar ist auch: Die Spirale nach unten sei verhältnismäßig leicht zu durchlaufen, so Sonnenberg: da aber wieder raus zu kommen, das ist dann nahezu unmöglich. Und es wird in dem (wegen Corona) virtuellen Pressegespräch mit den Beteiligten ebenfalls deutlich, weshalb das so ist. Welche gleichsam „strukturellen“ Hindernisse dem im Weg stehen.
Alltägliche Lebensbewältigung und Diskrimierungserfahrungen: bei Behörden und auf der Straße
Ein offenbar entscheidender Punkt: die alltägliche Lebensbewältigung Obdachloser bindet all ihre Kräfte. Es ginge eben darum, kurzfristige Handlungsmuster zu realisieren, sagt Tim Sonnenberg. Wo kann ich betteln, wo übernachten oder mich waschen? Dazu kämen, ergänzt Dierk Borstel, vielfältige Diskrimierungserfahrungen.
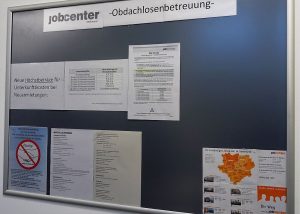
Ob im Umgang mit zu hohen Hürden staatlicher Hilfesysteme, also den (auch notwendig) bürokratisch handelnden Behörden. Ginge es um Würde, Autonomie, Sicherheit, entspräche vieles nicht den Vorstellungen Betroffener: sie fühlten sich eher verwaltet bis verwahrt denn, dass ihnen wirklich nach ihren konkreten Bedürfnissen geholfen würde.
Kritik an der Männerübernachtungsstelle wird in diesem Zusammenhang immer wieder laut; sie wird deshalb teils auch nicht angenommen. Allerdings: Interviews habe man an Ort und Stelle – trotz mehrfacher Anfrage – nicht führen dürfen, berichten die Akteure.
Oder da ist das Erleben von Ausgrenzung im öffentlichen Raum, auf der Straße selbst. Der sich eben spürbar verengt, fällst du aus den Normerwartungen heraus. Wenn jemand gezwungen ist, im Freien zu schlafen, solche Menschen in der Stadt aber immer wieder von warmen und relativ geschützten Plätzen vertrieben werden. Weil die wenigsten sie dort sehen wollen. Sei es vor der eigenen Haustür oder aus Angst vor Geschäftsschädigung, insbesondere im Innenstadtbereich.
Physische und psychische Folgewirkungen von Obdachlosigkeit
Hinzukommen Anfeindungen, bis hin zu direkter Gewalt; leider keine Seltenheit in dieser Schattenwelt. Oder Diebstahl untereinander. – Das Bild, das von den beiden Wissenschaftlern nach ihrer Interviewauswertung während des Gesprächs von dieser fast unsichtbaren „Stadt unter der Stadt“ andeutungsweise gezeichnet wird, wirkt bedrückend. Und die dortigen Zustände haben erhebliche Konsequenzen für die allermeisten Betroffenen.

Mindestens: hohe gesundheitliche Gefährdungen, starke psychische Belastungen. Alkohol und Drogen gehörten hier eher zur Bewältigungsstrategie, sagt Tim Sonnenberg, als dass sie ursächlich für den Verlust eines Zuhauses verantwortlich gewesen seien.
Und zwei weitere tendenzielle Folgewirkungen konnten die qualitativ arbeitenden Sozialforscher*innen von der FH nach den Interviews feststellen: das ist der Verlust von individuellen Fähigkeiten und, so ließe sich zusammenfassen, eine negativ gefärbte Attitüde gegenüber der sozialen Umwelt. Es fallen Begriffe wie Misstrauen, Hoffnungslosigkeit, Abschottung, schließlich eine fehlende Mitwirkungswilligkeit – zumindest wirke es bei den zuständigen Behörden häufig so. All das erschwere den Weg zurück ins Wohnen, erklärt der Professor.
Was nun tun, angesichts der Lage? – Handlungsempfehlungen für die relevanten Akteure
Hierin aber liegt offensichtlich der entscheidende Knackpunkt. – Es mag zwar kein richtiges Leben im falschen geben (Adorno). Aber wenn es nach dem Scheitern utopischer Entwürfe – der Möglichkeit nach – kein grundsätzlich besseres zu geben scheint, dann vielleicht wenigstens ein Leben, das etwas weniger falsch ist. Voraussetzung: eigener Wohnraum.

Das städtische Wohnraumvorhalteprogramm in Dortmund, das könne da nur als eine Übergangslösung figurieren, macht Dierk Borstel klar. Vielmehr ginge es um selbstständiges Wohnen unter menschenwürdigen Bedingungen. Das aber erfordere bezahlbaren Wohnraum. Der aber wird in der Stadt zunehmend rarer.
Einen wesentlichen Mechanismus, der ebenfalls Problemlösungen behindert, beschreibt Borstel so: „Man spart dort, wo der Widerstand am geringsten ist.“ Konkret: Es brauche Brücken zwischen dem bürokratischen System staatlicher Hilfen zu den Lebenswelten der Betroffenen. Die aber kosten Geld. Dort ein Mehr an Flexibilität, hier in einem stärkeren Maße qualifizierte Sozialarbeit, welche die Lücken füllen.
„Obdach- und Wohnungslosigkeit muss in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit stärker in den Fokus rücken – von der Jugendhilfe bis zur Justizsozialarbeit“, sagt Tim Sonnenberg. Aus den Lebensgeschichten der Betroffenen wurde gleichermaßen deutlich, an welchen neuralgischen Punkten, d.h. Risikofaktoren sinnvolle Präventionsarbeit geleistet werden könnte. Um es erst gar nicht soweit kommen zu lassen.
Am Ende ihrer Arbeit haben die Autor*innen schließlich Handlungsempfehlungen für ein Zusammenspiel von kommunaler Verwaltung, Sozialer Arbeit und ehrenamtlicher Hilfe ausgearbeitet. Näheres ist in der jetzt veröffentlichten Studie nachzulesen (s.u.).
Kommentar (Thomas Engel)
„Niemand muss in Deutschland auf der Straße leben“, zitieren die Autor*innen der TU-Studie einen jener Sätze, die den ideologischen Kernbestand von Konkurrenzgesellschaften variieren: Wer keinen Erfolg hat, ist ein Looser, jedenfalls selbst Schuld. Es hätte ja nicht so kommen müssen – bei hinreichender Leistung.
Hier wird eine vielleicht ach-zu-menschliche, aber falsche Annahme impliziert, die wie ein scheinbares Anthropologikum, also wie eine quasi zeitlose humane Konstante daherkommt, die vordergründig unser Dasein prägt: „Per aspera ad astra“, lautete sie vor 2000 Jahren in der Fassung Roms: „Durch das Raue zu den Sternen!“ Als käme ich durch Anstrengung zum Erfolg – im Extremfall wie in US-Ausnahmebiographien, aber eigentlichen Legenden: „Vom Tellerwäscher zum Millionär“.
Das erzähl‘ jetzt mal den vielen Kleinunternehmer*innen, deren hart erarbeitetes Lebenswerk sich gerade wegen Corona zielsicher in Luft auflöst. Und so ist es mit einem Menschen, der es irgendwann einfach nicht mehr weiter schafft – gleich wie viel Eigenverantwortung darin steckt, dass plötzlich der Boden unter seinen Füßen weg ist. Da sind dann eben keine Sterne mehr, sondern da winkt die Straße, auf die niemand freiwillig geht.
Hinzukommt: Persönlicher Einsatz, Energieaufwand ist nicht einmal unabdingbare Voraussetzung für ein Leben in gesicherten Verhältnissen. Erfolg, Wohlstand kann sich auch ohne jegliche Leistung einstellen. Siehe die Erb*innen von Millionen oder Milliarden, die für ihr Vermögen, das ihnen die Familie weiterreichte, nie einen Finger krumm machen mussten – gerade im bundesrepublikanischen Erbschaftssteuerparadies.
Doch selbst, wenn es Fakt wäre, dass hinter Erfolgslosigkeit, die zur Obdachlosigkeit führt, Leistungsdefizite stecken, gleich, weshalb, so begegnet einem hier immer noch ein klassischer normativer Fehlschluss: nämlich vom Sein aufs Sollen. Wenn die Welt so ist, wie sie ist, bedeutet das nicht, dass sie auch so sein soll. Hegel hätte gesagt: Um so schlimmer für die Wirklichkeit, Punktum! Einer Wirklichkeit auf der Straße, eines Menschen unwürdig, der ohne ein differenziertes Hilfssystem, das sich flexibel auf die konkreten Bedürfnisse und Lebenslagen Einzelner einstellen kann, ansonsten – aus eigenen Kräften und bedingt durch viele Teufelskreise – kaum noch zu entkommen ist.
Weitere Informationen:
- „Die ‚Unsichtbaren‘ im Schatten der Gesellschaft – Forschungen zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit am Beispiel Dortmund“ (erschienen bei Springer: ISBN 978-3-658-31262-6)
Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:
„Winternothilfe am Dortmunder U“ bietet Obdachlosen ab Montag einen Platz zum Aufwärmen und Essen



