
Die neue Sonderausstellung im Dortmunder U ist eine Entdeckungsreise zu weiblichen Positionen zweier besonderer Kunstrichtungen: Das Museum Ostwall (MO) im Dortmunder U zeigt ab sofort und noch bis März nächsten Jahres Werke von 30 Künstlerinnen aus zwei Epochen des 20. Jahrhunderts. Was haben uns diese teilweise unbekannten Frauen heute zu sagen und warum blieb ihr Werk bisher verborgen?
Nur 12 Prozent der Künstler:innen der MO-Sammlung sind weiblich

Man sieht nur, was man weiß – sagte Johann Wolfgang von Goethe und meinte damit, dass uns meist nur Dinge auffallen, die wir bereits kennen. Was das mit der neuen Ausstellung im MO im Dortmunder U zu tun hat?
„Man findet nur, was man sucht“, sagt Nicole Grothe, Leiterin der Sammlung und beschreibt damit einen veränderten Ansatz bei der Konzeption von Ausstellungen allgemein und im MO speziell.
Nur 12 Prozent der Künstler:innen in der Sammlung sind weiblich, sieben Prozent der Werke von Frauen – und das, obwohl die Sammlung 1949 immerhin von einer Frau, der Gründungsdirektorin Leonie Reygers, aufgebaut wurde.
Der Zeitgeist war ein anderer, gesammelt wurde vorwiegend „weiß und „männlich“ – aber eben nicht nur. ___STEADY_PAYWALL___
Neue Blickwinkel: Wer sucht, der findet auch!
Für die neue Ausstellung sollte ein anderer Blickwinkel maßgebend sein und siehe da: wer sucht, der findet auch. „Wenn man nicht nur nach den bekannten Masterpieces fragt, nicht mehr nur in Chronologien denkt, sondern nach Themen sucht, dann kommt man auch zu neuen Entdeckungen“, berichtet Grothe.

Der Fokus eine Ausstellung ausschließlich mit Künstlerinnen zu machen, brachte einige Schätze ans Licht.
Die freien Kuratorinnen Stefanie Weißhorn-Ponert und Anna-Lena Friebe haben im Bestand des Museums geforscht und auch darüber hinaus. Und weil die Sammlungsschwerpunkte Expressionismus und Fluxus sind, ist es eben diese Kombination, die nun in einer gemeinsamen Ausstellung präsentiert wird.
Das leuchtet zunächst nicht unbedingt ein, spielt aber keine Rolle, denn es sind die Themen und Anliegen der Künstlerinnen, die die zwei Teile der Ausstellung zusammen halten.
Unbekannte Künstlerinnen und Berühmtheiten zu Lebzeiten
Vom Eingang nach rechts geht es zunächst zu den Expressionistinnen. Acht Künstlerinnen gibt es zu entdecken, die mit acht verschiedenen Techniken gearbeitet haben. Zu sehen sind Werke mit „vermeintlich weiblichen Werkstoffen“ (Weißhorn-Ponert) wie Keramik oder Textil, aber auch Film und Fotografie sind vertreten.

Die Arbeiten von Emma Schlangenhausen aus der MO-Sammlung waren noch niemals ausgestellt und auch die Bildhauerin Renée Sintenis (1888-1965) blieb eher unbekannt, obwohl ihr kleiner Bär die Vorlage für den Filmpreis der „Berlinale“ war.
Die Malerin Else Berg ist zumindest in den Niederlanden keine Unbekannte – sie gehörte dort bereits zu Lebzeiten zu den führenden Expressionist:innen, wurde aber 1942 zusammen mit ihrem niederländischen Ehemann im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von den Nationalsozialisten ermordet.
Mehr Sichtbarkeit und Respekt für die Kunst von Frauen
Von Raum zu Raum geht es weiter mit den Neu- und Wieder-Entdeckungen. Lotte Reininger schuf mit ihren Scherenschnitten lange vor Walt Disney den ersten animierten Spielfilm.

„Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ entstand 1926 und bezaubert bis heute. Auch er ist allerdings ein Kind seiner Zeit und das Museum zeigt ihn in der Ausstellung entsprechend kontextualisert mit Hinweis auf darin zum Ausdruck kommende Orient-Stereotypen.
Auf ausdrucksstarke Tanzfotografie der Wienerin Madame d’Ora, folgen zauberhafte Keramikwesen von Kitty Rix und ihrer Lehrerin Vally Wieselthier.
Auf ein Zitat von Wieselthier geht übrigens auch der Titel der Ausstellung zurück: „Tell these people who I am“ (Sagt diesen Menschen, wer ich bin) formuliert sie Ende der 1930er Jahre selbstbewußt die Forderung nach mehr Sichtbarkeit und Respekt für sich und ihre Kunst.

Ein mühsames Unterfangen – das lernen die Besuchende spätestens im Gang, der die beiden Ausstellungsteile verbindet.
An der Wand befindet sich die Grafik einer Kunstgeschichte aus weiblicher Sicht und wir lernen zum Beispiel: Erst 1919 wurden Frauen gesetzlich zu deutschen Kunstakademien zugelassen. Im selben Jahr wird dann Käthe Kollwitz erste Professorin an der Akademie in Berlin.
1901 gründet Berthe Weil in Paris als erste Frau eine Galerie. Über 40 Jahre später ist es Peggy Guggenheim, die in ihrer Galerie in New York eine Ausstellung ausschließlich mit Künstlerinnen zeigt.
Fluxus-Frauen: Zwischen Muse und Selbstbestimmung
Und dann? In den 1960er und 70er Jahren? Vietnamkrieg, Studentenproteste, Frauenbewegung und: Fluxus. Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „fließend“. Zwischen Werk und Aktion, zwischen Kunst und Leben sind die Übergänge fließend. Auch die Frauen setzen auf Aktion.

Charlotte Moorman spielt nackt Cello für eine Performance mit dem Künstler Nam June Paik: „Oft wird sie als seine Muse bezeichnet, dabei war sie eine eigenständige Künstlerin“, sagt Kuratorin Anna-Lena Friebe. So geht es einigen der Künstlerinnen, aber zumindest Yoko Ono ist heute in der öffentlichen Wahrnehmung mehr als nur die Frau von John Lennon.
Carolee Schneemann beklagte „Fluxus can be lots of fun when the boys let you on the boat“ (Fluxus kann viel Spaß machen, wenn die Jungs einen ins Boot lassen) – wer mit ins Boot kam, war also offenbar noch immer Entscheidung der Männer. Machtfragen, Freiheitsrechte – die Fluxusfrauen wollen sich befreien und hinterfragen Mutterschaft, Hausfrauendasein und wirtschaftliche Abhängigkeit.
Häufig gehen sie an Grenzen, auch ihre eigenen, häufig mit vollem Körpereinsatz. Es geht um Gewalterfahrung und Protest – und das ist auch heute leider noch aktuell. Die Installation „El Tendedero“ (Die Wäscheleine) von Mónica Mayer verbindet Kunst und gesellschaftspolitische Analyse. Sie befragte 1977 Frauen zu ihrem Leben, zu Gewalterfahrungen und diesen Prozess setzt die Ausstellung fort. Die aktuellen Antworten von Dortmunderinnen werden fortlaufend ergänzt und sind an der Wäscheleine nachzulesen.
Plädoyer für einen kuratorischen Aktivismus im Kunstbetrieb
1993 gab es die erste große Gruppenausstellung ausschließlich mit Künstlerinnen im Museum (am) Ostwall. Über 30 Jahre später folgt nun also die zweite. Das ist wenig, einerseits – und andererseits: Ist eine Ausstellung nur mit Frauen angesichts aktueller Genderdebatten noch der richtige Fokus?

„Die fluiden Grenzen zwischen den Geschlechtern sind ja kein neues Phänomen“, erklärt MO-Direktorin Regina Selter. 1972 klebte sich Ana Mendieta die abgeschnittenen Barthaare eines Freundes ins Gesicht und sorgte für Irritation. Auch das Bild ist ein Teil der Ausstellung.
Und die Expressionistinnen? Sie lebten teilweise in lesbischen Beziehungen, gingen Scheinehen ein, um reisen zu können, wollten vielleicht gar nicht als weiblich gelesen werden – „wir wissen nicht viel, über diese Künstlerinnen“, so Selter und ist dafür, die Kategorie „Frau“ zunächst beizubehalten, um den grundsätzlichen Anliegen Gehör zu verschaffen.
Auch Nicole Grothe plädiert für einen „kuratorischen Aktivismus, um gegen die Benachteiligung marginalisierter Gruppen im Kunstbetrieb vorzugehen.“ Bis das „historisch gewachsene Ungleichgewicht“ behoben und die „Lücken in der Sammlung“ geschlossen sind, ist es ohnehin noch ein weiter Weg. Diese Ausstellung ist also Teil eines Prozesses und man darf gespannt sein, welche Schätze sich noch in den Archiven finden – wenn man die richtigen Fragen stellt.
KURZINFO
„Tell these people who I am. Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus“, Museum Ostwall im Dortmunder U, bis 23. März 2025
Öffnungszeiten: Di, Mi, Sa, So und an Feiertagen: 11 bis 18 Uhr, Do und Fr: 11 bis 20 Uhr
Weitere Infos auf der Website des Museums
Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

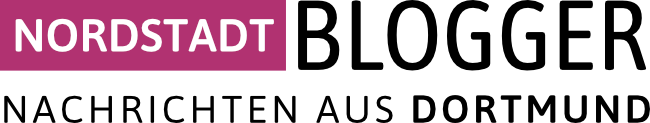
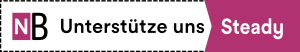


Reaktionen
Globale Performance: „Transcolor 1“ verbindet Fluxus und Gegenwart im Dortmunder U (PM)
Am Samstag, 30. November, um 15 Uhr präsentiert die Künstlerinnengruppe Las Malchehas im Dortmunder U die Performance „Transcolor 1“. Mit Livestreams aus Japan, Mexiko und Dortmund wird die globale Perspektive von Fluxus erlebbar.
„Transcolor 1“ bringt die globale Perspektive von Fluxus in die Gegenwart. Die Künstlerinnengruppe Las Malchehas – bestehend aus Freyda Adame, Mar Atzin und Gabriella Nataxa García González – realisiert die Performance zeitgleich an drei Orten: Japan, Mexiko und Dortmund. Über Livestream werden die drei Schauplätze miteinander verbunden und machen die Performance im Museum Ostwall im Dortmunder U erlebbar. Mit Eintritt zur Sonderausstellung ist die Teilnahme kostenfrei.
Die Performance basiert auf einer Handlungsanweisung des Fluxus-Magazins Womens Work von Alison Knowles und Annea Lockwood. Damit knüpfen die Künstlerinnen an die Ausstellung „Tell these people who I am – Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus“ an und führen die interaktive und experimentelle Praxis von Fluxus in zeitgenössischer Form fort.
Die Künstlerinnen: Las Malchehas
Freyda Adame (*1991, Mexiko) verbindet in ihrer Kunst die Erforschung des verkörperten Erbes und die Auseinandersetzung mit sozialen und biologischen Identitäten.
Mar Atzin (*1989, Mexiko-Stadt) beschäftigt sich mit kultureller Identität und interaktiver Kunst. Sie lebt seit 2022 in Deutschland und kombiniert Multimedia-Ansätze mit Szenografie.
Gabriella Nataxa García González (*1984, Mexiko-Stadt) lebt seit 2024 in Tokio. Ihre Werke hinterfragen die Linearität des Lebens und erforschen die täglichen Arbeitsprozesse der Menschen.
Expressionismus und Fluxus: Künstlerinnen im Fokus des Museums Ostwall
Die Sonderausstellung „Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus – Tell these people who I am“ präsentiert Arbeiten von 30 Künstlerinnen aus zwei Epochen des 20. Jahrhunderts. Während der Teil „…ein selbstverständliches inneres Müssen“ acht Expressionistinnen und ihr Streben nach einem erweiterten Kunstbegriff zelebriert, beleuchtet der Abschnitt Fluxus und Feminismus die Herausforderungen und Erfolge von Künstlerinnen in einer von Restriktionen geprägten Ära.
dortmunder-u.de/museum-ostwall
Das fahrende Kino ist unterwegs: Filme von Fluxus-Künstlerinnen und Filmpionierinnen flackern über Hauswände (PM)
Am Freitag, 6. Dezember, bietet das Museum Ostwall eine besondere Filmvorführung an Dortmunder Hauswänden: Gezeigt werden ab 18 Uhr unter anderem Filme von Yoko Ono, Lotte Reiniger, VALIE EXPORT und der Dortmunderin Elisabeth Wilms.
Kunst für alle draußen und umsonst: Mit einem fahrenden Kino werden Filme von frühen Filmpionierinnen und Fluxus-Künstlerinnen an die Häuserwände der Dortmunder Innenstadt projiziert. Gezeigt werden Filme von Yoko Ono, Lotte Reiniger, VALIE EXPORT und der Dortmunderin Elisabeth Wilms. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Stadtgarten (Hansastraße / Ecke Prinzenstraße).
Das Filmprogramm im Einzelnen:
Luxus ist Fluxus
VALIE EXPORT, Die süße Nummer. Ein Konsumerlebnis, 1968, 6 Minuten
VALIE EXPORT, Adjungierte Dislokation, 1978, 8 Minuten
Rebecca Horn, Einhorn, 1970, 4 Minuten
Rebecca Horn, Körperfächer, 1973, 7 Minuten
Rebecca Horn, Hahnenmaske, 1973, 2 Minuten
Rebecca Horn, Bleistiftmaske, 1973, 6 Minuten
Ana Mendieta, Silueta Series, 1974, 4 Minuten
Ana Mendieta, Birth (Gunpowder), 1980, 3 Minuten
AK Dolven, I hold your head in my hands, 1999, 4 Minuten
Anna Maria Maiolino, Verso-Inversus, 1979, 3 Minuten
Anna Maria Maiolino, In-Out (Antropofagia), 1973/74, 8 Minuten
Sanja Ivekovic, Personal Cuts, 1982, 4 Minuten
Yoko Ono, Eye Blink, 1966, 1 Minute
Stummfilmnaschen
André Heuzé, Der Streik der Ammen (Grève des Nourrices), 1907, 12 Minuten
unbekannt, Madame hat Gelüste (Madame a des envies), 1906, 4 Minuten
Elisabeth Wilms, Der Weihnachtsbäcker, 1943, 12 Minuten
Lotte Reiniger, Das Ornament des verliebten Herzens, 1919, 5 Minuten
Der Eintritt ist frei, das Filmprogramm dauert insgesamt ca. 1,5 Stunden.
Zur Ausstellung „ ‚Tell these people who I am‘ – Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus“ gibt es viele passende Veranstaltungen, die sich kreativ der Ausstellung und damit zwei wichtigen Kunstrichtungen nähern. So wird die Ausstellung für alle zur spannenden Entdeckungsreise durch zwei bedeutende Kunstrichtungen.
Künstlerisch gestalten: Museum Ostwall lädt ein ins Fotoatelier (PM)
Am 7. Dezember lädt das Museum Ostwall von 14 bis 17 Uhr zu einer Kreativaktion ein. Inspiriert von der Ausstellung „Tell these people who I am“ können Erwachsene im Fotoatelier selbst kreativ werden. Mit Eintrittskarte ist die Teilnahme kostenfrei.
Das Museum Ostwall im Dortmunder U bietet am Samstag, 7. Dezember von 14 bis 17 Uhr ein Fotoatelier für Erwachsene an. In Verbindung mit der Sonderausstellung „,Tell these people who I am‘ – Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus“ werden die Teilnehmenden selbst kreativ und erkunden fotografische Ausdrucksmöglichkeiten. Die Aktion ist mit Eintrittskarte kostenfrei. Eine Anmeldung ist per E-Mail an mo.bildung@stadtdo.de erforderlich.
Über die Ausstellung
Die Sonderausstellung des Museums Ostwall erforscht Leerstellen im Sammlungsbestand und präsentiert Werke von 30 Künstlerinnen, die wichtige Impulse im Expressionismus und Fluxus gesetzt haben.
Drucken wie die Expressionistinnen (PM)
Das Museum Ostwall im Dortmunder U zeigt Positionen von Künstlerinnen im Fluxus und Expressionismus. Die „Druckwerkstatt für Familien“ inspiriert am Samstag, 21. Dezember, ab 14 Uhr dazu, eigene Kunstwerke zu fertigen.
Zur Ausstellung „,Tell these people who I am‘ – Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus“ gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Workshops und Aktionen, die sich mit viel Spaß und Kreativität den Positionen und Werken der Künstler*innen nähern. Die „Druckwerkstatt für Familien“ am Samstag, 21. Dezember, inspiriert dazu, eigene Kunstwerke zu fertigen, Fotos oder Drucke, Typographie oder Linolschnitt. Ganz wie die Expressionistinnen können Familien hier unterschiedliche Techniken selbst ausprobieren und dabei mehr über die Kunstform erfahren. Unterschiedliche Drucktechniken werden vorgestellt, anschließend gibt es die Möglichkeit, kreativ mit den Entwürfen zu experimentieren (auch am 15. März 2025). Von 14 bis 17 Uhr, mit Eintrittskarte kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten unter mo.bildung@stadtdo.de.
Vergessene Stimmen des Expressionismus: Vortrag beim „Kleinen Freitag“ im Dortmunder U (PM)
Am Donnerstag, 20. März um 19 Uhr widmet sich der Kleine Freitag der expressionistischen Literatur. Dr. Sandra Beck beleuchtet die oft übersehenen Autorinnen dieser Epoche und zeigt auf, wie sie zur literarischen Vielfalt des Expressionismus beigetragen haben.
Die Anthologie „Menschheitsdämmerung“ (1919), herausgegeben von Kurt Pinthus, prägte lange Zeit das Bild der expressionistischen Lyrik. Sie gilt als Standardwerk dieser literarischen Strömung, doch sie zeigt nur einen Teil des Gesamtbildes. Unter den zahlreichen vertretenen Dichter*innen fand sich mit Else Lasker-Schüler lediglich eine Frau – obwohl es viele weitere Autorinnen gab, die in Vergessenheit gerieten.
Ein Abend zur Wiederentdeckung weiblicher Expressionistinnen
Der Vortrag von Dr. Sandra Beck, in Kooperation mit dem Fritz-Hüser-Institut, gehört zum Rahmenprogramm der Sonderausstellung „Künstlerinnen in Expressionismus und Fluxus – Tell these people who I am“ des Museum Ostwall. Er rückt die vernachlässigten Stimmen expressionistischer Autorinnen in den Fokus und geht der Frage nach, warum ihre Werke lange Zeit übersehen wurden.
Die Veranstaltung findet auf der Sonderausstellungsfläche, Ebene 6 im Dortmunder U, statt. Bitte vorab anmelden: kleinerfreitag@stadtdo.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.
dortmunder-u.de/kleiner-freitag/