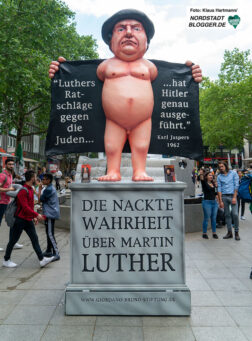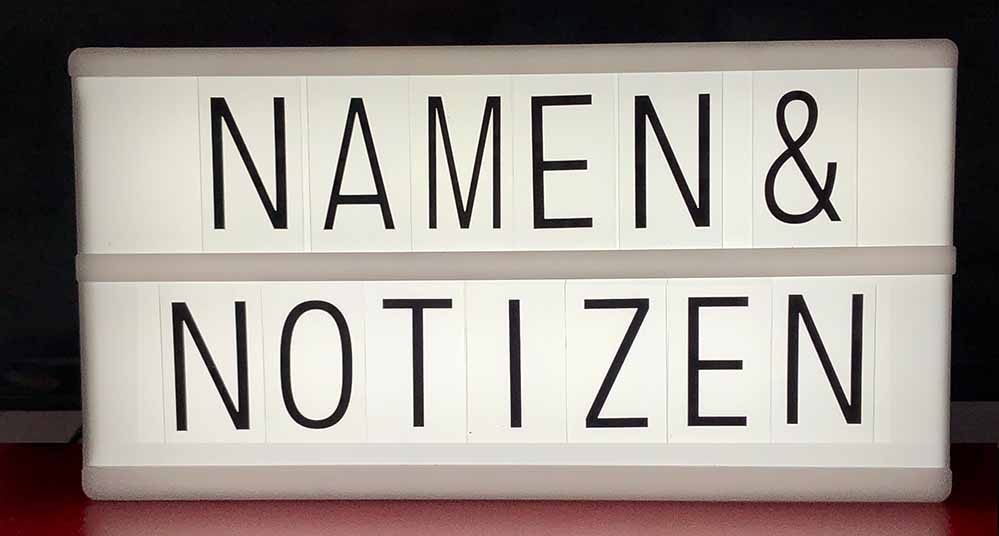 Zum Kirchentag hat sich in der Redaktion einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten angesammelt, die nicht alle den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, diese in unserer Rubrik „Namen und Notizen“ zu veröffentlichen.
Zum Kirchentag hat sich in der Redaktion einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten angesammelt, die nicht alle den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, diese in unserer Rubrik „Namen und Notizen“ zu veröffentlichen.
Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“.

Der Traum vom Reich Gottes
Feierabendmahl und Politisches Nachtgebet in der Pauluskirche
Drei Tage lang sind Luna und Cuzco von Münster aus nach Dortmund zum Kirchentag gewandert. Die beiden Lamas waren die vielbeachteten Stars beim Feierabendmahl und politischen Nachtgebet im Kirchgarten der Pauluskirche an der Schützenstraße. Mehrere hundert Teilnehmende drängten sich hier bei Brot und Wasser, Wein und Leckereien an den Tischen.
„Die Güter des Lebens – geschenkt, geteilt, gefährdet“ war das Motto des Feierabendmahls. Es thematisierte die Bedrohung des Lebens durch den Klimawandel und plädierte für den Widerstand gegen wirtschaftliche und politische Formen der Gewalt gegenüber allem Lebendigen auf der Erde. „Feiern, nachdenken und zu Kraft kommen“, wolle man, sagte Pfarrer Friedrich Laker bei der Begrüßung. Denn diese Kraft brauche man, um sich für das Leben zu engagieren. „Wenn wir so weitermachen wie wir das jetzt tun, dann ist der Menschheit nicht mehr zu helfen.“
Eingeladen zu dem Abend hatten die Gemeingüterinitiative von Pauluskirche und Kultur gemeinsam mit der „Aktion Kirche und Tiere“, der Gesellschaft für eine Glaubensreform und dem Bund religiöser Sozialistinnen und Sozialisten. Alle drei Einlader plädierten in ihren Statements für einen Paradigmenwechsel. Aus Luthers Gnadenlehre folge, dass „Gottes Güter“ Gemeingut seien. Doch jetzt verfügen große Konzerne über die Lebensgüter. Ein gutes Leben für alle bedeute, „den Kapitalismus in seiner jetzigen Form zu überwinden.“
Die aktuelle Krise, so Pfarrer Laker, sei gegründet im System, in unserer Geisteshaltung und in der Macht des Kapitals. Doch es erwachse das Bedürfnis nach neuen Formen des Zusammenlebens. Das seien „Lichtblicke“. „Wir haben den Traum“, sagte Pfarrerin Sandra Laker, „dass wir die Klimakatastrophe noch aufhalten können.“ Und, so ergänzte sie, wir haben den Traum „vom Reich Gottes“.
Das Nic Koray Duo (Gitarre und Kontrabass) sowie Sabine Lindner (Harfe und Flöten) haben das Feierabendmahl musikalisch begleitet und zum direkt anschließenden Konzert eingeladen.

Sozialdezernentin Birgit Zoerner diskutiert zum Thema Flüchtlinge. Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Flüchtlinge aufnehmen – sichere Häfen schaffen Politisches Nachtgebet in St. Reinoldi mit Sven Giegold Die Orientierung der EU-Länder an europäischen Werten und an europäisches Recht fordert Sven Giegold. Der Europaparlamentarier und Mitglied des Präsidiums des Kirchentags sprach beim Politischen Nachtgebet in St. Reinoldi. Am Internationalen Tag des Flüchtlings waren in der Dortmunder Stadtkirche mehrere hundert Kirchentagsteilnehmende zusammengekommen. Giegold beklagte, dass viele europäische Länder nicht bereit seien, Flüchtlinge aufzunehmen. „Europa soll selbst die Seenotrettung übernehmen.“ Unklar sei es, ob diese Position im EU-Parlament eine Mehrheit finde. Eine Sofortforderung, so Giegold, sei es, Häfen zu öffnen, um die vor einer Woche von der „Seawatch 3“ geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. 60 Städte in Europa hätten sich zu „sicheren Häfen“ erklärt. Doch die jeweiligen Regierungen würden die Aufnahme von Flüchtlingen verweigern, klagte Christina Biere, Regionalpfarrerin des Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung. Martin Kolek, ehemaliger 1. Offizier der „Sea-Watch“ erinnerte daran, dass „in diesem Augenblick Fluchtboote im Mittelmeer sind“. Einschneidendes Erlebnis war für ihn die Bergung von ertrunkenen Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Das Politische Nachtgebet war zugleich Start von „Jeder Mensch hat einen Namen“. Es ist eine gemeinsamen Aktion mit der Seebrücke und dem Schauspiel Dortmund. Rund 36.000 Tote sind seit 2002 an den europäischen Außengrenzen zu beklagen. Als Mahnung und Aufforderung sollen die Namen möglichst aller im Laufe der nächsten Tage auf dem Platz der alten Synagoge auf große Transparente geschrieben werden. Sie werden am Samstag an St. Reinoldi aufgehängt. Zuvor gibt es eine Kundgebung (17 Uhr) und einen Trauermarsch (18 Uhr) zur Reinoldikirche. Foto: Evangelischer Kirchenkreis

Beeindruckendes Projekt
Ambulanzboot für Bolenge/Kongo
Von einer Erfolgsgeschichte berichtete Dr. Yoursen Bosolo (auf unserem Foto in der Bildmitte) auf dem Kirchentag. Dr. Bosolo ist Arzt. Genauer: Arzt auf einem Ambulanzboot, das seit 2011 Dörfer entlang des Kongoflusses medizinisch versorgt. Seither hat er auf 43 Bootstouren rund 60.000 Behandlungen und 2.000 Operationen durchgeführt. Das „Ambulanzboot“ ist ein gemeinsames Projekt des Dortmunder Kirchenkreises mit dem World Wide Fund For Nature (WWF) und wird unterstützt von der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) und dem Medikamentenhilfswerk action medeor e.V.
Die krisengeschüttelte Äquatorregion im Dortmunder Partnerkirchenkreis Bolenge (Kongo) zählt zur ärmsten in Afrika. „Die dortigen Dörfer“, erzählte Pfarrerin Dorothea Philipps , die sich bei dem Projekt „Ambulanzboot“ engagiert, „hatten noch nie einen Arzt gesehen.“ Die Konsequenz: Menschen sterben hier an gut zu behandelnden Krankheiten wie Malaria, Durchfall oder Geschlechtskrankheiten.
Dr. Bosolo hatte nach seinem Medizinstudium auf gut bezahlte Anstellungen verzichtet. Er wollte dorthin gehen, „wo Gott mich braucht“. Unterstützt von einer großen Spendenaktion in Dortmund konnte 2011 das Ambulanzboot gebaut werden. Seither kümmert sich ein engagiertes Team aus zwei Ärzten, einer Hebamme, zwei Krankenpflegern, einem technischen Helfer und zwei Expertinnen für Familienplanung um die ärztliche Versorgung an den Flüssen Kongo, Ubangi und Ngiri.
Der WWF unterstützt das Projekt finanziell, denn, so Thomas Breuer: „Wir können dort keinen Naturschutz betreiben und die Menschen leben ringsum in Armut.“ Medikamente in guter Qualität stammen von medeor e.V.
Rund 10.000 Dollar kostet eine Tour des Ambulanzbootes. Finanziert wird sie ausschließlich aus Spenden, hauptsächlich aus Dortmund. Pfarrer Ulf Schlüter, theologischer Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Westfalen und ehemaliger Superintendent des Dortmunder Kirchenkreises: „Es ist ein unglaublich beeindruckendes Projekt.“
Foto: Evangelischer Kirchenkreis

Einsätze während des Kirchentags: Der Betriebshandwerkliche Dienst hat Schulen mit weiteren Rauchwarnmeldern ausgestattet Vom 19. bis 23. Juni 2019 ist Dortmund Schauplatz einer der größten Veranstaltungen, die die Stadt seit langem gesehen hat: Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag verwandelt die City und ihre Stadtteile in einen Schmelztiegel von über 100.000 Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen, die an diesen fünf Tagen ein Fest des Glaubens feiern und sich über die wichtigen Fragen der Zeit austauschen. Wir stellen Ihnen – stellvertretend für die vielen Tausend haupt- und ehrenamtlichen Helfer*innen – Menschen vor, die mit viel Herzblut und ihrem Einsatz bei städtischen und angegliederten Institutionen dafür sorgen, dass das Großereignis ein Erfolg wird. „Wir sind jetzt hier im Abschnitt D und gehen dann noch den Flur herunter“, die beiden Mitarbeiter*innen des Betriebshandwerklichen Diensts haben nur einen kurzen Augenblick Zeit, einen Rauchwarnmelder anzubringen und ihn zu testen. Sie bringen im Heinrich Heine Gymnasium die letzten von Tausenden zusätzlichen Rauchwarnmeldern an. „Das war schon eine Hausnummer. Allein die Stückzahl und die Organisation drum herum“, erklärt Martin Kreutzkamp. Er ist beim Betriebshandwerklichen Dienst für den Bereich Elektrotechnik zuständig. Als Teamleiter hat er sich freiwillig gemeldet und das Anbringen der Rauchwarnmelder geplant. Seine Aufgabe ist es, Schnittstelle für Feuerwehr, Veranstalter, Hausmeister zu sein. „Die Feuerwehr macht die Sicherheitskonzepte, die wir einhalten müssen, der Kirchentag ist jedoch Veranstalter und daher für die Materialbeschaffung zuständig. Die Hausmeister kennen die Räumlichkeiten der Schulen und müssen uns auch Zutritt ermöglichen.“ Insgesamt lieferte der Kirchentag über 5200 Rauchwarnmelder, die Kreutzkamp und sein Team in den Schulen Dortmunds angebracht haben. Planung für reibungslosen Ablauf Rund 30 Mitarbeiter*innen des Betriebshandwerklichen Dienstes haben in den Osterferien, innerhalb von 8 Tagen die zusätzlichen Rauchwarnmelder angebracht, „Es sind alle Werkstätten dabei, insgesamt haben 13 Teams alle Stadtbezirke abgedeckt. Da hatten wir schnell 1.000 Kilometer auf dem Tacho.“ Rauchwarnmelder mussten in allen Räumen angebracht werden, die vom Kirchentag genutzt werden, zusätzlich in Treppenhäusern und Fluren. „In der größten Schule, die ziemlich verwinkelt ist, haben wir alleine 300 Melder gebraucht.“ Für einen reibungslosen Ablauf verlangte es viel Vorarbeit: Herr Kreutzkamp musste Sicherheitskonzepte und Gebäudepläne sichten, Ansprechpartner herausfinden und Kontaktdaten sammeln. Dafür stand er viel im Kontakt mit Wolfang Schulz vom Fachbereich Schule, der aufgrund jahrelanger Erfahrungen die Schulgebäude kennt und mit verschiedenen technischen Ämtern vernetzt ist. „Der Austausch zwischen Kirchentagsmitarbeiter*innen und städtischen Kolleg*innen hat wunderbar funktioniert“, so Martin Kreutzkamp Nicht nur anbringen, auch wieder demontieren Um seinen Mitarbeiter*innen die Arbeit zu erleichtern, hat Kreutzkamp pro Schule eine Handakte angelegt, Bedarfe ermittelt und ausgearbeitet, wo ein Rauchwarnmelder platziert werden muss. „über 5.200 Mal hieß es für uns Batterien in den Rauchwarnmelder einsetzen, Leiter rauf, Magnetbefestigung anbringen, Rauchwarnmelder anbringen, Rauchwarnmelder testen und auf das Alarmsignal warten, Leiter wieder runter. Nach dem Kirchentag steht das Ganze noch einmal, in umgekehrter Reihenfolge an.“ Die Rauchwarnmelder sind Eigentum des Kirchentages und müssen nach der Veranstaltung durch die Kolleg*innen des Betriebshandwerklichen Dienstes wieder demontiert und nach Frankfurt geschickt werden, wo 2021 der Kirchentag stattfindet. Doch auch während des Kirchentags ist der Betriebshandwerkliche Dienst aktiv: Einige Kolleg*innen haben ab Dienstag 24 Stunden Rufbereitschaft „für den Kirchentag haben wir neben der klassischen Bereitschaft weitere Kolleg*innen eingesetzt, die bei Problemen an den Gebäuden zur Behebung zu Verfügung stehen. Etwa, wenn ein Fenster zu Bruch geht oder die Sanitäranlagen Schwierigkeiten bereiten.“Foto: Stadt Dortmund/Katharina Kavermann

„Ich wusste, wer die Mörder sind“ Kirchentag zeigte „NSU-Monologe“ im Schauspielhaus Zehn Morde werden dem Nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU, zugeschrieben. Eines der Opfer ist der Dortmunder Mehmet Kubasik. Lange ermittelten die Behörden in die falsche Richtung. Neun Tote und elf Jahre brauchte es, bis die Polizei die Serie der Morde als rechtsradikal motiviert begriffen. Die im Dortmunder Schauspiel gezeigten „NSU-Monologe“ berichten um den Kampf der Angehörigen um die Wahrheit. Das Stück, recherchiert und aufgeführt von der „Bühne für Menschenrechte“, stellt die Perspektive der Opfer in den Mittelpunkt. Die Darstellenden repräsentieren die Ehefrau von Enver Simsek, den Vater von Halit Yozgat und die Ehefrau vom Mehmet Kubasik. Im Vorfeld der Aufführung hatte die „Bühne für Menschenrechte“ Interviews mit den Angehörigen geführt. Die Schauspielerinnen und der Schauspieler haben diesen Aussagen in ihrem Stück nichts hinzugefügt, nichts erfunden – „wortgetreues Theater“, so das Stichwort. Sie erzählen die Geschichte der Opfer und deren Angehörigen. Spüren der Frage nach, was deren Liebe zusammenhielt, schildern die Emigration nach Deutschland und den Aufbau einer neuen Existenz. „Wir haben an Deutschland geglaubt“, so Yozgat. „Das Gefühl stellte sich ein, wir sind hier in Sicherheit“, ergänzt Kubasik. Dieses Gefühl war trügerisch. Am 4. April 2006 wurde er in seinem Kiosk im Dortmunder Norden ermordet. „Es war wie ein Untergang.“ Schlimmer: Die Ermittlungsbehörden unterstellten Kontakte zur Mafia, beschuldigten Simseks Frau, ihren Mann umgebracht zu haben. Auch bei Yozgat: „In unserer Familie suchten sie den Mörder gesucht.“ Telefonate wurden abgehört, die Angehörigen bei Verwandtenbesuchen und selbst bei der Beerdigung überwacht. „Ich bin depressiv geworden,“ sagt Simsek. Gerade weil die Aufführung kein Schauspiel, sondern dokumentarisches Theater ist, macht es, manchmal nur schwer auszuhalten, beeindruckend deutlich, wie Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und kaum verhohlener Rassismus die Ermittlungen von Anfang an in eine komplett falsche Richtung geführt haben. Und das, obschon es sofort Hinweise auf einen neonazistischen Hintergrund der Hinrichtungen gab. „Ich wusste, wer die Mörder meines Sohnes sind“, so Yozgat. Simsek ergänzt: „Drei Mal habe ich ihnen gesagt, dass es Nazis waren.“ Und, so Simsek weiter, „es sind nicht nur diese drei Täter, wer steht hinter ihnen? Wir fragen uns, ob es einen Staat im Staat gibt.“ Die Aufführung der „NSU-Monologe“ war Teil eines eigenen Programms während des Kirchentages zum Thema Rechtsextremismus. Angeboten haben es die Christen gegen Rechtsextremismus Dortmund, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus und die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Foto: Evangelischer Kirchenkreis

Einsätze während des Kirchentags: Agnes Terbeck – Ordnungsamt der Stadt Dortmund Vom 19. bis 23. Juni 2019 ist Dortmund Schauplatz einer der größten Veranstaltungen, die die Stadt seit langem gesehen hat: Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag verwandelt die City und ihre Stadtteile in einen Schmelztiegel von über 100.000 Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen, die an diesen fünf Tagen ein Fest des Glaubens feiern und sich über die wichtigen Fragen der Zeit austauschen. Wir stellen Ihnen – stellvertretend für die vielen Tausend haupt- und ehrenamtlichen Helfer*innen – Menschen vor, die mit viel Herzblut und ihrem Einsatz bei städtischen und angegliederten Institutionen dafür sorgen, dass das Großereignis ein Erfolg wird.
Agnes Terbeck arbeitet seit 25 Jahren bei der Stadtverwaltung, 24 davon im Ordnungsamt. Ihr tägliches Brot als Sachbearbeiterin in der Gewerbeabteilung des Ordnungsamtes ist die Bekämpfung illegaler Gewerbeausübung, Schwarzarbeit und unberechtigter Handwerksausübung, die Gewährleistung des Jugend- und Nichtraucherschutzes und die Durchführung von Gewerbekontrollen. In dieser Woche aber ist ihr Schwerpunkt ein anderer. Als Leiterin eines Dreierteams der Präsenzteams des Ordnungsamtes ist sie mittendrin: im Einsatz während des Kirchentages in der Innenstadt. Voller Vorfreude blickt Terbeck auf die ganz besondere Woche, in der das Großereignis stattfindet: „Wir sind ganz gespannt, was uns dort erwartet. In erster Linie wollen wir Ansprechpartner*innen sein und sind auch erkennbar – wir haben alle die gleichen Poloshirts mit dem Aufdruck „ORDNUNGSAMT“ an. Wir geben Hinweise und helfen gerne, wenn es mal irgendwo hakt. Sollte es jedoch Ordnungswidrigkeiten geben, sind wir natürlich auch zur Stelle.“ Der Reiz ist die besondere Stimmung Wie Agnes Terbeck und ihr Team rekrutieren sich die Mitarbeiter*innen, die während des Kirchentages im Einsatz sind, abteilungsübergreifend aus dem ganzen Ordnungsamt. Insgesamt sind während des Kirchentages 230 Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes im Zweischichtsystem eingesetzt. Die Aufgaben übernehmen sie oft fachfremd und zusätzlich zu ihren originären Stelleninhalten. Diese Tatsache schreckt Terbeck überhaupt nicht: „Ich bin ein Urgestein und erprobt in Sachen Großveranstaltungen. Loveparade, Fußball-Weltmeisterschaft, Meisterfeiern – alles hat sie schon miterlebt und „das sind immer Veranstaltungen, die echt toll sind“, so die Kollegin. Der Reiz für Terbeck ist die besondere Stimmung, von der sie viel über den Kirchentag gehört hat: „Man ist dabei und arbeitet nicht irgendwie vom Schreibtisch aus.“ Das Ordnungsamt ist seit Ende 2017 in die Planungen zum Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) involviert. Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes nahmen in dieser Zeit nicht nur an allen Arbeitskreisen zum Thema Sicherheit und den sechs Fachausschüssen teil, in denen die Sicherheitskonzepte erarbeitet wurden. Das Ordnungsamt ist auch Erlaubnisbehörde für die Nutzung der öffentlichen Wegeflächen und hat gemeinsam mit dem Tiefbauamt die verkehrliche Anordnung für die Verkehrsführung und -lenkung während des Kirchentages erstellt. Mitarbeiter*innen freuen sich auf friedliches Fest Agnes Terbeck und ihr Team fühlen sich gut vorbereitet. Letzte Hinweise gibt es einen Tag vor Beginn des Kirchentages und täglich ein Briefing in der Einsatzstelle vor Arbeitsbeginn. Die interne Logistik aber wurde schon lange sorgfältig vorbereitet: die Einsatzplanung, Checklisten und die Schichtdienstpläne wurden erstellt, Teams aus einsatzerfahrenen und neuen Kollegen*innen zusammengestellt und geschult, Dienstkleidung, Dienstausweise und Kommunikationstechnik wurden beschafft. Auch für Verpflegung der Teams in den Schichten und vor Ort ist gesorgt, Einsatzfahrzeuge sind bereitgestellt und Rufbereitschaften, Erreichbarkeiten und Notdienste organisiert. Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes während des Kirchentages gehört es unter anderem, zahlreiche veranstaltungsabhängige Halteverbote sowie eine neue Beschilderung vor und während des Kirchentages zu kontrollieren, ca. 190 Lebensmittelstände ehrenamtlicher und ca. 45 gewerblicher Teilnehmer*innen lebensmittelrechtlich zu überprüfen. Die Lebensmittelüberwachung ist auch in den Gemeinschaftsunterkünften tätig. Die Koordinierungsstelle der Veranstaltung ist durchgängig besetzt. Jetzt blicken Agnes Terbeck und ihr Team voller Erwartung auf die spannenden Tage, die tollen Konzerte und die vielen Menschen, die von nah und fern nach Dortmund kommen: „Ich glaube, wir werden ein ganz besonderes und friedliches Fest erleben“, so Terbeck.
Foto: Anja Kador

Einsätze während des Kirchentags: Veranstaltungstechnik und Produktionsleitung
Mark Oliver Duwensee hat einen Beruf, den es als „echten“ Lehrberuf erst seit rund 10 Jahren gibt: Als Veranstaltungstechniker „aus Erfahrung“, wie er lächelnd sagt, kümmert er sich um die Produktionsleitung der Veranstaltungen im Fritz-Henßler-Haus (FHH).
Duwensee hat seinen Job von der Pike auf gelernt. Sein Vater hatte ein Studio für Musikproduktionen, bereits als Teenager spielte er Schlagzeug in Bands und beschäftigte sich mit der technischen Seite der Auftritte. Es folgten rund 30 Jahre professioneller Arbeit in Pop- und Rockproduktionen, so mit dem in der Dortmunder Szene noch bestens bekannten Rapper Der Wolf oder als Bühnentechniker von Sascha.
Immer wenn auf den drei Bühnen im Fritz-Henßler-Haus etwas los ist, ist Duwensee im Vorfeld und währenddessen im Einsatz. Sei es bei Theateraufführungen, Musikevents wie Jugend jazzt oder einem Großereignis wie dem Kirchentag, Duwensee organisiert die technischen und logistischen Abläufe. Er engagiert Dienstleister*innen wie Ton- oder Lichtechniker*innen und checkt das Material, das Künstler*innen für ihre Auftritte brauchen. Außerdem legt er die Zeiten für die Auftritte fest und plant die Umbauzeiten.
Programmvielfalt bedeutet unterschiedlichste Anforderungen
Seit drei Jahren ist Duwensee, der auch Sozialarbeit studiert hat, als Produktionsleiter im FHH tätig. Was unterscheidet die Arbeit rund um den Kirchentag von anderen Veranstaltungen? „Ungewöhnlich sind Ausmaß und die Vielfalt der Veranstaltungen“, sagt er, „die drei Bühnen in Großem Saal, Café und Gartensaal werden von morgens bis in den frühen Abend hinein bespielt, das künstlerische Spektrum reicht von Singer-Songwritern über Lesungen, Theaterstücke, Rock und Pop hin zu Chören“. Die Künstler*innen stehen zwischen 30 und 90 Minuten auf der
22.06.2019
Bühne. In dieser Zeit hat Duwensee die Geschehnisse im Blick: „Ich schaue, ob das was man die Wochen zuvor vorbereitet hat, planmäßig läuft, ob es irgendwo Probleme gibt. Es geht darum, den Künstler*innen eine Basis zu bieten, mit denen sie arbeiten können – den Rest ergänzt man in den Umbaupausen.“ Allerdings gibt es gibt immer Momente, in denen die Planung nicht wie gedacht aufgeht. Dann geht es um schnelle Lösungen. In Absprache mit den Techniker*innen kümmert er sich etwa um die rasche Verlegung eines zusätzlichen Kabels.
Vielfalt der Künster*innen-Persönlichkeiten
Aber auch seine Fähigkeiten als Sozialarbeiter kommen während der drei Tage voll zum Tragen. Vollprofis, Laiendarsteller*innen und Gruppen mit einem inklusionsorientierten Ansatz geben sich im FHH das Mikro in die Hand. Gerade die beiden letzteren plagt nicht selten das Lampenfieber. „Dann betreue ich nicht die Bühne, sondern die zumeist jungen Menschen darauf“, sagt er schmunzelnd, „ich muntere auf und nehme die Nervosität“.
Diese verschiedenen Persönlichkeiten und ihre künstlerischen wie menschlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen – das macht seine Arbeit während des Kirchentags besonders spannend.

Wege zur Nachhaltigkeit: Tour von OB Ullrich Sierau mit Gästen des Kirchentags durch den Dortmunder Norden
Nachhaltigkeit im Alltag erfahrbar machen – das ist das Ziel des Projekts „Wege zur Nachhaltigkeit“, das während des Evangelischen Kirchentags vom 19. bis 23. Juni in Dortmund seine Premiere hat. Auf unterschiedlichen Routen durch das Stadtgebiet werden auf verschiedenen Stationen Dortmunder Akteur*innen vorgestellt, die sich für Klimaschutz, Interkulturalität und Integration, Umweltgerechtigkeit, Biodiversität oder auch nachhaltigem Konsum und Produktion engagieren. So lernen die Gäste des Evangelischen Kirchentags Dortmund von seiner nachhaltigen Seite kennen.
In diesem Rahmen startete gestern (Donnerstag) um 14 Uhr Oberbürgermeister Ullrich Sierau mit einer Gruppe von rund 60 Interessierten auf Elektrofahrrädern auf eine Tour durch Dortmunds Norden. Folgende Stationen: Von der Innenstadt ging zur Pauluskirche, Blücherpark, Hafen, Deusenberg, Kulturkirche Deusen, Lindenhorster Kirchturm, am Gewerbegebiet Minister Stein vorbei zum Werkhof-Projekt, vorbei an Hof Mertin, dem Verein für Kinder, Jugend- und Bildungsarbeit e.V., dem Lanstroper See und Lanstroper Ei sowie Haus Wenge. Ziel und Rast war das Café Mowwe im Landschaftsschutzgebiet in Lanstrop.
Das Projekt „Wege zur Nachhaltigkeit“ ist ein Kooperationsprojekt des Instituts für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche Westfalen, dem Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung, dem Deutschen Evangelischen Kirchentag sowie dem Büro für Internationale Beziehungen und Nachhaltige Entwicklung der Stadt Dortmund. Es wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW.
Bildzeile: Halt am Deusenberg
Foto: Thomas Kampmann/Stadt Dortmund

Ausklang des Abends der Begegnung mit Segen zur Nacht
Mit einem Lichtermeer aus Kerzen und dem Segen zur Nacht auf den Bühnen am Ostentor und dem Friedensplatz, am Westentor und auf dem Hansaplatz ist der erste Tag des Kirchentages zu Ende gegangen.
Ausklang auf dem Hansaplatz war mit Andrea Auras-Reiffen, der stellvertretenden Superintendentin des Kirchenkreises und Michael Stache, stellvertretender Superintendent. Der „Chor ist der Star“, zuvor schon begeistert von den Zuhörerinnen und Zuhörern gefeiert, hat den Segen zur Nacht mitgestaltet.
„Du mein Hirte“ – angelehnt war der Segen an den Psalm 23. „In Gottes Namen kommen wir zusammen. In seinem und in ihrem Namen.“ Abschluss des Segens war das gemeinsam gesprochen Vater Unser und das gemeinsam gesungene „Der Mond ist aufgegangen“.
Foto: Evangelischer Kirchenkreis

Einsätze während des Kirchentags:
Quartiermeister und Hausmeister
Vom 19. bis 23. Juni 2019 ist Dortmund Schauplatz einer der größten Veranstaltungen, die die Stadt seit langem gesehen hat: Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag verwandelt die City und ihre Stadtteile in einen Schmelztiegel von über 100.000 Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen, die an diesen fünf Tagen ein Fest des Glaubens feiern und sich über die wichtigen Fragen der Zeit austauschen. Wir stellen Ihnen – stellvertretend für die vielen Tausend haupt- und ehrenamtlichen Helfer*innen – Menschen vor, die mit viel Herzblut und ihrem Einsatz bei städtischen und angegliederten Institutionen dafür sorgen, dass das Großereignis ein Erfolg wird.
Zehntausende Gäste werden zum Kirchentag erwartet. Gemeinschaftsquartiere bieten vielen von ihnen einen Schlafplatz. Sie sind über die ganze Stadt Dortmund verteilt, viele Gäste kommen in Dortmunder Schulen unter. Quartiermeister*innen betreuen die Gemeinschaftsquartiere. Bodo Weirauch ist der Quartiermeister des Bert-Brecht-Gymnasiums und er hat berichtet, was diese Aufgabe bedeutet.
Bodo Weirauch ist unterwegs, um letzte Absprachen mit Thomasz Wrobel, dem Hausmeister des Bert-Brecht-Gymnasiums zu treffen. Der ehemalige Abteilungsleiter des Jugendamtes ist mittlerweile im Ruhestand, doch als Kirchentagsbeauftragter seiner Kirche ehrenamtlich aktiv. Dadurch ist er schon lange bei der Planung dabei. Bodo Weirauch: „Ich bin als Dortmunder ganz stolz darauf, dass wir Gastgeber sein können. Selbst Leuten, die mit Kirche nichts am Hut haben, könnte ich für die kommenden Tage ein volles Programm zusammenstellen, so vielfältig ist der Kirchentag.“
Betreuung, Nachtwache und Frühstücksversorgung
Als es um die konkreten Vorbereitungen ging, begann die Suche nach einer/m Quartiermeister*in. „Ganz im Sinne von `Führen durch Vorbild´, habe ich die Rolle übernommen“, erklärt er schmunzelnd. Quartiermeister*innen sind im Rahmen des Kirchentages für die Betreuung, Nachtwache und Frühstücksversorgung eines Gemeinschaftsquartiers verantwortlich. Das bedeutet, die Gäste willkommen heißen, registrieren, ihnen Schlafplätze zuweisen und aufkommende Fragen beantworten. Das Bert-Brecht-Gymnasium, das Weirauch betreut, beherbergt ca. 800 Schlafgäste. Alleine wäre Betreuung und Verpflegung der Besucher*innen gar nicht zu schaffen, weshalb eine wichtige Aufgabe war, Helfer*innen zu finden „Ehrenamtler*innen sind ein rar gesätes Gut. Ich bin bis wenige Wochen vor dem Kirchentag von Pontius zu Pilatus gelaufen. Aber es hat geklappt!“, erklärt Weihrauch.
40 ehrenamtliche Helfer*innen
So kann der Quartiermeister heute auf ein 40-köpfiges, ehrenamtliches Helferteam bauen, von denen ca. die Hälfte aus derzeitigen und ehemaligen Schüler*innen des Gymnasiums besteht. Ausschlaggebend für die erfolgreiche Suche war neben seinem guten Netzwerk viel Geduld. Zusätzlich kannte er das Gymnasium bereits: Weirauchs Tochter ist hier zur Schule gegangen, weshalb er einige Mitarbeiter*innen im Vorfeld kannte. „Die heutige Rektorin ist außerdem eine Religionslehrerin und selbst Kirchentagsbesucherin, sie hat gerne geholfen und sich an der Schule für mich umgehört.“ Dadurch konnten noch viele volljährige Schüler*innen zur Unterstützung gewonnen werden.
Doch nicht nur Schüler*innen des Gymnasiums unterstützen ihn, besonders dankbar ist Weirauch für die Hilfe von Thomasz Wrobel, dem Hausmeister des Gymnasiums. Er ist die Schnittstelle zur Schule und Ansprechpartner für Weirauch bei allen Fragen rund um die Themen: Logistik, Sicherheit und Raumplanung.
Der Hausmeister musste sicherstellen, dass die Schule für die Gäste bereit ist. Das bedeutet einerseits, die Schule für Besucher*innen vorzubereiten und zum anderen, die Helfer*innen fit für den Schulkomplex zu machen. „Die Besucher*innen wohnen hier 12 Stunden und müssen sich hier gut aufhalten können. Dafür musste ich das Gebäude mit meinen Kolleg*innen zusammen herrichten“, erklärt Wrobel. Damit sich dann die ehrenamtlichen Helfer*innen überhaupt in dem großen Gebäude zurechtfinden, hat er Raumpläne erstellt und eingezeichnet, wo etwa Sicherungskästen oder Putz- und Spülmittel zu finden sind. „Die Schule hat 29 Eingänge und 12 Außentore. Die Nachtwache ist immer gut beschäftigt, weil die dafür sorgen muss, dass die Türen zu sind. Ein Rundgang dauert ungefähr 45 Minuten“, erklärt Wrobel.
Diese Nachtwache übernehmen die ehrenamtlichen Helfer*innen. Weirauch hat ihren Vorlieben entsprechend einen Schichtplan erstellt, um die Nacht- und Frühstücksschicht zu besetzen. In der Frühschicht müssen die Helfer*innen um 5:30 in der Aula der Schule sein, Kaffee kochen, Brötchen und Aufschnitt ausgeben. All das musste Weirauch im Vorfeld besorgen. Mit etwas Mehraufwand ist es ihm gelungen, seinen Gästen ein Frühstück anzubieten, das hauptsächlich aus regionalen Produkten besteht, zum größten Teil sogar in Bio-Qualität. Plastikmüll hat er ebenfalls bewusst vermieden.
Nach dem Frühstück ist das Team noch dafür da, die Aula wieder herzurichten. Das Abspülen von Geschirr und Besteck übernehmen die Gäste dabei selbst. Um 9 Uhr wird das Gemeinschaftsquartier abgeschlossen, bis abends die Nachtschicht übernimmt. Sie empfängt die ersten Gäste am frühen Abend und sorgt die ganze Nacht für Sicherheit in dem Schulkomplex.
Bildzeile: Bodo Weirauch, Thomasz Wrobel (l.).
Foto: Katharina Kavermann

Erinnerungen mitnehmen
Der Dortmunder Kirchenkreis auf dem Abend der Begegnung
Musik, Fotos nicht nur zum Anschauen sowie Segenssprüche und noch viel mehr– mit diesem Programm hat der Evangelische Kirchenkreis Dortmund die Kirchentagsgäste auf dem Abend der Begegnung begrüßt.
Auf der Bühne spielten die Living Worshippers und der Chor „Cantastrophe“ auf, das Gitarrenensemble der TU und die Bridge Walkers aus Namibia. Der Bläserkreis Hombruch begeisterte die Zuhörenden, bei Sara´s Wohnzimmer konnte man u.a. Geige und E-Piano lauschen. Sevgi & Merhaba sowie anschließend der Chor Fusion gestalteten das Ende des Abends – unmittelbar vor dem Segen zur Nacht.
Eine Fotobox bot fotografische Erinnerungen vor einem Bluescreen – mit eingeblendeten Dortmund-Motiven. Das analoge Ergebnis durfte man mitnehmen, das digitale auf Facebook all seinen Freunden zeigen.
Eine kleine Zeitreise war bei der Evangelischen Jugend zu besichtigen. Mittelalterliche Gewandungen, passend zu den „Lutherspielen“ sowie die bekannten Thesen plus Tür standen hinter der Stadtkirche St. Reinoldi. Außerdem gab es Infos zum individuellen Ökologischen Fußabdruck. Mitmachen war angesagt bei der Skulptur aus gebrauchten Gebrauchsgegenständen.
Ja, das geht – vegetarische Schmalzbrote. Damit hat die Lydia-Kirchengemeinde am Abend der Begegnung ihre Gäste verwöhnt. Fleischesser konnten aufatmen. Es gab auch „richtige“ Schmalzbrote. Direkt daneben bietet das Bistro Karibu der Georgs-Kirchengemeinde Spezialitäten aus Kenya und Uganda.
Überhaupt – zu Essen gibt es hier reichlich. Nur eine kleine Auswahl: Kochbananen, Donuts, Crepes, Waffeln. Die nördlichste Gemeinde Dortmunds, Brechten, bot eine Spargelcremesuppe. Natürlich regional und saisonal. Die Gemeinde in Syburg informiert ihre Gäste darüber, dass der Erlös der angebotenen Speisen und Getränke der Partnerkirchengemeinde Kotela in Tansania zugute kommt.
Und überall, an allen Dortmunder Ständen, gab es ein Geschenk. Die „Bierperle“, eine von vielen, um die Kirchentagsperlenkette zu gestalten. Sie ist „ein Stück unseres Grundes“, so wurde sie beworben.
Beim Dialogkreis der Abrahamsreligionen gab es ein Mitmachspiel. Eines zum Dazulernen. Um die Speiseregeln der Religionen ging es. Was ist kosher, was ist halal? Entsprechend konnte man seinen Einkaufskorb füllen. Großer Andrang bei der nächsten Mitmachgelegenheit: „Deine Linke gegen Dortmunds Rechte.“ Die Spielregeln: Die linke Handfläche farbig anmalen und auf einen großen Bogen Papier drücken. Am Ende des Abends war ein gemeinsames Kunstwerk entstanden. Angeboten hat es der Arbeitskreis Christen gegen Rechtsextremismus.
Apropos gemeinsames Kunstwerk. Bei dem Stand des Evangelischen Bildungswerks haben die Kirchentagsbesucher ebenfalls gemeinsam einen Kirchentagsteppich gewebt. Zwei mal zwei Meter groß. Nach dem Kirchentag wird er weiterverwendet und kann – zusammen mit dem von der Diakoniewerkstatt Passgenau gebauten Webrahmen – ausgeliehen werden. Schlange stand man direkt nebenan, ebenfalls beim Bildungswerk. Hier könnte man sich Sprühtatoos „eintätowieren“ lassen.
„Eine besondere Zeit erleben“ versprach und verspricht die ökumenische Dienstgruppe Martin Luther King. Ihr Ponyhof Hilbeck ist seit Jahrzehnten ein besonderes Zentrum für soziales Lernen.
Foto: Evangelischer Kirchenkreis

Klimaschutz lernen
Evangelische Jugend auf dem Kirchentag
Um Klimaschutz, Klimawandel und Nachhaltigkeit ging es bei dem Eco-City Workshop der Evangelischen Jugend Dortmund auf dem Zentrum Jugend des Kirchentages. Überrascht, das so viele gekommen waren, zeigte sich Ariane Buchenau,. „Gerechnet hatten wir mit 30 Interessenten.“ Gekommen waren doppelt so viele.
Warum? „Meine Zukunft könnte gefährdet sein“, so eine der Teilnehmerinnen. Ein anderer wollte wissen, was man als einzelner tun kann, um die Umwelt zu schützen. Spielerisch haben die Jugendlichen Zusammenhänge gelernt zwischen dem Anbau oder Handel von Früchten, Fleisch und Kleidung. Deutlich wurde, dass die Produktion einer importierten Mango dramatisch mehr CO2 ausstößt als das Wachstum der Birne aus dem heimischen Garten. „Regional und saisonal einkaufen ist die Devise“, so Buchenau. „Und nicht alles, was Geld bringt, ist gut für die Umwelt.“
Das Spiel (Dauer 90 Minuten) hat die Evangelische Jugend Dortmund zum Teil mit entwickelt. Nach dem Kirchentag soll es in mehreren Exemplaren und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung auch Gemeinden zur Verfügung stehen.
Foto: Evangelischer Kirchenkreis Dortmund

Diskussion über Zuwanderung: „Wir sind keine integrierte Gesellschaft“
Die Zuwanderung aus EU-Staaten im Zuge des freien Arbeitsmarktes stand im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion, an der aus Dortmunder Sicht Stadträtin Birgit Zoerner und Diakonie-Geschäftsführerin Uta Schütte-Haermeyer teilnahmen. Ort war das Thyssen-Krupp-Info-Center im Dortmunder Norden.
Als wichtiges Kommunikationsziel postulierten die Podiums-Teilnehmer/innen einhellig, in der Debatte über Zuwanderung die Gruppe der Geflüchteten und diejenige der EU-Migrant/inne/en zu trennen. Das, so die Beobachtung, gelinge in der öffentlichen, auch der medialen Diskussion häufig nicht.
Dabei seien die Problemlagen deutlich unterschiedlich, beschrieb Diakonie-Chefin Uta Schütte-Haermeyer. Während für Geflüchtete in der Regel Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz griffen, fielen EU-Migranten häufig durch alle sozialen Raster. Schon in ihren Heimatländern – vornehmlich Bulgarien und Rumänien – zählten die meisten zu einer sozial unterprivilegierten Gruppe. Das Bildungsniveau sei sehr niedrig, die Voraussetzungen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, kaum gegeben.
Die Folge: „Wir sind konfrontiert mit Armutssituationen, die ich zuvor nur aus Geschichtsbüchern kannte“, so Schütte-Haermeyer. Sie stellte das Dortmunder Diakonie-Projekt „Heimat Europa“ vor, das schon vor der Flüchtlingswelle 2015 ins Leben gerufen worden war und niederschwellige Angebote für die Gruppe der Migranten aus östlichen EU-Ländern bietet. Finanziert werde das Projekt fast ausschließlich aus Fördermitteln, deren Akquise aufwändig sei, beklagte Schütte-Haermeyer. Sie äußerte die Hoffnung, die Arbeit künftig umfangreicher aus kommunalen Mitteln tragen zu können.
Auf die kritische Sicht auf die Problemfelder aus weiten Kreisen der Bevölkerung ging die Berliner Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan in einem Referat ein. Sie forderte, Förderungen für Migranten mit Parallelförderungen für andere Bevölkerungsgruppen zu koppeln. Es gehe nicht darum, neu hinzugekommene Gruppen in eine problemfreie Gesellschaft zu integrieren. „Wir sind keine integrierte Gesellschaft“, sagte Schwan. Vielmehr seien soziale Probleme auch in anderen Teilbereichen der Gesellschaft ernst zu nehmen. Gefühle von erlebter Ungerechtigkeit müssten aussprechbar sein und nicht in Sinne von postulierter Solidarität moralisch belegt werden.
So sei gesellschaftliche Integration stets ein vielschichtiger, wechselseitiger Prozess. Gesellschaftlicher Wandel könne nur mit weitgehender Partizipation gelingen. Dabei komme den kommunalen Ebenen heute weit größere Bedeutung als der Bundespolitik zu.
Foto: Oliver Schaper

Depression und Beratung: „Es gibt kein Ranking der Sorgen“
Um Depression, Beratung und Hilfen ging es auf einem open-air-Podium in der Innenstadt. Als Expert/inn/en mit dabei: die Leiterin der Dortmunder Telefonseelsorge Ingrid Behrendt-Fuchs und Dieter Bargel von der Evangelischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen.
Die Einführung in den sensiblen Themenbereich lieferte der niederländische Publizist und Autor Victor Staudt. Er las aus seinem Buch ‚Die Geschichte meines Selbstmords‘, in der er den eigenen Suizidversuch aufarbeitete, dessen Erleben und die Folgen beschrieb. Victor Staudt hatte sich vor 20 Jahren infolge einer nicht behandelten Depression vor einen Zug fallen lassen. Er überlebte, verlor aber beide Beine.
Eindrücklich und souverän, sogar humorvoll, berichtete Staudt über seinen Werdegang. Zehn Jahre habe er gebraucht, um vollends zu sich und seiner Geschichte zu stehen. Dann, so de Autor, habe er das Buch geschrieben, um betroffenen Menschen eine Gelegenheit zur Identifikation zu geben. Die fehle vielen von denen, die mit Depression und Ängsten zu kämpfen hätten. Das Gefühl, keinen Ansatzpunkt zum Leben mehr zu finden, führe dann oft in die Verzweiflung – und zum Suizid.
Dass viele Betroffene und auch deren Angehörige nicht wissen, wie sie mit Angst umgehen sollten, bestätigten auch Ingrid Behrendt-Fuchs und Dieter Bargel. Sie schilderten aus professioneller Helfersicht, mit welchen Anliegen Menschen zu ihnen kommen. Oft, so Berater Bargel, stehe die Frage im Raum: „Ist mein Problem überhaupt groß genug, um Hilfe in Anspruch zu nehmen?“
Aber, so Telefonseelsorgerin Behrendt-Fuchs, „es gibt kein Ranking der Sorgen“. Jede und jeder werde in der telefonischen, der Chat- oder der persönlichen Beratung mit dem, was ihn oder sie bedrückt, ernst genommen. Auf keinen Fall, so Victor Staudt, dürfe die Reaktion von Angehörigen oder Bekannten sein: „Ist doch nicht so schlimm“, „stell dich nicht so an“ oder „wird schon wieder.“ Solche Reaktionen, so bestätigten auch Behrendt-Fuchs und Bargel, verdeutliche lediglich das weit verbreitete Unverständnis für psychische Erkrankungen in der Gesellschaft.
Wenn spezielle Hilfen erforderlich seien, kann in der Beratung stets ein entsprechendes Angebot vermittelt werden. In Deutschland gibt es beispielsweise zahlreiche Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischen Belastungen. Oft ist auch fachärztliche oder –therapeutische Behandlung nötig, gelegentlich sogar stationäre Behandlung in einer Fachklinik.
Wichtig, so Ingrid Behrendt-Fuchs, sei in der Telefonseelsorge immer das Wahren der Anonymität. Niemand werde nach dem Namen gefragt. Und auch die zumeist ehrenamtlichen und gut geschulten Beraterinnen und Berater gäben bewusst ihre Namen im Beratungsgespräch nicht preis.
Bühnen-Foto: v.l. Dieter Bargel, Victor Staudt, Moderator Pfr. Klaus Künhaupt, Ingrid Behrendt-Fuchs

Was für ein Geschmack!
In der Kinderstadt im Dietrich-Keuning-Haus bot das Evangelische Bildungswerk Dortmund am Donnerstag- und Freitagvormittag einen Koch-Workshop an. Jeweils 12 Kinder hatten dort die Möglichkeit, ihr Mittagessen selbst herzustellen: Gemüse putzen, Teig kneten, Butter schütteln, Tomaten pürieren – sechs verschiedene Mahlzeiten entstanden unter der Anleitung der pädagogischen Mitarbeiterinnen des Bildungswerks. Die Rezepte für Kräuterbutter, Couscous-Topf, Kichererbsen-Salat, Gurkensalat, Knäckebrot und Ketchup waren ausführlich bebildert, sodass jeder einzelne Schritt bei der Zubereitung gut verständlich war. Die Jungen und Mädchen erlebten, dass Zwiebeln ganz schön in den Augen brennen, wenn man sie schneidet, wie viel Muskelkraft die Herstellung von Butter erfordert, und lernten auch Regeln der Küchenhygiene: „Wenn ihr den Löffel abgeleckt habt, könnt ihr ihn nicht wieder in die Schüssel stecken.“
Schnell bildeten sich Teams und die Kinder verteilten die zu erledigenden Aufgaben selbstständig: Auf die Frage „hat gerade jemand nichts zu tun“, folgte schnell die Bitte: „Kannst du dann die Erdbeeren auf die Spieße stecken?“
Selbstverständlich wurden die gemeinsam zubereiteten Gerichte am Ende auch verzehrt. Das einstimmige Urteil: „Lecker.“ Was für ein Geschmack!
Foto: Evangelischer Kirchenkreis Dortmund

Feierabendmahl international – die Markuskirche erlebte Kirchentag pur
Lesungen in fünf Sprachen, rhythmisches Klatschen bei Bandmusik und fröhliche Gespräche beim gemeinsamen Mahl. Die Markuskirche erlebte beim Feierabendmahl am Freitagabend Kirchentag von seiner besten Seite. Die Kirche voll besetzt, die Atmosphäre begeisternd. Zahlreiche Gäste aus Privat- und Gemeinschaftsquartieren waren zum Feierabendmahl gekommen, genau wie alteingesessene Gemeindemitglieder und internationale Gäste.
Bei Musik mit dem Chor Cantastrophe und der afrikanischen Band ‚Living Worshippers‘ feierten alle gemeinsam fröhlich und beseelt. Die Liturgie gestalteten die gastgebenden Pfarrerinnen Birgit Worms-Nigmann und Carola Theilig gemeinsam mit Vertretern unterschiedlicher Nationalitäten. So gab es die Begrüßung und Lesungen in fünf verschiedenen Sprachen: deutsch, französisch, englisch, tamil und koreanisch. Auch Gedanken über Vertrauen trugen Vertreter/innen aller beteiligten internationalen Partner zusammen.
Bevor überall in den Reihen miteinander Brot und Traubensaft zum Abendmahl geteilt wurden, waren alle Feiernden im Gottesdienst schon vorab zum gemeinsamen Mahl eingeladen. Alle Bänke erhielten Kisten mit Brot, Käse, Oliven, Tomaten, Basilikum und Wasser. Man teilte auch dies alles miteinander, nicht ohne sich fröhlich und beherzt auszutauschen. Da aßen und schwatzten Mutter und Töchter aus München mit der Jugendgruppe aus Mainz, der Frau aus Hamburg und dem Dortmunder Gastgeber. Schnell kam Kontakt zustande, Speisen und erste Kirchentagserfahrungen wurden weitergegeben. Selten war ein Friedensgruß untereinander vor dem anschließenden gemeinsamen Abendmahl so herzlich.
Dass ein Gottesdienst – nach knapp zwei Stunden – unter dem Jubel der Gemeinde zu Ende geht, ist in Deutschland selten. Chor und Band setzten dafür den Schlusspunkt, nachdem der Segen auf Französisch erteilt worden war. Der Kirchraum musste anschließend schnell geräumt werden – das Kirchentagsprogramm hatte am Abend noch ein Konzert vorgesehen. Im Innenhof und Gemeindehaus blieb aber Gelegenheit für längeres Miteinander. Und auch ein ausgiebigerer Imbiss wurde gereicht.

Einsätze während des Kirchentags: Bei der Freiwilligen Feuerwehr
Die Feuerwehr Dortmund bildet eine Einheit aus der Berufsfeuerwehr und der ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr sorgen die 19 Löschzüge und ein Fernmeldezug, als Kommunikatios- und Führungsunterstützungseinheit, der Freiwilligen Feuerwehr für die Sicherheit der Bürger*innen der Stadt.
Einer, der mit Leidenschaft in seiner freien Zeit der ehrenamtlichen Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr beim Löschzug Dortmund-Asseln nachgeht, ist Philipp Kehl (23). Wenn er nicht im Ehrenamt im Einsatz ist, führt er als selbständiger Unternehmer einen Gartenbaubetrieb. Seit seinem zehnten Lebensjahr engagiert sich der Dortmunder schon bei der Feuerwehr, seit dem 18. Lebensjahr ist er im aktiven Dienst. Dreimal im Monat absolviert er Übungsdienste, regelmäßig wird er geschult und alle notwendigen Lehrgänge hat er durchlaufen, „damit wir immer auf dem Stand der Dinge bleiben“.
Gelassen sieht er nun dem Großereignis Kirchentag entgegen: „Für mich ist das ‚business as usual‘“. Beim letzten Übungsdienst vor dem Kirchentag haben sich alle nochmal auf den aktuellen Stand gebracht – und sich darüber unterhalten, was genau beim Kirchentag stattfindet, welche Veranstaltungen es gibt und wo die Gäste im Stadtgebiet unterwegs sind.
Wache für die Brandsicherheit beim Kirchentag
Eingesetzt ist Kehl mit weiteren acht Kameraden am Mittwoch, dem ersten „Kirchentag“, bei einer sogenannten „Brandsicherheitswache“ von nachmittags bis spät in die Nacht. Diese Aufgabe erklärt er so:“ Wenn massiv viele Menschen unterwegs sind, ist für die Einsatzkräfte das Durchkommen zum Einsatzort schwierig – sollte tatsächlich mal was passieren. Eine Brandsicherheitswache sorgt dann dafür, schon mal die
Lage zu sondieren, um die nachrückenden Kräfte einzuweisen und erste Gefahrenabwehrmaßnahmen einzuleiten. Aber wir wollen auch einfach Präsenz zeigen und den Gästen signalisieren, dass wir da sind, wenn sie uns brauchen.“ Ganz viele Menschen, so weiß Kehl aus langer Erfahrung, kommen einfach aus Interesse nur auf ein Wort bei den Feuerwehrleuten vorbei und wollen sich informieren. Darüber hinaus unterstützen weitere ehrenamtliche Helfer rund um den Kirchentag auch bei der Logistik, bei der Besetzung eines temporären Löschzuges im Innenstadtbereich oder bei der Führungsunterstützung/Kommunikation.
Für den Rest der Zeit, die der Kirchentag dauert, ist Kehl „auf Abruf“. Wenn also ein Einsatz nötig ist, wird er von der Einsatzleitstelle auf seinem „Pieper“ alarmiert – und begibt sich dann zu seinem Löschzug in Dortmund-Asseln.
Anders als die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sind die neun Berufsfeuerwehrwachen immer fest mit Feuerwehrbeamt*innen besetzt. Beamt*innen im feuerwehrtechnischen Dienst sind Profis, qualifiziert für alle erdenklichen Notfälle und Schadenslagen. Ein wechselndes Team steht an 365 Tagen im Jahr, aufgeteilt in jeweils 24-stündige Dienstschichten, allzeit zum Abmarsch bereit. Ist erkennbar, dass ein Team längere Zeit an einer Einsatzstelle gebunden ist, übernehmen die Kamerad*innen der Freiwilligen Feuerwehr die Alarmbereitschaft an der jeweiligen Wache.
Mit den Freiwilligen ist Berufsfeuerwehr stärker
Die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere in aufwändigen und länger andauernden Einsätzen sowie in Spezialaufgaben, ist auch für eine starke Berufsfeuerwehr unerlässlich. Diese Erfahrung hat auch Kehl schon oft gemacht – wenn auch nicht in Dortmund. So war er beispielsweise auswärts im Einsatz beim Elbhochwasser.
Durch das Engagement der 755 (davon 68 Frauen) ehrenamtlichen Kameraden*innen wird die Grundschutzsicherung durch die Berufsfeuerwehr in allen Stadtbezirken zusätzlich in den Bereichen des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung ergänzt, teilweise sind die ehrenamtlichen Brandschützer in den Randgebieten der Stadt durch eine Erstalarmierung sogar auch vor den hauptamtlichen Kräften an der Einsatzstelle.
Für Kehl ist der besondere Reiz das Zusammengehörigkeitsgefühl: „Man fühlt sich wie eine große Familie, mit der man auch in der Freizeit viel gemeinsam unternimmt.“ Mit seinen Kameraden eine Brandsicherheitswache für das außergewöhnliche Großereignis Kirchentag in Dortmund abhalten zu können, ist dem Feuerwehrmann Kehl eine besondere Ehre: „Ich freue mich sehr darauf und bin gerne dabei.“

Dialog-Bibelarbeit in St. Marien: „Gott sei Dank schamlos“
Es ging um „einen der feministischen Hass- oder Lieblingstexte“ der Bibel, so die Dortmunder Pfarrerin Kerstin Schiffner, die in der überfüllten Stadtkirche St. Marien zusammen mit dem Hildesheimer Neutestamentler Carsten Jochum-Bortfeld eine Dialog-Bibelarbeit am letzten Programmtag des Kirchentags hielt.
Die Geschichte der sündigen Frau, die in ein Gastmahl hineinplatzt, zu dem Jesus geladen ist, sich vor ihn wirft ihn mit ihren Tränen benetzt, mit den Haaren trocknet und mit teurem Öl salbt. Alle Anwesenden, zuerst der Gastgeber Simon, sind nicht begeistert von der Szene. Aber Jesus wendet sich der Frau zu und spricht sie frei. „Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden!“
Irritiert wie die Gastgemeinschaft in der Geschichte waren zunächst auch die Gäste in der Marienkirche. Denn Kerstin Schiffner und Carsten Jochum-Bortfeld zogen sich, nachdem sie den Text vorgetragen hatten, zurück und forderten die Besucherinnen und Besucher auf, sich im Gespräch miteinander die biblische Szene vor Augen zu führen. Gemurmel, ungläubiges Gelächter; das hatten die meisten in der Bibelarbeit nicht erwartet. Aber schnell wurde es lauter in der Kirche, der Austausch in spontanen Gruppen funktionierte.
Sie wollten den Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, in dem es endlich auch mal um eine Frau gehe, ein wenig gegen den Stricht bürsten, so Kerstin Schiffner. Sie und Carsten Jochum-Bortfeld zeichneten zunächst ein Bild der Situation. Ein Gastmahl zu biblischen Zeiten war ein gesellschaftliches Ereignis. Da schmückte sich der Hausherr gerne mit angesehenen Gästen, etwa dem bekannten Prediger aus Nazareth.
In einen solchen Event platzt die wenig angesehene Frau. Aus ihr bricht alles heraus, ihre Verzweiflung, ihre Tränen. Ihr Auftritt ist schamlos – „Gott sei Dank durchbricht sie alle Grenzen der Scham“, so Kerstin Schiffner. Aus dem gelehrten Disput der illustren Gesellschaft über Glaubensfragen, der auch etwas Spielerisches habe, sei damit Ernst geworden, so Kerstin Schiffner. Durch Jesus Zuspruch – auch wenn er auf den ersten Blick wenig empathisch sei – schaffe die Frau vor aller Augen einen Neuanfang. Sie wird gerettet, auch durch ihr Vertrauen, das sie als letzte Kraftreserve aufbringe.
Diese Freiheit auf Dauer zu leben, brauche indes Freiraum, so Jochum-Bortfeld. Den müssten alle Menschen im Umfeld, in der Stadt, in der Gesellschaft gewähren. Da sei es den Menschen zur Zeit Jesu nicht anders ergangen als heute. „Es ist Euer Job, diesen Freiraum zu ermöglichen“, appellierte er an die Kirchentagsbesucher. Wie im Haus von Simon auch hier in der Marienkirche.

‚Ehe für alle‘, Polyamourösität – oder ganz andere Lebensformen?
Um Lebensformen, deren Tragfähigkeit und den Grad ihrer Institutionalisierung ging es in einem Forum beim Zentrum Regenbogen. Deutlich wurde, dass die Landeskirchen innerhalb der EKD noch sehr unterschiedlich mit der Segnung oder gar Trauung gleichgeschlechtlicher Paare umgehen. Auch die Evangelische Kirche von Westfalen hat hier noch keine neue Regelung getroffen. In Vorbereitung ist aber eine Änderung des Kirchengesetzes, die eine Trauung ermöglicht. „Ich bin sehr gespannt auf die abschließende Diskussion“, sagte der Theologische Vizepräsident der Landeskirche Ulf Schlüter. Zwar nehme der Prozess einen vielversprechenden Verlauf – auch die Synode des Kirchenkreises Dortmund hat sich jüngst für das neue Gesetz ausgesprochen -, dennoch gebe es nach wie vor auch Vorbehalte, sagte Schlüter. Das Meinungsbild innerhalb der Landeskirche sei nicht homogen, auch wenn es zu eindeutigen Synodenbeschlüssen komme.
Er sei froh, dass er nicht Kirchenleitender sei und solche Entscheidungen herbeiführen müsse, sagte der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock. Der Professor für Systematische Theologie postulierte in Bezug auf die Institutionalisierung aller denkbaren Lebensformen die Abkehr von „Ewigkeitsklauseln“. Auch das Institut Ehe habe durchaus Schaden und Traumata bewirkt. Für Dabrock denkbar sind auch andere Formen des Miteinanders, etwa polyamouröse Beziehungen, wie sie zuvor der Kieler Sexualpädagoge Uwe Sielert ins Spiel gebracht hatte.
Wenn sich andere Lebensformen entwickelten, hätten diejenigen, die sie praktizierten, gegenüber der Gesellschaft die Beweislast, dass die Formen funktionierten. Dann allerdings, so Dabrock, sei es auch an den Kirchen zu reagieren und für die neuen Lebensformen Rituale und Formen der Anerkennung zu entwickeln. Eine Aussage, die im Publikum zu emotionalen Reaktionen führte. „Des ist doch Quatsch, was der erzählt“, so der Zwischenruf eines schwäbischen Pfarrers. Er plädierte auf Nachfrage des Moderators, des Münchner Pfarrers Wolfgang Schürger, für eine Mäßigung der Neuorientierung. Alle neuen Formen müssten den Gemeinden vermittelbar sein, jetzt sei erst einmal die ‚Ehe für alle‘ im Blick.
Die Dortmunder Theologin und Ehe- und Lebensberaterin Silke Hansel verwies auf die Kraft, die Beziehungsarbeit koste. Oft, so ihre Erfahrung, überforderten sich Menschen mit ihren Ansprüchen an sich selbst und ihre Lebensformen.
Vor allem aber, so Ulf Schlüter, gelte es, die Offenheit des Menschen nicht normativ zu verdrängen. „Der Blick auf die Realität hat uns schon immer weitergebracht“, sagte der Theologische Vizepräsident. Segenshandlungen bezögen sich im Übrigen grundsätzlich immer auf den einzelnen Menschen. „Das ist eine Grundvoraussetzung.“ Was sich daraus in 30 Jahren für Formen entwickelten, könne man heute nicht sagen. Als Problem mochte das Mitglied der westfälischen Kirchenleitung diese Entwicklungen von Segensformen aber nicht sehen: „Da bin ich ganz entspannt.“
Foto: v.l.: Moderator Dr. Wolfgang Schürger, Prof. Dr. Uwe Sielert, Prof. Dr. Peter Dabrock, Ulf Schlüter, Silke Hansel

Gottesdienst zum Kirchentag mal in einer Feuerwache. Zum „Blaulicht-Gottesdienst“ nicht nur für Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei, technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten wurde im Rahmen des umfangreichen Kirchentags-Programms eingeladen. Daher machten sich viele Kirchentagsgäste aus allen Teilen Deutschlands auf den Weg zur Feuerwache 2 nach Eving-Lindenhorst und erlebten einen Gottesdienst, der keineswegs alltäglich ist.
Foto: Hartmut Neumann