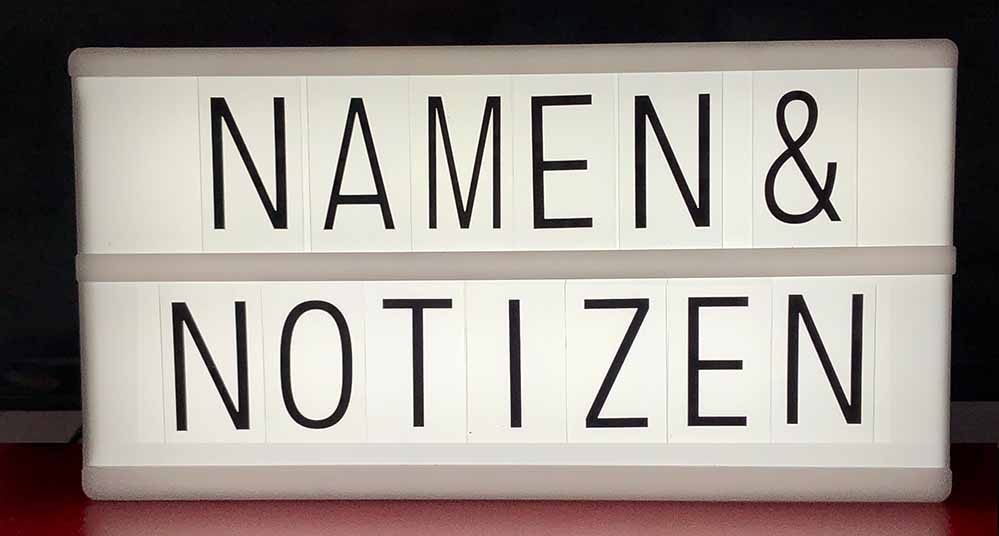Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“
Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“.

Pünktlich zum neuen Schuljahr treten die ersten Betriebsakquisiteur*innen ihren Dienst an Dortmunds Haupt- und Gesamtschulen an
Jugendlichen an Haupt- und Gesamtschulen bessere Chancen einer dualen Ausbildung in kleinen und mittelständischen Unternehmen geben und gleichzeitig in den Betrieben das Bewusstsein für das Potenzial der Absolvierenden als aussichtsreiche, zukunftsfähige Arbeitskräfte schärfen: Das ist der Auftrag des Dortmunder Projekts „Mit Hauptschulabschluss durchstarten in duale Ausbildung“, das nach dem erfolgreichen Start 2018 nun ausgeweitet wird. Die ersten neuen Betriebsakquisiteur*innen, die dabei als vermittelndes Bindeglied zwischen Schulen und Unternehmen fungieren, haben jetzt ihre Arbeit aufgenommen.
Das Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Dortmund und des Regionalen Bildungsbüros, startete im Frühjahr 2018 als Pilotstudie an der Katholischen Hauptschule Husen. Ziel war es, die Übergangsquote von Schüler*innen mit Hauptschulabschluss in eine duale Ausbildung deutlich zu steigern. Mit einer Verdopplung auf 44 Prozent ist dies gelungen. Damit davon auch andere Schulen und Bezirke profitieren, wurde das Projekt im Rahmen der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2030 (KAS 2030) zum Schuljahr 2020/21 auf acht weitere Haupt- und Gesamtschulen ausgedehnt.
„Der Übergang von der Schule in den Beruf ist ein wichtiges Zukunftsthema. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, die ersten 3 von insgesamt 9 Betriebsakquisuteure*innen als neue Mitarbeitende bei Wirtschaftsförderung willkommen zu heißen“, so Thomas Westphal, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. „Vom Übergang in die Ausbildung bis zur Betriebsübergabe als Start in den Ruhestand. Als Wirtschaftsförderung runden wir damit unsere Dienstleistungen für den Wirtschaftsstandort Dortmund ab“, so Westphal weiter.
„Mit dem neuen Projekt verknüpfen wir die langjährigen Aktivitäten in Dortmund im Rahmen der Übergangsgestaltung von der Schule in die Arbeitswelt und integrieren dieses in die bestehenden Strukturen von Schule und Wirtschaft. Die Betriebsakquisiteure ergänzen an den ausgewählten Schulstandorten die multiprofessionellen Teams der Berufsorientierung. Damit wird auch die Landesstrategie „Kein Abschluss ohne Anschluss – Schule-Beruf NRW“ unterstützt, sagte Daniela Schneckenburger, Schuldezernentin der Stadt Dortmund, anlässlich des Dienstantritts von drei neuen Betriebsakquisiteur*innen. Diese werden zukünftig an verschiedenen Haupt- und Gesamtschulen im Stadtgebiet eingesetzt, um sowohl die lokalen Unternehmen bei der Gewinnung von Nachwuchskräften zu unterstützen als auch den Schüler*innen die vielfältigen Ausbildungsangebote in ihren Ortsteilen näherzubringen. Dabei begleiten sie diese ab der Klasse 8 auf dem Weg in eine duale Berufsausbildung und helfen ihnen auch im Bewerbungsprozess. „Wir schaffen mit dem Angebot eine klassische Win-Win-Situation und wirken langfristig dem Fachkräftemangel im Mittelstand entgegen. Das stärkt unseren Nachwuchs, die Unternehmen und letztlich unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig“, so Thomas Westphal von der Wirtschaftsförderung Dortmund und Daniela Schneckenburger, Dezernentin für Schule, Jugend und Familie. Gemeinsam hießen sie die frisch gebackenen Betriebsakquisiteur*innen willkommen. Diese sind:
Diese sind:
Safet Alic für die Gustav Heinemann Gesamtschule im Stadtbezirk Huckarde, Christian Dieker für die Gesamtschule Gartenstadt im Stadtbezirk Innenstadt-Ost und Elisabeth Jendreiko für die Emscherschule im Stadtbezirk Aplerbeck
Bis zu den Herbstferien beginnen auch die übrigen sechs Akquisiteure ihre Arbeit. Dann ist das Projekt an insgesamt neun Dortmunder Schulen gestartet.
Bildzeile: v.l. Daniela Schneckenburger (Dezernentin für Jugend, Schule und Familie der Stadt Dortmund),
Elisabeth Jendreiko (Betriebsakquisiteurin für die Emscherschule Aplerbeck),
Christian Dieker (Betriebsakquisiteur für die Gesamtschule Gartenstadt im Stadtbezirk Innenstadt-Ost),
Safet Alic (Betriebsakquisiteur für die Gustav Heinemann Gesamtschule im Stadtbezirk Huckarde),
Thomas Westphal (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dortmund)
Foto: Wirtschaftsförderung Dortmund

Japanischer Konsul in Dortmund
Kiminori Iwama, der neue japanische Generalkonsul in Düsseldorf, stattete der Auslandsgesellschaft seinen Antrittsbesuch ab. Er erkundigte sich sowohl über die Auslandsgesellschaft als auch über die Aktivitäten der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Sein besonderes Interesse galt dem Projekt „Hilfe für Japan“ zugunsten der Fukushima-Kinder.
Bildzeile: Klaus Wegener, Präsident der Auslandsgesellschaf (li.) sowie Yoko und Horst Schlütermann, Deutsch-Japanische Gesellschaft (re.) empfangen den neuen japanischen Generalkonsul Kiminori Iwama in der Auslandsgesellschaft.
Foto: Mädje/Auslandsgesellschaft

Die Stadt Dortmund und das Amtsgericht Dortmund haben in Kooperation miteinander eine Großtagespflegestelle auf der Hamburger Str. 55 ins Leben gerufen und nunmehr in Betrieb genommen. Die Großpflegestelle bietet Platz für insgesamt 9 „U-3-Kinder“, welche von 2 Tagesmüttern betreut werden. Vom Standort und den erfolgreichen Umbauarbeiten konnten sich nunmehr die Projektbeteiligten einen guten Eindruck verschaffen.
Bildzeile: hintere Reihe (vlnr): Daniela Schneckenburger (Jugenddezernentin), Christian Schmitt (Vermieter), Jörg Heinrichs (Präsident des Amtsgerichtes Dortmund), Hanna Neitzel (Amtsgericht Dortmund) und Daniel Kunstleben (Geschäftsführer FABIDO)
Foto: Nocker/Amtsgericht Dortmund

Vorhang auf für die Emscher-Auen
Neuer Name für das Hochwasserrückhaltebecken Ickern-Mengede
Gemeinsam mit den Städten Castrop-Rauxel und Dortmund hatte die Emschergenossenschaft im Frühjahr zu einem Namenswettbewerb aufgerufen. Gesucht wurde eine attraktivere Bezeichnung für das Hochwasserrückhaltebecken Ickern-Mengede. Rund 80 Einsendungen gingen schließlich bei der Emschergenossenschaft ein. Eine Jury wählte den neuen Namen aus: Emscher-Auen – so heißt die Hochwasserschutzanlage von nun an!
In der Jury saßen Vertreter aus Dortmund und Castrop-Rauxel, von der Emschergenossenschaft sowie von Vereinen und Projekten aus beiden Städten, darunter „Mein Ickern e.V.“ und das Dortmunder Projekt „nordwärts“. „Das ist es, was uns als Emschergenossenschaft ausmacht: Wir denken über Stadtgrenzen hinaus und bringen dabei Menschen und Ideen zusammen. Partizipation ist uns beim Emscher-Umbau sehr wichtig, daher haben wir uns über die Idee aus der Bevölkerung für den Namenswettbewerb sehr gefreut“, sagt Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft. Der Flussumbau, so Paetzel weiter, schafft die Bühne für weitaus größere Mehrwehrt-Effekte: Radwege, Naherholung, Tourismus und vieles mehr. „Wir schaffen mit dem Emscher-Umbau grün-blaue Infrastrukturen, die es zu erfahren und zu erleben gilt.“
Das Areal an der Stadtgrenze zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel ist ein Paradebeispiel dafür. „Es handelt sich hierbei zwar um eine technische Hochwasserschutzeinrichtung. Für die Menschen aber ist dies ein idyllisches Naherholungsgebiet – und das, obwohl die Emscher hier noch gar nicht vollständig abwasserfrei ist“, sagt Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund und zugleich auch Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft. „Daran“, so Sierau, „zeigt sich aber auch die hohe Akzeptanz der Menschen für das Generationenprojekt Emscher-Umbau.“
Sein Amtskollege Rajko Kravanja, Bürgermeister der Stadt Castrop-Rauxel, stimmt ihm bei: „Die Emscher als blaues Band der Region stiftet Identität und symbolisiert den Strukturwandel in der Region. Das spiegelt sich in der Begeisterung der Menschen für dieses Areal wider. Der Emscher-Umbau ist ein Gewinn für die Städte im Revier.“ Ein Gewinn, der sich in Castrop-Rauxel nur wenige Kilometer flussabwärts bereits andeutet: Dort entsteht in den kommenden zwei Jahren ein Natur- und Wasser-Erlebnis-Park mit einer renaturierten Emscher und einem neuen Suderwicher Bach, Radwege und Weinberge inklusive.
Die Emscher-Auen in Dortmund-Mengede und Castrop-Rauxel-Ickern sind 33 Hektar groß, das entspricht in etwa der Größe von 46 Fußballfeldern. Im Hochwasserfall kann die durch die Auen fließende Emscher über ein Drosselbauwerk zurückgestaut und damit gedrosselt werden, um die unterhalb des Beckens liegenden Städte (Castrop-Rauxel bis Dinslaken) vor den Hochwassermassen zu schützen. Insgesamt 1,1 Millionen Kubikmeter fasst das Hochwasserrückhaltebecken. Das entspricht dem Inhalt von sieben Millionen Badewannen.
Als Auen bezeichnet man übrigens die von wechselnden Hoch- und Niedrigwasser geprägten Niederungen entlang eines Baches oder Flusses – folglich also ein idealer Begriff für ein Hochwasserrückhaltebecken!
Bildzeile: „Emscher-Auen“: das Hochwasserrückhaltebecken der Emschergenossenschaft in Ickern/Mengede.
Foto: Jörg Saborowski/EGLV

Auf Fledermausbeobachtung mit den Grünen und dem NABU
Im Rahmen seiner NRW-Kommunaltour besuchte Sven Giegold, Mitglied der Grünen-Fraktion im Europaparlament im August Dortmund. Gemeinsam mit zwei Fledermausexperten des NABU Dortmund gingen gut 20 Interessierte mit Daniela Schneckenburger (Oberbürgermeisterkandidatin) und Jürgen Brunsing (Bezirksbürgermeisterkandidat der Grünen in Hombruch) auf die Entdeckung der Fledermäuse im Rombergpark.
Sven Giegold gründete den „Club der Fledermausverteidiger*innen“, als die Bechsteinfledermaus und das europäische Naturschutzrecht gemeinsam mit zehntausenden Menschen im Oktober 2018 die Rodung des Hambacher Waldes für den Abbau von Braunkohle vorerst verhindert hat.
Am See im Rombergpark konnten die Fledermäuse in der Dämmerung bei der Insektenjagd über dem See beobachtet werden. Ein Echolotgerät wandelte die hochfrequenten Rufe der Fledermäuse in hörbare Laute um, damit die Fledermausart bestimmt werden konnte. „Der Rombergpark beweist, dass die Nutzung des Parkes durch die Bevölkerung und der Naturschutz sich nicht ausschließen“, bestätigt Jürgen Brunsing.
Im Rahmen der Führung sammelten die Grünen Unterschriften für die Volksinitiative Artenvielfalt NRW. Unterschriften sind auch zu den Bürozeiten im Kreisverbandsbüro der Grünen Dortmund (Königswall 8) möglich.
Foto: Bündnis90/Die Grünen Dortmund

Dachdecker sprachen 16 Auszubildende frei
Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen hatte in kleinem Kreis in die „Speisekammer“ nach Dortmund-Deusen geladen
Mit einer kleinen Feier unter Corona-Bedingungen hat die Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen Auszubildenden offiziell in den Gesellenstand erhoben. Insgesamt 16 junge Dachdecker der Winter- und Sommergesellenprüfung 2019/2020 bekamen im Restaurant „Speisekammer“ an der Deusener Straße in Dortmund ihre Gesellenbriefe durch Obermeister Dirk Sindermann und den Prüfungsausschuss-Vorsitzenden Denis Struwe überreicht. „Herzlichen Glückwunsch“, gratulierte Obermeister Dirk Sindermann in seiner Ansprache. „Der Gesellenbrief, den Sie heute von uns bekommen, ist trotz Corona-Krise genauso wertvoll, wie in all den Jahren zuvor, wenn nicht sogar wertvoller. Denn Fachkräfte im Handwerk werden im Moment dringend gesucht. Sie sind mit dem Abschluss Ihrer Ausbildung heute genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Jetzt können Sie die Weichen für Ihre erfolgreiche Zukunft stellen.“
Eine besondere Ehrung gab es an diesem Tag für den Prüfungsbesten, Justin Wentler, vom Dortmunder Ausbildungsbetrieb Bedachungen Burmann/Weller GmbH & Co. KG. Prüfungsausschuss-Vorsitzender Denis Struwe überreichte dem erfolgreichen Junghandwerker als Anerkennung seiner Leistungen einen Buch- und Geldpreis. Abschließend lud die Innung die frischgebackenen Gesellen unter Einhaltung der Hygiene– und Abstandsregelungen zu einem kleinen Imbiss ein.
Dachdecker-Innung ist starker Verbund
Die Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen ist ein starker Verbund aus rund 60 Handwerksunternehmen der Region. Sie vertritt die Dachdecker-Betriebe in wichtigen regionalen und überregionalen Gremien und verleiht ihrer Stimme gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch Gewicht. Den Mitgliedsbetrieben bietet die Innung als Dienstleister einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Sie kümmert sich um Aus- und Weiterbildung, aber auch um juristische Unterstützung, günstige Versicherungsleistungen und aktuelle Informationen zur Betriebsführung.
Bildzeile: Zur Übergabe der Gesellenbriefe waren 16 Auszubildende auf Einladung der Innung in der Deusener „Speisekammer“ erschienen.
Foto: Innung

Innung gratuliert zu
45 Jahren Betriebszugehörigkeit
Marina Thatenhorst begeht Jubiläum im Aplerbecker Raumausstatter-Betrieb Erlei Raum und Design GmbH & Co. KG / Innung überreichte Urkunde und gratulierte im Namen des Handwerks
Zu einem ungewöhnlichen Jubiläum konnte jetzt die Raumausstatter-Innung Dortmund und Lünen in Aplerbeck gratulieren. Marina Thatenhorst, Angestellte im Betrieb Erlei Raum und Design GmbH & Co. KG an der Köln-Berliner Straße, beging ihr 45-jähriges Betriebsjubiläum. Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas ließ es sich nicht nehmen, die Ehrenurkunde zu diesem seltenen Ereignis zusammen mit Betriebsinhaberin Regina Holland-Erlei persönlich an die Jubilarin zu überreichen. „Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie sicher und langlebig eine Beschäftigung im Handwerk ist“, hob der Geschäftsführer hervor. Marina Thatenhorst hatte 1975 im Alter von 15 Jahren ihre Lehre als Bürokauffrau im Betrieb begonnen, war danach übernommen worden und blieb bis heute ihrem Arbeitgeber treu.
Die Firma als Familie erlebt
„Ich habe mich damals sehr gefreut, eine Ausbildungsstelle in meiner Heimatstadt Aplerbeck zu finden”, erinnerte sich die Jubilarin. „Sogar meine Bewerbung haben wir tatsächlich noch im Firmenarchiv gefunden. Zwei Jahre nach dem Beginn meiner Lehrzeit hat auch Frau Holland-Erlei ihre Ausbildung im Betrieb begonnen. Wir haben jetzt 43 Jahre zusammengearbeitet und gemeinsam viel erlebt.” Das konnte Regina Holland-Erlei nur bestätigen. „Frau Thatenhorst gehört quasi zur Familie unseres Handwerksbetriebs“, resümiert die Raumausstattermeisterin. „Sie hat in all den Jahren viele Stationen im Betrieb durchlaufen und sich im Verkauf, der Beratung, der Ladengestaltung und der Raumausstattung bestens bewährt.” Für kurze Zeit, so erinnert sich die 60-jährige Jubilarin, sei sie sogar als Aushilfe mit zur Montage zu den Kunden gefahren. In guter Erinnerung geblieben ist ihr auch der technische Wandel, der mit den Jahren kam. „Im Jahr 1975 hatten wir Tischrechner und Telefone in der Buchhaltung. Fax, Computer und Mobiltelefone gab es noch nicht”, weiß Marina Thatenhorst. „Dafür hatten wir schon sehr früh einen Fernschreiber, und bereits Anfang der 1980 er Jahre kam der erste Computer zu uns. Wir haben den technischen Fortschritt mitgemacht, viel Neues dazugelernt und es hat mir immer viel Freude gemacht, hier zu arbeiten.”
Unternehmen mit langer Tradition
Die Erlei Raum und Design GmbH & Co. KG an der Köln-Berliner Straße gehört zu den ältesten Betrieben der Raumausstatter-Innung in Dortmund. Das Unternehmen wurde als „Betten-Erlei“ 1928 an der Evinger Straße begründet. Der damalige Inhaber Ewald Erlei hatte mit der Raumausstattung, die es in der heutigen Form noch gar nicht gab, eine gute Geschäftsidee. 1945 zog der Betrieb dann nach Aplerbeck, zunächst in die Marsbruchstraße und 1992 an den jetzigen Standort Köln-Berliner-Straße. Regina Holland-Erlei übernahm den Betrieb 1998 und erweiterte ihn. Heute beschäftigt das Unternehmen neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu seinem Portfolio gehören Handwerk und Handel gleichzeitig, allem voran die hochqualitative Raumausstattung, Gardinen, Sonnenschutz und Heimtextilien sowie dekorative Wohn-Accessoires.
Bildzeile: Gratulation zu 45 Jahren Betriebszugehörigkeit: (v.l.) Jubilarin Marina Thatenhorst, Inhaberin Regina Holland-Erlei und Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas von der Raumausstatter-Innung Dortmund und Lünen.
Foto: Innung

Eine engagierte Mitarbeiterin –
Marianne Erdmann feiert 45jähriges Dienstjubiläum
Marianne Erdmann ist Kitaleiterin der AWO Kita Tetschener Straße in Dortmund-Hombruch. Seit 45 Jahren engagiert sie sich und unterstützt die Kinder und ihre Familien. Die ersten 19 Jahre arbeitete sie als Gruppenleitung in einer AWO Kita in Hörde. Anschließend übernahm sie die Kitaleitung in der Tetschener Straße. In manchen Familien betreut Sie inzwischen die Kinder der Kinder, die schon vor vielen Jahren in ihrer Betreuung waren. Frau Erdmann ist auch nach 45 Jahren nicht müde geworden immer wieder für die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit zu sorgen und ihre Arbeit professionell zu hinterfragen. Die AWO Vorsitzende Anja Butschkau bedankte sich bei Marianne Erdmann mit einem bunten Blumenstrauß für ihr unermüdliches Engagement.
Bildzeile: Anja Butschkau (l.) bedankte sich bei Marianne Erdmann für ihr langjähriges Engagement.
Foto: AWO Dortmund

Experten an einem Ort vereint: Das Klinikum
Nord eröffnet unfallchirurgische Ambulanz
Neue Anlaufstelle nach Unfällen: Im Klinikum Dortmund Nord wurde jetzt
eine neue unfallchirurgische Ambulanz eröffnet. Dort stehen den Patient*
innen Experten der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie
zur Seite, die u.a. auf schwere Verbrennungen, Arbeitsunfälle oder
auch Sportverletzungen spezialisiert sind. In fünf modern ausgestatteten
Behandlungsräumen können die Ärzt*innen künftig Befunde und geplante
Eingriffe auf großen Bildschirmen detailliert mit den Patient*innen besprechen.
Zudem werden bei einer entsprechenden Über- bzw. Einweisung
Reha- und verschiedene Spezialsprechstunden angeboten.
Von der Hand über die Wirbelsäule bis zum Fuß werden in der neue Ambulanz
Verletzungen und Unfallfolgen aller Art versorgt. „Wir haben verschiedene vorstationäre
Sprechstunden eingerichtet, in denen die Betroffenen von den jeweiligen
Experten für die Verletzung betreut werden“, sagt Dr. Jens-Peter Stahl, Direktor
der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. „So profitieren die
Patienten von den langjährigen Erfahrungen der Ärzte und es wird die bestmögliche
Versorgung gewährleistet. Gerade bei schweren Verletzungen ist das enorm
wichtig.“
Zusammen mit seinem Team behandelt Dr. Stahl in der unfallchirurgischen Ambulanz
neben Betroffenen nach Arbeits- und Wegeunfällen auch Patient*innen
mit einer ärztlichen stationären Einweisung sowie Schwerbrandverletzte. Zu finden
ist die Ambulanz im Erdgeschoss des Klinikzentrums Nord. Der Wartebereich
sowie die Behandlungsräume sind komplett modernisiert und passend für
die Region mit Bildern von Dortmunder Sehenswürdigkeiten wie z.B. von dem
Floriansturm oder dem Dortmunder U ausgestattet.
Die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie im Klinikum ist einer
der größten Kliniken ihrer Art in Deutschland. „Bei uns steht die ganzheitliche
Unfallchirurgie im Vordergrund – also der Patient oder die Patientin und nicht nur
das Knie, die Hüfte oder der Finger“, so Dr. Stahl. Entsprechend werden Verletzungen
aller Schweregrade nach den aktuellen medizinischen Standards behandelt.
Zudem wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Rehabilitationskliniken
die weitere Versorgung der Patient*innen von dem Team organisiert.
Foto: Klinikum Dortmund

„Ausgezeichnete Lebensqualität“:
DEKRA zertifiziert Stadt Dortmund
Matthias Witte, Geschäftsführer DEKRA Assurance Services, Dortmunds überreichte Oberbürgermeister Ullrich Sierau im Rahmen einer Veranstaltung im Ratssaal das DEKRA-Zertifikat „Stadt mit ausgezeichneter Lebensqualität“. Dortmund ist die bundesweit erste Großstadt, die mit diesem Zertifikat ausgezeichnet wird. Mit dem Zertifikat hat die DEKRA ein Instrument entwickelt, das sich für die Marktkommunikation für Kommunen eignet.
Sauberkeit, Sicherheit, Bürgerfreundlichkeit, Sozialkompetenz und Nachhaltigkeit sind wichtige Standortfaktoren und ein Zeichen für Lebensqualität in einer Kommune. Gleichzeitig bestehen hohe Anforderungen an die Qualität und Wirtschaftlichkeit der zu erbringenden Dienstleistungen. Darüber in hinaus bedarf es einer Vielzahl von Konzepten zu deren Sicherung und Zielerreichung.
Objektive Analyse und Dokumentation
Oberbürgermeister Ullrich Sierau dazu: „Wir sind eine nachhaltige Stadt, die auf ihr kommunalpolitisches Handeln stolz sein kann. Die Dortmunder Stadtverwaltung und unsere kommunalen Beteiligungsgesellschaften leisten viel für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Daher war es schon lange unser Wunsch, alle Handlungsfelder und Aktivitäten gebündelt und transparent darzustellen. DEKRA hat unsere vielfältigen Angebote und Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge objektiv analysiert und dokumentiert. Mit dem Zertifikat ‚Stadt mit ausgezeichneter Lebensqualität‘ halten wir nun, neben dem WOH „Wirkungsorientierter Haushalt“, ein weiteres wichtiges Dokument in der Hand, die Stadt zu präsentieren.“
Fünf Handlungsfelder: Sauberkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Urbanes Leben und Wohnen
Der umfangreiche Audit-Prozess durch DEKRA – Europas größte Sachverständigen-Organisation – umfasst eine ganzheitliche Dokumentation, Analyse und perspektivische Bewertung der verschiedenen richtungsweisenden Planungsgrundlagen der Stadtverwaltung zu den fünf Handlungsfeldern Sauberkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Urbanes Leben und Wohnen. In die Analyse wurden über 20 Masterpläne, Konzepte, Bürgerbefragungen und Zukunftsprogramme einbezogen. Dazu gehörten z. B. die Masterpläne „Kommunale Sicherheit“, „Wohnen“, „Einzelhandel“, „Mobilität“, das Handlungsprogramm „Klimaschutz“ oder das Zukunftsprogramm „Dortmund – eine wachsende Stadt“ und das „Integrierte Stadtsauberkeitskonzept“.
Transparenter Gesamtüberblick
„Nach sorgfältiger Auswertung aller Unterlagen und ausführlichen Befragungen haben die Audits zu diesem positiven Ergebnis geführt“, sagt Matthias Witte, Geschäftsführer der DEKRA Assurance Services. „Ein solcher Auditbericht umfasst nicht nur den Status, sondern wir geben auch weitere Empfehlungen ab. Deshalb bin ich mir sicher, dass dieses strukturierte Audit mit Zertifikat, das im Erfolgsfall verliehen wird, auch für andere Städte von Interesse sein kann.“
Alle am Zertifikatsprozess Beteiligten waren sich einig, dass eine imagefördernde Zusammenführung der zahlreichen kommunalen Dienstleistungen in einem verständlichen und transparenten Gesamtüberblick dringend notwendig war. Nicht repräsentative Bürgerbefragungen oder von unterschiedlichen Institutionen veröffentliche Rankings bilden zumeist nur einen Ausschnitt des kommunalpolitischen Handels ab. Sie sind nicht immer objektiv, nicht immer transparent. Für die Stadt hat das DEKRA-Zertifikat hier eine andere Qualität, von der die Stadt Dortmund und in Folge weitere Städte, die sich zertifizieren lassen, profitieren werden.
Erste Kontakte der EDG zu DEKRA aufgrund der angestrebten Zertifizierung „Stadt mit ausgezeichneter Straßenreinigung“ durch DEKRA (seit September 2018) endeten im Mai 2019 in einer Pilotskizze zum Zertifikat „Stadt mit ausgezeichneter Lebensqualität“. Im September 2019 kam es zur Beschlussfassung im Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund. Der Prozess wurde von INFA, Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH, betreut. Nach der Zertifikatsübergabe im August 2020 sind regelmäßige Nachaudits in den Folgejahren vorgesehen.
Bildzeile: v.l. Bastian Prange (Geschäftsführer EDG), Matthias Witte (Geschäftsführer DEKRA), Matthias Kozka (Stadt Dortmund), Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Rüdiger Reuter (INFA).
Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Mit der Performance POSITIONEN gelingt „vier.D“ ein künstleri-sches Experiment im öffentlichen Raum
Positionen beziehen ist Teil gesellschaftlichen Miteinanders. In ihrer neuen Inszenierung „POSITIONEN“ spürten die Künstler*innen von vier.D den Bedingungen und Möglichkeiten von Positionen und Haltungen nach. Wie werden Positionen als solche erkannt? Welche Möglichkeiten gibt es, Positionen einzunehmen? Diese und weitere Fragen stellten die Performer*innen Pia Alena Wagner, Constantin Hochkeppel und Thomas Kemper unter Anleitung der Künstlerischen Leiterin und Choreografin Birgit Götz und dem Regisseur und Dramaturgen Thorsten Bihegue. Die Künstler*innen erforschten in ver-schiedenen Aktionsformaten, Performances und Choreografien was es heißt, Positionen zu beziehen und Haltungen einzunehmen. Unterstützt wurden die Performer*innen von einem Sprech- und Bewe-gungsensemble.
POSITIONEN als künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum
In insgesamt elf szenischen Bildern wurden Fragen gestellt, Positionen eingenommen und Haltungen herausgefordert. Besonders spannend: Das Projekt lebte von Interaktionen mit zufälligen Passant*in-nen. Ohne vorherige Ankündigung der Spielorte und -zeiten fanden sich zur Premiere von POSITIO-NEN am 22.August 2020 über 120 Passant*innen am Stadtgarten Dortmund ein, die gebannt den unerwarteten Performances folgten. Die künstlerische Leitung und Choreografin Birgit Götz zeigte sich zufrieden und war begeistert vom reibungslosen Ablauf und dem großen Interesse des zufälligen Publikums.
Bereits das erste der elf Bilder generierte ein großes Publikum. Auf den Bänken rund um die U-Bahn-haltestelle Stadtgarten fanden sich Gruppen aus Teilnehmer*innen des Sprech- und Bewegungsen-sembles, die in kurzen Szenen die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Neben zwei Bräuten, die gespannt auf ihren großen Moment warteten und Passant*innen befragten, wann es denn endlich losginge, fanden sich Maskenträger*innen ein. Ein Stückchen weiter wurden literarische Werke rezitiert. Den Passant*innen bot sich so eine Auswahl aus insgesamt sieben verschiedenen Installationen, die für Gesprächsstoff sorgten. Zeitgleich fand, auf der anderen Seite der U-Bahn Haltestelle, eine Perfor-mance der Solokünstler*innen statt, die – ausgestattet mit Stadtplänen und Koffern – von sich aus die Interaktion mit Passant*innen suchten.
Fusion mit einer weiteren Performance:
Ergänzt wurde POSITIONEN durch Beiträge aus der Inszenierung „Wir bitten um Anwesenheit“, die das Junge Ensemble von vier.D erarbeitet hat. Unter der Leitung von Birgit Götz und Cordula Hein beschäftigten sich junge Performer*innen mit dem Thema Anwesenheit. Aus einer diskursiven Ausei-nandersetzung mit sich selbst und anderen resultierte die Performance „Wir bitten um Anwesenheit“, die mit einer getanzten Choreografie und einer Performance an der Schnittstelle von Schauspiel und Tanz die künstlerische Aktion POSITIONEN begleitete. Beide Inszenierungen ließen sich als gegen-seitiger Kommentar verstehen auf der Suche nach Antworten und der Suche nach Fragen. „Was woll-ten Sie schon immer einmal gefragt werden?“ fragte Thomas Kemper, „Lohnt sich ein Leben für die Kunst?“ fragte das Junge Ensemble. „Woran erkennt man die Leute auf der Straße?“ fragte schließlich das Sprechensemble, bevor es beim Versuch, Antworten zu finden bloß weitere Fragen aufwarf.
Der Blick, der von großen Fragen zu immer kleineren Details führte, fand sich auch in den Choreo-grafien des Bewegungsensembles und den tänzerischen Performances der Solokünstler*innen wieder. Durch dialogische Szenen wurden Gewohnheiten befragt, durch choreografische Bilder wurden Detail-fragen im großen Rahmen verkörpert. Die spartenübergreifende Arbeitsweise trug dazu bei, dass Fragen, die sich aus bestimmten und unbestimmten Haltungen ergaben, nicht beantwortet, sondern konsequent weiterentwickelt wurden. Dabei blieb genügend Raum, um auf die Gegebenheiten der jeweiligen Spielorte einzugehen und Interaktionen durch das Publikum zu berücksichtigen. Nach die-sem Wochenende lässt sich bereits festhalten, dass die Premiere am Stadtgarten sich deutlich von der Performance am Nordmarkt, die am Sonntag, den 23.August 2020 stattfand, unterschieden hat. Bei-den Aufführungen gemeinsam war eine positive, interessierte Aufnahme durch das zufällige Publikum. Interessierte Zuschauer*innen zeigten sich begeistert von den Aktionen im öffentlichen Raum. Am kommenden Wochenende wird vier.D erneut im Stadtbild Positionen einnehmen und Haltungen her-ausfordern.
POSITIONEN
vier.D arbeitet an der Schnittstelle von Performance, Tanz und Theater. Mit dem In-terventionslabor im öffentlichen Raum erforscht vier.D persönliche Haltungen und öf-fentliche Positionen. POSITIONEN versteht sich als Experiment, um der Frage nach-zuspüren, was Positionen eigentlich bedeuten, was sie auszeichnet und wie sie als sol-che erkannt werden können. Dabei geht es nicht darum, Antworten zu finden, sondern Fragen zu stellen, um eine produktive Reibungsfläche zu kreieren. In diesem diskursi-ven Rahmen reiht sich POSITIONEN in die bisherigen Produktionen von vier.D ein, die allesamt dazu einladen, Sehgewohnheiten zu hinterfragen und weiterzudenken.
Bildzeile: Das Foto zeigt den Künstler Constantin Hochkeppel.
Foto: Jan Reckweg

Schmuckstück für Dortmunds Sportler*innen: Leichtathletikstadion in Hacheney heute feierlich eröffnet
Im März 2016 hat der Rat der Stadt Dortmund den Beschluss zum Neubau eines Leichtathletikstadions in Hacheney gefasst. Nach fast vier Jahren Bauzeit kann mit dem Abschluss des ersten Bauabschnitts endlich ein echtes Schmuckstück der Dortmunder Sportflächen an die Nutzer*innen übergeben werden. Damit bieten sich den Dortmunder Leichtathletikvereinen aber auch den angrenzenden Schulen und insbesondere dem Sportgymnasium neue hervorragende Trainingsmöglichkeiten.
Reines Leichtathletikstadion
Der Neubau in Hacheney wurde notwendig, weil die Inanspruchnahme des Stadions Rote Erde als zentrale Trainings- und Wettkampfstätte der Dortmunder Leichtahtleten*innen und anerkanntes Bundesleistungszentrum durch immer weiter verschärfte Sicherheitsauflagen für die Bundesligaspiele im Signal-Iduna-Park und die Austragung von Ligaspielen im Amateurbereich ab Regionalliga stark zugenommen hat.
Politischer Konsens war der Bau eines reinen Leichtathletikstadions auf der ehemaligen Bezirkssportanlage in Hacheney, die bis dato fast ausschließlich von Fußballern genutzt wurde. In Hacheney ist nun eine neue vom Fußball komplett unabhängige Anlage für die Leichtathletik entstanden.
Der Ausbau soll in 3 Stufen erfolgen
Stufe 1: Errichtung einer Rundlaufbahn um eine Naturrasenfläche mit leichtathletischen Nebenanlagen (Weitsprung, Kugelstoßen) nach aktuellem technischem Standard und der Bau eines Beachvolleyballfeldes neben der alten Sporthalle Hörde 1.
Stufe 2: Errichtung einer Wurftrainingsanlage (Speer, Hammer und Diskus)
Stufe 3: Errichtung einer Tribüne für Wettkampfveranstaltungen
Die zweijährige Verzögerung bei der Fertigstellung und die Kostensteigerung (von 1,8 auf 3,3 Millionen Euro) begründen sich in erster Linie durch den Bau eines Regenrückhaltebeckens unterhalb der Naturrasenfläche, die gestiegenen Deponiegebühren sowie insbesondere durch aufwändige aber zwingend notwendige Verfüllmaßnahmen alter Schächte und Gänge aus Zeiten des oberflächennahen Bergbaus und die allgemeine Kostensteigerung im Baugewerbe.
„Mit dem Stadion Rote Erde, der Helmut-Körnig-Halle, dieser neuen Anlage in Hacheney sowie dem ebenfalls in diesem Jahr an den Start gehenden neuen Leichtathletikstadion in Lanstrop und 16 weiteren Stadien im Stadtgebiet mit gut ausgestatteten Nebenanlagen für die Leichtathletik verfügt diese Kernsportart in Dortmund über eine landesweit einmalige und hochmoderne Infrastruktur“, sagte OB Ullrich Sierau heute anlässlich der Eröffnung des Stadions. „Wir investieren in die Infrastruktur für den Breiten- und Spitzensport und damit in die Zukunft unserer Stadt.“
„Das neue Leichtathletikstadion ist ein zentraler Baustein für die vielfältige Sportstadt Dortmund. Vor allem durch die aufwändigen Verfüllmaßnahmen der alten Schächte war Geduld gefragt. Das Warten hat ein Ende“, so Dortmunds Sportdezernentin Birgit Zoerner. „Über die Fertigstellung nach fast vierjähriger Bauzeit freue ich mich gemeinsam mit den Sportler*innen sehr.“
Für Michael Adel, Vorsitzender des Kreisleichtathletikausschusses Dortmund liegen die Vorteile der neuen Anlage auf der Hand: „Das neue Stadion ist ein weiterer Schritt zur Stärkung des Leichtathletik-Standortes Dortmund und wir sind sehr froh darüber, dass Verwaltung und Rat derartige Investitionen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben. Der Standort in Hacheney ist eine große Chance, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Gymnasium junge Athletinnen und Athleten in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen.“
Aktuell laufen die Bauarbeiten zur Sanierung der Umkleidekabinen und des Vereinsheims sowie die planerischen Vorarbeiten zur Ausschreibung der 2. und 3. Ausbaustufe. Hierfür ist die politische Beschlussfassung im Frühjahr 2021 geplant. Im Endausbaustadium wird das neue Stadion in Hacheney dann auch die Möglichkeit für die Austragung von regionalen Meisterschaften bieten.
Deutliche Reduzierung der Verkehrsbelastung
In einem vorgeschalteten intensiven Dialog mit den Anliegern und der Ortspolitik wurden im Vorfeld viele Bedenken und Vorbehalte besprochen und im Konzept berücksichtigt. Die Umsetzung der Vorgaben aus Lärm- und Lichtgutachten, die neue Anbindung des Stadions über die Stettiner Straße, sowie der geplante Ausbau des dortigen Parkplatzes werden den Anliegern in dem Wohngebiet zwischen Massenezstraße und Hacheneyer Kirchweg gegenüber der früheren Nutzung als Fußballsportanlage eine deutliche Reduzierung der Lärm- und Verkehrsbelastung bringen.
Seit Beginn der Sommerferien nutzen bereits viele Sportvereine – wenn auch coronabedingt eingeschränkt – die Sportanlage zu Trainingszwecken.
Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Baumpflanzungen und Neugestaltung der Baumscheiben in der Hohenfriedberger
Straße – Anlieger*innen und Grünflächenamt finden zusammen
In der Hohenfriedberger Straße wurden bereits einige Bäume gefällt und in der Summe werden es 26 Bäume sein, die aus Gründen der Verkehrsicherheit durch das Grünflächenamt gefällt werden müssen.
Das führte in den letzten Wochen zu vielen Fragen in der Anwohnerschaft. Die Sprecherin der Anwohner*innen, Sabine Jäger nahm Kontakt mit dem Grünflächenamt auf und organisierte die Anwohner*innen-Versammlung unter Corona-Bedingungen.
Fast 40 Menschen aus der Straße nahmen teil – bereits im Vorfeld waren rund 130 Unterschriften zusammengekommen, um deutlich zu machen, dass es unbedingt Zukunftsbäume sein sollen, die als Ersatz neu gepflanzt werden. Ein starker und sichtbarer Beleg für das große Bürger*innen-Interesse am Klimaschutz.
Der intensive Austausch mit den Anlieger*innen der Hohenfriedberger Straße, vielleicht eine neue Form der Beteiligung von Anwohner*innen, entsprechen genau der Philosophie des Grünflächenamtes, bei der Kommunikation und Bürger*innen-Beteiligung ganz oben steht.
In diesem Sinne begrüßten Ulrich Finger, Leiter des Grünflächenamtes und Lars Terme, Bezirksleiter im Grünflächenamt und „Herr der Bäume“ in Dortmund, die Anlieger. In einer sehr angenehmen Atmosphäre, gab es einen spannenden Vortrag von Lars Terme zu der gegenwärtigen, durch den Klimawandel geprägten Situation der Stadtbäume.
Anschließend wurde die Situation in der Straße diskutiert. Geplant ist nun, dass bis Ende September die sichtbar geschädigten Bäume gefällt werden. Wie geht es dann weiter? Das war von besonderem Interesse der Anlieger. Nach der Fäll-Maßnahme werden die Gehwege und Randbereiche instandgesetzt. In diesem Zuge werden die vorhandenen Baumscheiben ertüchtigt. Das bedeutet, neben der baulich neuen Einfassung, wird der Wurzelraum vergrößert und mit frischem Pflanzsubstrat gefüllt. Die Baumpflanzungen sind für die kommende Winter-/Pflanzperiode vorgesehen.
Wenn alles gut läuft, werden Ende März/Anfang April 2021 die neuen Bäume die Straße schmücken.
Foto: Stadt Dortmund
Doch welche Bäume sollen gepflanzt werden? Auch dazu gab es eine
angenehme und konstruktive Diskussion. Die Anlieger wünschen sich
Linden, begründet durch die nachweisbar hohe Nachhaltigkeit dieser
Baumsorte. Auch der Hinweis von Herrn Terme, dass die darunter
stehenden Fahrzeuge vielleicht öfters gewaschen werden müssen, konnte
die Anlieger von ihrem Wunsch nicht abbringen. Ergänzt werden die
Linden von Hopfenbuchen, ein Wunsch des Grünflächenamtes. Somit ein
einvernehmlich positives Ergebnis des Anliegergespräches.
Das Grünflächenamt sagte zu, dass die Anlieger über die anstehenden
Einzelmaßnahmen jeweils frühzeitig informiert werden.
Am Ende des Gesprächs bot Amtsleiter Ulrich Finger den Anlieger*innen
Baumpatenschaften für die zukünftigen neuen pflanzlichen
Straßenbewohner an. Und so wird es im kommenden Jahr in der
Hohenfriedberger Straße im Rahmen einer Patenschaftsfeier zur Übergabe
der Baumscheiben an die Anlieger*innen kommen. Auch die damit
verbundenen Aufgaben, in erster Linie das Gießen der Jungbäume, wollen
die zukünftigen Paten gern übernehmen.
Dürfen wir die Baumscheiben gestalten? Diese Frage ergab sich auch sehr
schnell – und weil auch dies möglich ist, wird es bald neben einer
neuen Allee also auch 26 neue Mini-Gärten in der Hohenfriedberger Straße geben.

Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof: Die zweite neue mittlere Zugangsanlage auf der Ostseite wird in Betrieb genommen
Am 5. März 2020 wurde zunächst die neue Zugangsanlage auf der Westseite durch Oberbürgermeister Ullrich Sierau in Betrieb genommen. Mit einiger Verzögerung kann nun auch die neue Zugangsanlage im Mittelbereich auf der Ostseite ihren Betrieb aufnehmen.
Nachdem die Arbeitsschutzwände Ende Juli 2020 in Teilen bereits entfernt werden konnten und die Fahrgäste schon einen kleinen Einblick in die Baustelle bekommen haben, erfolgte jetzt die Abnahme der Anlage nebst Aufzug durch die Technische Aufsichtsbehörde. Nun kann die neue Zugangsanlage offiziell freigegeben und an die Betreiberin DSW21 übergeben werden.
„Mit der heutigen Inbetriebnahme der zweiten Zugangsanlage konnte ein weiterer Meilenstein im Projekt „Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof“ erreicht werden“ so Sylvia Uehlendahl, die Leiterin des Tiefbauamtes. „Nun steht den Fahrgästen auch auf der Ostseite neben der neuen Treppenanlage eine neue komfortable Aufzugsanlage zur Verfügung.“
Auch hier wurde ein sogenannter „Durchlader“ mit einem Fahrstuhlschacht aus Stahl/Glas und Platz für 18 Personen eingebaut, der insbesondere für Rollstuhlnutzer*innen, Fahrgäste mit Kinderwagen oder Radfahrende bequemer ist. Ein umständliches Rangieren im Aufzug bzw. das „Rückwärtsherausfahren“ ist ab sofort nicht mehr notwendig.
Nun können auch auf der Ostseite die Umbauarbeiten an der alten südöstlich gelegenen Zugangsanlage mit dem Ausbau der alten Fahrtreppe begonnen werden. Da den Fahrgästen aus Sicherheitsgründen immer zwei Zugangsanlagen zur Verfügung stehen müssen, konnten die Umbauarbeiten nicht parallel verlaufen. Nun folgen die Abbauarbeiten der alten Rolltore und der Abbruch der ehemaligen Läden. Dann wird die alte Fahrtreppe soweit losgestemmt, dass sie – etwa Mitte September – herausgezogen werden kann. Dann wird auch der alte Aufzug im Nordausgangsbereich entkernt und entfernt. Nach diesen Arbeiten werden zum Schutz der Fahrgäste neue Schutzwände aufgebaut, damit dahinter die weiteren Ausbauarbeiten erfolgen können.
Nachdem sich aufgrund der Corona-bedingten Lieferschwierigkeiten der Baustoffe für den östlichen Bahnsteigbereich die kalkulierte Bauzeit und Eröffnung um ca. 4 Monate verzögert hat, wurden die Arbeiten im Tunnelbereich und im Bereich der Fußgängeranlage Königswall baulich vorgezogen. Für diesen Bereich waren die Materialien bereits vorgefertigt und auf der Baustelle eingelagert. Somit konnte ein kontinuierlicher Bauablauf gewährleistet und Auswirkungen auf die Gesamtbauzeit vermieden werden. Die Ausbauarbeiten sind in diesem Bereich schon weit fortgeschritten und können bald abgeschlossen werden.
Laufend erfolgen weiterhin die betriebs- und elektrotechnische Ausrüstung der Anlage und die Arbeiten zum Umbau der südlichen Zugangsanlage auf der Westseite.
Bildzeile: Sylvia Uehlendahl (Leiterin des Tiefbauamtes) und Ralf Habbes (Betriebsleiter DSW21) geben den neuen Bereich der Stadtbahnanlage frei.
Foto: Jörg Schimmel/DSW21

Gründer aufgepasst: der „Aufzug des Grauens“ wartet – Dortmunder Startup-Schmiede perpetuo veranstaltet Pitch-Wettbewerb der ganz besonderen Art
Mittwoch, den 23. September 2020 sollten sich Startups aus Dortmund und der Region schon einmal rot im Kalender anstreichen. Denn dann können sie ihr Unternehmenskonzept einer hochkarätigen Jury vorstellen. Angelehnt an das Prinzip des „Elevator Pitch“ wird der „Aufzug des Grauens“ den Gründerinnen und Gründern im Rahmen der „startupweek:RUHR“ einheizen. Bis zum 11. September können sich potentielle Teilnehmer bewerben, den Gewinnern winkt ein attraktiver Preis.
Was passiert beim „Aufzug des Grauens“?
Startups erklären (pitchen) ihre Geschäftsidee innerhalb von einer Minute während sie mit dem Aufzug vom Erdgeschoss bis in die 6. Etage fahren. Oben angekommen treffen sie im NoBuzzwords Space auf eine Fachjury, bestehend aus renommierten Venture-Capital-Gebern, Gründern und Unternehmensvertretern, und müssen sich Fragen zu ihren Geschäftsmodellen stellen. Als wäre das nicht schon stressig genug, wird das Event live online gestreamt, so dass die Welt es mit verfolgen kann. Am Ende der Veranstaltung wird das beste Startup prämiert.
Neugründer, die dabei sein wollen, können sich ab sofort und bis zum 11. September mit ihrer Idee per E-Mail an nextlevel@perpetuo.de bewerben. Die Erstplatzierten gewinnen für drei Monate Büroplätze auf der Coworking-Fläche des NoBuzzword Space – inklusive vieler spannender Kontakte zu etablierten Gründern, Investoren, Beratern und Hidden Champions.
Publikum kann sich bereits anmelden
Die Veranstaltung im „NoBuzzwords Space“ steht auch Besuchern offen, der Eintritt ist frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Interessierte, die bei dem Abend-Event am 23. September ab 18.30 dabei sein möchten, können sich deshalb bereits jetzt unter: https://www.meetup.com/de-DE/Dortmund-Unternehmertum-Meetup-Gruppe/events/272248477/ anmelden.
Bildzeile: Im NoBuzzword Space der Startup-Schmiede perpetuo wartet am 23. September 2020 ab 18:30 Uhr der „Aufzug des Grauens“ auf Startups aus der Region.
Foto: Oliver Schaper

Aktionswoche gegen Rechts im Landesbezirk NRW gestartet – lokale Aktionen folgen
Mitte August startete im Landesbezirk NRW die Aktionswoche gegen Rechts der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), um im Vorfeld der Kommunalwahlen ein Zeichen gegen Rassismus und rechte Ideologien zu setzen. Der Slogan der Aktionswoche lautet „Nazis raus aus Parlamenten und Betrieben“.
In einer Pressekonferenz machte die Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt noch einmal deutlich, „dass ver.di bei Weitem nicht nur für Tarifpolitik steht. Wir haben als Gewerkschaft auch den klar definierten Auftrag, über rechte Tendenzen in der Gesellschaft, aber auch in Wahlprogrammen, aufzuklären und uns entschlossen rechtspopulistischen und rechtsextremen Organisationen und Parteien entgegenzustellen.“
Im Anschluss stellten die ehrenamtlichen Mitglieder des Landesbezirksvorstands, Martina Rößmann-Wolf, Hans-Jürgen Schneider und Thomas Komann eine Auswahl der bezirklichen Aktionen sowie die seit mehreren Jahren erfolgreich durchgeführte „Stammtischkämpfer*innen-Ausbildung“ vor. Vor allem bei der Deutschen Post AG läuft das Programm sehr erfolgreich, mittlerweile gibt es bundesweit bereits über 15.000 Stammtischkämpfer*innen in den unterschiedlichsten Branchen.
„Ziel des Programms ist es, unseren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, in einer Debatte klare Kante gegen rassistisches Gedankengut und rechte Parolen zeigen zu können“, so Thomas Komann.
Nach der Pressekonferenz wurde zudem das neu angebrachte Banner an der Aussenfassade des Landesbezirks vorgestellt und die erste von vielen Sprühkreideaktionen in NRW durchgeführt.
Foto: ver.di

Spielcontainer an der Heroldwiese steht den Kids in der Nordstadt auch nach den Sommerferien zur Verfügung
Auch nach den Sommerferien in NRW wird der Spielcontainer an der Heroldwiese weiter für die Kinder der Nordstadt –unter Einhaltung der COVID-19 Einschränkungen / Maßnahmen – durch Mitarbeiter*innen der Stadtteil-Schule Dortmund e.V. in den kommenden Tagen und Wochen geöffnet bleiben.
Die Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag jeweils 14 Uhr bis 18 Uhr (wetterbedingt eventuell Verschiebung der Öffnungszeiten)
Die Angebote:
Die Kinder können am Spielcontainer kostenfrei Spielgeräte ausleihen wie z.B. Bälle, Frisbees, Hula-Hoop Reifen, Springseile, „Leitergolf“… (diese werden regelmäßig desinfiziert) und diese vor Ort „bespielen“
Des Weiteren werden Malangebote bereitgestellt; u.a. können die Kinder sich vor Ort auch ihr eigenes „Echt Nordstadt“ Malbuch (vom Quartiersmanagement der Nordstadt) abholen und dieses am Spielcontainer ausmalen oder auch mit nach Hause nehmen.

10 Jahre Italienverein Bereits seit zehn Jahren ist der Italienverein in Dortmund und dem Ruhrgebiet aktiv. Mit Austauschprogrammen, Sprachkursen, Workshops, Ausstellungen und vielen anderen Projekten bringen die Ehrenamtlichen Aktiven sich gegenseitig die jeweilige Kultur näher. Anstatt einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung haben sich die Mitglieder dafür entscheiden, ein lockeres Picknick anlässlich des Jahrestags zu machen.Ein Picknick mit AbstandLange haben sich die Mitglieder des Vereins nicht gesehen. In den letzten Monaten sind viele Veranstaltungen coronabedingt ausgefallen oder wurden in den virtuellen Raum verschoben. Nun genießen es die Mitglieder, sich einmal wieder zu sehen – im Freien und mit Abstand bei einem Picknick, welches am 15. August auch gleichzeitig dem italienischem Fest „Ferragosto“ gewidmet ist. Der 15. August gilt in Italien als der heißeste Tag des Sommers und kennzeichnet somit den „Wendepunkt des Sommers“.Ein Stipendium – Gutes Tun in und für ItalienEbenfalls im freien und mit Abstand wurde das ausgeschriebene Stipendium übergeben. Hannah Wollny ist 26 Jahre alt, sie hat bald den Abschluss an der Uni geschafft und bevor das Referendariat an der Schule beginnt, möchte sie die Zeit nutzen, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Sie habe bereits Erfahrung in der Arbeit mit gesellschaftlich benachteiligten Kindern und Jugendlichen, so schrieb sie in Ihrer Bewerbung um das Stipendium. Nun wird Hannah im Frühjahr 2021 nach Italien reisen und in Viareggio im „Casa delle donne“, einem Frauenhaus, das Team vor Ort ehrenamtlich unterstützen. Mit dem Stipendium unterstützt der Italienverein mit 500,- € dieses Vorhaben und vermittelt den Kontakt zu der Partnerorganisation.Foto: Italienverein Dortmund

Ausbildung 2020: Auch ein späterer Start ist möglich – viele Unterstützungsangebote für junge Leute
Der 1. August gilt traditionell als Start des Ausbildungsjahres. Corona-bedingt ist im Jahr 2020 vieles anders: Ausbildungsmessen fielen aus, Vorstellungsgespräche wurden verschoben. Die Folge: Der Ausbildungsmarkt ist in seiner Entwicklung mehrere Wochen hinterher. Über diese Entwicklung tauschten sich die Mitglieder des städtischen Beirats „Übergangsmanagement Schule-Arbeitswelt“ aus – ein gut funktionierendes Netzwerk aus Schulen, Wirtschaft, Hochschulen und weiteren Akteur*innen der beruflichen Bildung. Der Tenor: Ein Ausbildungsstart ist in diesem Jahr auch nach dem 1. August möglich.
„Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Ausbildungsmarkt aus. Noch sind nicht alle junge Menschen, die in Ausbildung gehen könnten, vermittelt – und dies trotz noch vorhandener Ausbildungsplätze. Wir müssen gemeinsam unsere Anstrengungen verstärken, damit es gelingt, möglichst viele junge Menschen noch im kommenden Ausbildungsjahrgang mit einem Ausbildungsplatz zu versorgen – das ist wichtig für sie, aber auch für die Unternehmen, die dringend nach Nachwuchskräften suchen. Auf dieses Ziel richten wir uns mit unterschiedlichen Instrumenten aus. Der Fachbereich Schule hilft beratend, berufliche Orientierung und neue Perspektiven bei den jungen Menschen zu entwickeln“, sagt Daniela Schneckenburger, Schuldezernentin und Mitvorsitzende des Beirates.
Für viele Jugendliche und Unternehmen beginnt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr der Endspurt am Ausbildungsmarkt später als gewohnt. „Allerdings ist es ein Mythos, dass es keine Ausbildungsplätze in diesem Jahr mehr gibt. Der Ausbildungsmarkt hängt rund sechs bis acht Wochen in der Besetzung freier Stellen zurück. Der finale Endspurt wird sich daher in diesem Jahr nicht wie üblich im August abspielen, sondern auch in die Zeit der Nachvermittlung ziehen. Ein Ausbildungsbeginn ist bis spät in den Herbst möglich“, kommentiert Heike Bettermann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Dortmund und Mitvorsitzende des Beirates, die Situation auf dem Dortmunder Ausbildungsmarkt.
Noch über 1000 freie Ausbildungsstellen
Ende Juli waren in Dortmund für das Ausbildungsjahr 2020 noch 1.314 freie Ausbildungsstellen gemeldet. Arbeitgeber*innen melden der Agentur für Arbeit Dortmund täglich weitere freie Stellen und hoffen auf eine schnelle Besetzung zur Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs.
„Der Ausbildungsstart 1. August ist nicht in Stein gemeißelt. Unternehmen werden auch bis in den Winter hinein noch Auszubildende einstellen“, ergänzt Michael Ifland, IHK-Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Berufliche Bildung und Fachkräftesicherung sowie Mitvorsitzender. „Umso wichtiger ist es, dass wir heute gemeinsam Unterstützungsangebote aufeinander abstimmen und die Jugendlichen bestmöglich bei ihrem Übergang in Ausbildung unterstützen.“
Die Schulen setzen die berufliche Orientierung nach den Vorgaben der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ in diesem Schuljahr wieder um. Sie werden durch die regionalen Partner hierbei intensiv unterstützt. „Trägergestützte Standardelemente können nachgeholt werden, in den Herbstferien sollen die in den Sommerferien angelaufenen Ferienkurse „Eine Woche berufliche Orientierung extra“ für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 und 10 fortgesetzt werden. Fünf Tage lang können Schüler*innen dann praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern erwerben“, beschreibt Holger Nolte, Schulrat im Schulamt für die Stadt Dortmund.
Vorstellung per Video-Chat
Corona-bedingt mussten darüber hinaus in kürzester Zeit neue, digitale Wege entwickelt werden, um junge Menschen anzusprechen. Die Angebote reichen von der Ausbildungsplatzsuche bis hin zur Berufsorientierung oder Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz. Junge Menschen, die noch auf der Suche sind, erhalten ab Mitte September beim gemeinsamen Azubi-Speed-Dating der IHK zu Dortmund und der Handwerkskammer Dortmund einen Monat lang (14. September bis 13. Oktober) die Chance, sich Unternehmen persönlich im Chat vorzustellen. Angeboten werden Ausbildungsplätze aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung zur sofortigen Besetzung und für das Ausbildungsjahr 2021. Nähere Informationen unter www.dortmund.ihk24.de.
Weitere Angebote im Überblick
Die Lehrstellenbörsen der IHK-Organisation und der Handwerkskammer verzeichnet noch viele freie Stellen:
www.ihk-lehrstellenboerse.de und
https://bz.hwk-do.de/de/ausbildung/wissenswertes-fuer-schueler/lehrstellenboerse
Auch auf der Seite des Jugendberufshauses Dortmund sind noch Ausbildungsstellen veröffentlicht: www.jugendberufshaus-dortmund.de/ausbildungsstellenangebote/
In allen Fragen rund um die Ausbildungssuche kann die Hotline 0231 842-9860 angerufen werden. Das Jugendberufshaus bietet auch konkrete Unterstützung bei der Bewerbung.
Bewerbungscoachings gibt es im Berufsinformationszentrum (BiZ). Kostenfreie Anmeldung dafür im Jugendberufshaus unter (0231) 842 9860. Wer sich nicht sicher ist, ob die eigene Bewerbung korrekt und attraktiv ist, kann das BiZ-Team per Mail um eine Rückmeldung/Korrektur bitten, zudem wird eine postalische Zusendung ausgedruckter Bewerbungen angeboten. Wer daran interessiert ist, schickt seine digitalen Unterlagen an Dortmund.BIZ@arbeitsagentur.de.
Der DASA-Jugendkongress findet unter dem Namen „JobVille“ virtuell statt: am 16. September, 11 Uhr. Die Webseite dazu mit aktuellen Informationen und praktischen Tipps:www.jobville.de.
Die Social-Media-Kampagne „Dortmund at work“ des Regionalen Bildungsbüros im Fachbereich Schule stellt Dortmunder Unternehmen und Auszubildende vor. Ein spezielles Angebot für junge Menschen, die sich für die Teilzeitausbildung interessieren, findet vom 21.-24. September auf Instagram statt. An jedem Tag wird ein Beruf und ein Unternehmen vorgestellt, bei dem eine Teilzeitausbildung möglich ist.
Weitere Informationen:
www.jugendberufshaus-dortmund.de
www.dortmundatwork.de
www.ihk.dortmund.de
www.hwk-do.de
Bildzeile: Beiratssitzung mit Schuldezernentin Daniela Schneckenburger (vorne. 2.v.li.), Heike Bettermann (Vorsitzende der Agentur für Arbeit Dortmund, vorne, 3.v.li.) und Holger Nolte, Schulrat im Schulamt für die Stadt Dortmund, vorne links).
Foto: Roland Gorecki, Dortmund Agentur

Das Grünflächen dankt den Paten des Rosengartens im Rombergpark
Seit vielen Jahren sind Walter Nehrig und Heinz Helmut Bussemas eine verlässliche Größe, wenn es um die Pflege des Rosengartens im Rodenbergpark geht. Damit unterstützen sie nicht nur tatkräftig die Mitarbeiter*innen des Grünflächenamtes, sondern für viele Aplerbecker Bürger*innen ist es ein Freude, den gepflegten Rosengarten zu besuchen.
Zu einem Gespräch vor Ort, in Verbindung mit einem großen Dankeschön für die Arbeit, hatte die Amtsleitung des Grünflächenamtes Ulrich Finger und Heiko Just, eingeladen. Es entwickelte sich ein spannendes Gespräch, in dem deutlich wurde, mit welch einer Verbundenheit zur Natur und insbesondere zu Rosen, der Rosengarten gepflegt wird.
Als Mitglieder der Dortmunder Rosenfreunde (Dachverband: Deutsche Rosenfreunde) verfügen Walter Nehrig und das Ehepaar Bussemans über eine beeindruckende Kompetenz, von der Aufzucht über die Rosenpflege bis hin zum Thema Erbgut der Rosenarten und -sorten.
Für das kommende Frühjahr wurde eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung des Rosengartens vereinbart. Der Wunsch der Rosengartenpaten geht dahin, die angrenzenden Rasenflächen in Wildblumenwiesen umzuwandeln und den Rosengarten und die angrenzenden historischen Mauern optisch zu verbinden und damit auch die Nachhaltigkeit der Gesamtanlage positiv zu beeinflussen.
Bildzeile: v.l. – Heinz Helmut Bussemans, Ulrich Finger, Heiko Just, Walter und Brigitta Nehrig.
Foto: Stadt Dortmund

Ein ‚Abend zur Person‘ im Dortmunder Islamseminar
Zwei Frauen auf der Suche nach Integration
Seit mehr als 25 Jahren ist das Dortmunder Islamseminar ein Ort der interkulturellen Begegnung und des interreligiösen Dialogs. Von Zeit zu Zeit lädt das Seminar prominente Gäste ein und stellt sie bei einem ‚Abend zur Person‘ vor. In der Stadtkirche St. Petri waren jetzt die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Dr. h.c. Annette Kurschus, und die Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Serap Güler zu Gast.
Beide Frauen hoben aus unterschiedlicher Perspektive die Bedeutung eines interreligiösen Dialogs hervor. „Interreligiöser Dialog gehört dazu, wenn wir Integration anstreben, sagte Präses Annette Kurschus. Er helfe Menschen unterschiedlichen Glaubens, Achtung voreinander zu gewinnen. Zugleich trage er aber dazu bei, den eigenen Glauben noch besser zu verstehen und zu reflektieren.
Integration, so Kurschus und Güler, bleibe auf allen gesellschaftlichen Ebenen das Ziel. Aber das Verständnis von Integration unterliege einem Wandel. Für die Evangelische Kirche von Westfalen beschrieb Annette Kurschus einen Prozess des gemeinsamen Lernens. Es gehe nicht darum, andere Menschen dem eigenen Lebensstil anzugleichen. In Anlehnung an Theodor W. Adorno postulierte die Präses: „Integration heißt, ohne Angst verschieden zu sein.“ So verstanden werde der Integrationsprozess auch zu einer veränderten Kirche führen.
Der Beschreibung des Integrationsbegriffs pflichtete Staatssekretärin Serap Güler bei. Integrationsarbeit in diesem Sinne sei heute wichtiger als noch vor einigen Jahren, so ihre Einschätzung. Als Tochter einer türkischen Gastarbeiterfamilie habe es für sie außer der Sehnsucht nach der fernen Verwandtschaft, keine Gründe gegeben, sich als Kind nicht in Deutschland beheimatet zu fühlen. „Ich bin in einer Generation groß geworden, in der man die Frage: ‚wo kommst du her?‘ nicht als Angriff verstanden hat“, sagte Serap Güler. Das habe sich in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Stimmung verändert. Kinder der 3. und 4. Generation türkischstämmiger Migrationsfamilien erführen zunehmend Rechtfertigungsdruck und Ausgrenzung. Das erzeuge bei vielen ein Gefühl des Trotzes.
Auch die Frage nach der Religion werde oft missbraucht, um Feindbilder zu zeichnen, beschrieb Güler, die sich als Muslimin bewusst für eine Mitgliedschaft in der CDU entschieden hat. Sie selbst sei von der Fülle an Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam überzeugt. „Wer christlichen Glauben ins Feld führt, um sich von anderen abzugrenzen, der hat etwas von Jesus missverstanden“, stellte Präses Annette Kurschus klar. Sie sehe aus dem christlichen Glauben heraus nur die Richtung begründet, aufeinander zuzugehen.
Aus dem Auditorium nach der Zukunft des Religionsunterrichts befragt, unterstrich die Präses dessen grundsätzliche Notwendigkeit. Es sei für junge Menschen wichtig, Religion zu verstehen und sich auch kritisch mit ihr auseinanderzusetzen, so die Präses. Auch gebe es erste Projekte für einen interreligiösen Religionsunterricht. Der biete neue Chancen, sei für Lehrende indes besonders anspruchsvoll.
Serap Güler wies auf die besondere Bedeutung muslimischen Religionsunterrichts an den Schulen hin. Er biete ein Gegengewicht zum Salafismus, dessen Vertreter Jugendliche zielgruppengenau anzuwerben versuchten.
Für die Zukunft wünschten sich beide Frauen, die gegenwärtigen Anstrengungen um Integration hinter sich lassen zu können. „Ich säge gerne an meinem eigenen Stuhl“, sagte Serap Güler. Sie hoffe, dass es in zehn Jahren keine Staatssekretärin für Integration mehr brauche. „Ich wünsche mir, dass das ‚Wir‘ in der Gesellschaft dann heißt: ‚alle gemeinsam‘“, so die Vision von Annette Kurschus. Sie hoffe, es könne den unterschiedlichen Gruppen gelingen, ihre jeweils eigenen Stärken als gemeinsame Stärke zum Wohle aller einzusetzen.
Bildzeile: Präses Dr. h.c. Annette Kurschus (l.) und Staatssekretärin Serap Güler zu Gast beim ‚Abend zur Person‘ in der Dortmunder St. Petri-Kirche. Im Hintergrund v.l.: Sophie Niehaus (Islamseminar, Ahmad Aweimer (Rat der Muslime), Andrea Auras-Reiffen (stellv. Superintendentin), Moderator Ralf Lange-Sonntag (Islambeauftragter der EKvW), Ridwan Heimburger (Islamseminar)
Foto: Stephan Schütze

help and hope blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück
Stiftung stellt Jahresbericht 2019 vor
Die Stiftung help and hope stellt den Jahresbericht 2019 vor und blickt auf ein erfolgreiches Jahr. Im Jahr 2019 hat die Dortmunder Stiftung ihre Aktivitäten auf Gut Königsmühle in Mengede ausgebaut und weiterentwickelt, um so einen einzigartigen Ort für Kinder in Dortmund zu gestalten.
„Wenn Kinder die Natur erforschen, sie kennen- und schätzen lernen, wird diese Erfahrung sie achtsamer und verantwortungsbewusster im Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen werden lassen. Wenn sie erleben, wie viel Spaß es macht, gemeinsam Gemüse zu verarbeiten, von dem sie gesehen haben, wo es wächst, überzeugt es die Kinder auch Gemüse zu probieren, welches sie sonst noch nicht gegessen haben. Wenn sie als Gruppe etwas schaffen, dass sie sich alleine nicht zugetraut hätten, dann wird das jeden Einzelnen selbstbewusster machen. Kinder brauchen Zeit und Raum um sich zu entwickeln. Beides haben wir auf Gut Königsmühle“, berichtet Sandra Heller, Vorstandsvorsitzende der Stiftung help and hope.
So konnten 2019 in den Oster-, Sommer- und Herbstferien zahlreiche Kinder an einem vielfältigen Programm teilnehmen, bei dem Spaß und Spielen, neben vielem Wissenswerten, in der Natur nicht zu kurz kommt. Dabei sei die Nachfrage so groß gewesen, dass die Stiftung sich für die Herbstferien und alle folgenden Ferien dazu entschlossen hat, alle Ferienwochen ein Programm anzubieten. Auch ein neuer Spielplatz wurde 2019 gebaut und ist seitdem das Herzstück des Gutshofes. Der neue Spielplatz bietet einen großen Sandplatz, viele Klettermöglichkeiten, Balancierbalken und Rutschen, ist auch in Teilen von Kindern im Rollstuhl nutzbar und jederzeit für Besucher zugänglich.
Auch die Aktionen am Wochenende erfreuten sich großer Beliebtheit. „Eine Kürbisschnitz-Aktion zu Halloween fand mit 150 Kindern und ihren Familien statt, beim Laternenumzug zu Sankt Martin konnten wir 400 Besucher auf dem Gut begrüßen und als der Nikolaus zu Besuch kam, haben 150 Kinder ein Geschenk von uns bekommen“, berichtet Heller.
Zudem wurde 2019 das Landcafé kleiner König eröffnet. Ein uriges, kleines Café mit schönem Außenbereich. Hier haben Radfahrer und Spaziergänger donnerstags bis sonntags die Möglichkeit Rast zu machen, einen Kaffee zu trinken und Kuchen sowie kleine Snacks zu speisen.
Gut Königsmühle ist ein sozialer Ort, an dem jeder, egal welcher Herkunft, Religion oder sozialem Hintergrund, mit oder ohne Handicap in Kontakt mit der Natur und Tieren kommt. Die Stiftung möchte Gut Königsmühle zu einem außerordentlich sozialen Projekt in Dortmund entwickeln: „Wir fokussieren uns immer mehr auf unsere eigenen, operativen Projekte. Dabei nimmt insbesondere Gut Königsmühle einen großen Stellenwert ein“, so Heller.
Die Stiftung, die sich aus Spendengeldern finanziert, habe auch zukünftig einiges auf Gut Königsmühle vor. So konnte die Stiftung help and hope im Jahr 2019 Gesamteinnahmen in Höhe von 2,7 Millionen Euro verzeichnen.
Insbesondere die Spenden über den help and hope Spendenteller, der an vielen Kassen und Büros unserer Förderer steht, konnten im Jahr 2019 deutlich erhöht werden. Mit Blick auf die Zukunft und zunehmender elektronischer Zahlung habe die Stiftung zudem einen neuen Weg gefunden: Die Aktion „Mach´s rund“, bei der Kunden an der Kasse den Einkaufswert auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden können, konnte erfolgreich implementiert werden und wird nun auch bei weiteren Förderern umgesetzt. „Der Spendenteller und die Aktion ‚Mach´s rund‘ haben 2019 für knapp 50% der Spendeneinnahmen gesorgt. Das sind 1,3 Millionen Euro, die durch Cent-Beträge zusammenkommen“, so Heller. „Die Diskussion um die Abschaffung des Kleingelds beobachten wir genau. Eine solche Entscheidung hätte für uns weitreichende Konsequenzen, macht das Kleingeld doch einen Großteil unserer Gesamteinnahmen aus. Umso wichtiger ist es auch für uns, sich fortschrittlich aufzustellen und neue Wege zu gehen. Die Aktion ‚Mach´s rund‘ ist ein erster, wichtiger Schritt“, so Heller weiter.
help and hope steht in Kooperation mit über 150 Unternehmen und Projektpartnern, mit denen Ideen und Projekte gestaltet werden. Auch im Jahr 2019 konnte die Stiftung neue Förderer gewinnen, denn für die Weiterentwicklung der Arbeit in Dortmund ist die Stiftung auf Spenden angewiesen.
Die Stiftung möchte auch in den kommenden Jahren an die erfolgreiche Arbeit anknüpfen und noch mehr Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft und Perspektive ermöglichen. „Wir merken, dass die Nachfrage für unsere Projekte von Jahr zu Jahr steigt. Aber durch Corona haben auch wir zu spüren bekommen, wie wandelbar unsere Welt ist und dass dies auch Konsequenzen für uns haben kann. Wir hoffen daher, dass Viele unsere wichtige Arbeit für Kinder weiterhin unterstützen“, so Heller abschließend.
Bildzeile: v.l. Sandra Heller (Vorstandsvorsitzende der Stiftung help and hope), Nadja Lüders (Abgeordnete im Landtag Nordrhein-Westfalen und Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen sowie Kuratoriumsmitglied der Stiftung help and hope) und Jana Zimmermann (Leitung Marketing & Fundraising der Stiftung help and hope)
Foto: Ralf Obernier

„lokal willkommen“: Flüchtlingsfrauen spenden selbstgenähte Masken an Flüchtlinge in Derne
Schon im Frühjahr hatten geflüchtete Frauen ehrenamtlich rund 400 Alltagsmasken genäht – für die Seniorenzentren, die ambulante Pflege sowie die Notgruppen der AWO-Kitas und der Tagespflege. In den vergangenen Monaten konnten die Mitarbeiter*innen von „lokal willkommen“ weitere näherfahrene Frauen dafür gewinnen, solche Behelfsmasken anzufertigen. So entstanden nun 200 Masken, die an die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule in Derne verteilt wurden. In der vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Übergangseinrichtung leben zurzeit 65 Menschen.
Der Einrichtungsleiter Abbasse So und Frank Ortmann, Geschäftsführer des DRK Kreisverbands Dortmund, freuen sich über die ehrenamtliche Arbeit und die gelebte Solidarität.
Auch Nahid Farshi, Koordinatorin des Integrationsnetzwerks „lokal willkommen“, ist bewegt von der Hilfsbereitschaft der Dortmunder Neubürgerinnen. In kurzer Zeit haben sich mehr als ein Dutzend Näherinnen gefunden, die die Alltagsmasken in ihrer Freizeit herstellten. Dabei erwiesen sich die Frauen aus u.a. Syrien, Afghanistan, dem Iran und dem Irak als wahre Talente an der Nähmaschine.
Die Übergabe fand in der Übergangseinrichtung an der Nierstefeldstraße im kleinen Kreis statt. Als Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement erhalten die Näherinnen von Angelika Eberle, Sozialarbeiterin bei „lokal willkommen“, ein kleines Präsent und eine Urkunde. Außerdem wurden die Anwesenden von den Bewohner*innen der Einrichtung mit einem afrikanischen Buffet überrascht.
Fest steht: Für die Bewältigung der Corona-Krise wird ein langer Atem benötigt. Daher geht es weiter – neue Interessenten mit Näherfahrung sind herzlich willkommen.
Bildzeile: Näherinnen und Bewohner*innen der Übergangseinrichtung, im Hintergrund DRK-Geschäftsführer Frank Ortmann, im Vordergrund Abasse So, Leiter der Einrichtung sowie Nahid Farshi und Angelika Eberle, „lokal willkommen“.
Foto: Stadt Dortmund

Reinoldigilde fördert IT-Ausstattung für KITZ.do mit 15.500 Euro
Geschütztes digitales Arbeiten und raumübergreifende Vernetzung gehören heute zu den Grundvoraussetzungen digitalen Lernens und Arbeitens – nicht erst seit Covid19. Dank der valenten Förderung der Reinoldigilde in Höhe von rund 15.500 Euro konnte das Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund (KITZ.do) seine IT-Infrastruktur in diesem Sinne weiter ausbauen. Angeschafft wurde ein Terminalserver, der sicheres dezentrales, digitales Arbeiten für Mitarbeiter*innen und vor allem Teilnehmer*innen ermöglicht.
Wie sich durch die Covid19-Maßnahmen zeigte, eine Investition zum richtigen Zeitpunkt. Dr. Ulrike Martin, Leiterin KITZ.do „Die Förderung der Reinoldigilde hat maßgeblich dazu beigetragen, KITZ.do im Bereich digitalen Lernens für die Zukunft neu aufzustellen. In Covid19-Zeiten konnten wir bereits die neuen Möglichkeiten einsetzen und neue Formate erfolgreich digital anbieten.“
Davon überzeugten sich bei einem offiziellen KITZ.do-Besuch die Gildner*in Martina Blank, Christian Sprenger, Christoph Schubert und Guido Baranowski und zeigten sich sichtlich beeindruckt. „Wir freuen uns, durch unser Engagement den wissenschaftlichen bzw. technischen Nachwuchs von morgen zu unterstützen und damit einen Bildungsbeitrag zu leisten“, so der Obermeister Christian Sprenger der Reinoldigilde zu Dortmund e.V. .
Eines der wesentlichen Ziele der Reinoldigilde zu Dortmund ist die Förderung der Wissenschaft. Im KITZ.do werden Kinder und Jugendliche mit Schwerpunktsetzung auf MINT-Themen für Zukunftsthemen begeistert und gefördert. So gab es seit KITZ.do-Bestehen auch schon frühere Förderungen.
Christoph Schubert, Richtemann der Reinoldigilde zu Dortmund e.V.: „Wir setzen gerne unser Engagement aus dem Jahr 2013 fort, mit Unterstützung der Reinoldigilde ist das KITZ.do erneut für die digitale Zukunft gut aufgestellt und kann mit einer IT Infrastruktur der neuesten Generation agieren.“
Bildzeile: jeweils v.l. vordere Reihe: Giovanna Michele und Elena Pincu, Teilnehmerinnen KITZ.do Girls Coding Club
hintere Reihe: Tim Wittmann, KITZ.do,;Guido Baranowski, TZD; Christoph Schubert, Reinoldigilde; Dr. Ulrike Marin, KITZdo; Christian Sprenger, Reinoldigilde; Martina Blank, TZD
Foto: Roland Kentrup

Science Fiction für die Stadt
Schauspielintendantin Julia Wissert sprach im Westfälischen Industrieklub über die Theaterzukunft und ihre Ideen für das Schauspielhaus Dortmund.
Zukunft, das ist für Deutschlands jüngste Theaterintendantin Julia Wissert ganz offensichtlich nichts, was in weiter Ferne liegt. Sondern etwas, mit dem man sich schon in der Gegenwart intensiv beschäftigen sollte. So intensiv, dass sie sich, das Publikum und die Stadt in die Lage versetzen möchte, schon heute darüber nachzudenken, wie es ist, „aus der Zukunft zurückzublicken“, sagte sie bei ihrem Vortrag vor dem Westfälischen Industrieklub. „2170 – Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden?“ lautet ebenso folgerichtig wie gedanklich herausfordernd der Titel der ersten Produktion als neue Intendantin.
Viel rätseln mussten die Zuhörer dann allerdings nicht mehr, denn in ihrem Vortrag gab die junge Intendantin einen erfrischend lebendigen Einblick in ihre Ideen. Was am Schauspiel in Dortmund passieren soll, wird demnach nicht nur von Zukunft, sondern auch von Vielfalt und Partizipation geprägt.
Zwar sei sie selbst vor allem am körperlichen Aspekt des Theaters interessiert. Was sich auch daran zeigt, dass nach dem Studium in London das „Physical Theatre“-Kollektiv „Los Bandidos Perditos“ gründete. Und am Salzburger Mozarteum zum Beispiel die Oper „Kaiser von Atlantis“ inszenierte, bei dem sie die Sänger nicht nur zu stimmlicher Akrobatik führte, sondern sie auch körperlich forderte – „ich habe das wie einen Zirkus inszeniert“.
Doch neben aller Körperlichkeit will Wissert auch „ganz unterschiedliche Ästhetiken“ zu ihrem Recht kommen lassen. So wird Milan Peschel „Früchte des Zorns“ als Gastregisseur inszenieren. „Er ist ein Schauspieler, der den Text liebt und er konzentriert sich auch als Regisseur auf den Text.“
Mit „Faust I“ gibt es zudem einen Klassiker, nachdem sich in der Eröffnungsproduktion „2170“ als Uraufführung fünf Autoren mit fünf Texten an vielen Orten der Stadt präsentiert haben. Die Produktion ist gleichzeitig auch die Vorstellung des neuen Ensembles, das sich mit eigenen Ideen eingebracht hat. Dass Theater aus mehr als der Intendantin besteht, liegt Wissert eben auch am Herzen.
Vielfalt, Partizipation und viel Innovation sollen die Theaterzukunft prägen – und unter anderem „mit der jungen Generation auch Menschen ins Theater locken, die dort eigentlich nie hingehen.“
www.wik-dortmund.de
Bildzeile: Julia Wissert (Mitte), neue Intendantin des Dortmunder Schauspiels, mit Dirk Rutenhofer, Präsident des Industrieklubs und Karin Dicke, geschäftsführende Gesellschafterin Dicke & Partner GmbH.
Foto: Jan Heinze

Dortmunder Handwerk und Forschung
entwickeln digitale Assistenzsysteme
Kooperation von Kreishandwerkerschaft und Technologieunternehmen IGA mbH beginnt mit der Entwicklung von Assistenzsystemen auf Basis der Microsoft-HoloLens
Um Handwerkerinnen und Handwerkern der Zukunft digital gestützte Arbeits- und Assistenzsysteme an die Hand geben zu können, haben Handwerk und Forschung in Dortmund jetzt eine neue Initiative ins Leben gerufen. Das gemeinsame Projekt will Technologien entwickeln, die Handwerksunternehmen bei der Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben und der digitalen Dokumentation der Arbeit aktiv unterstützten. Mit einem Team von Technologieunternehmen aus den Bereichen „Digitalisierung in der Bauwirtschaft“, „Robotik“, „Industrielle Produktion“, einem Forschungsinstitut an der Universität Dortmund sowie den Innungsunternehmen der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen als Anwendungspartner werden diese zukunftsweisenden Instrumente ab sofort entwickelt und erprobt.
HoloLens ist erstes Projekt
Volker Walters, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen, und Prof. Dr.-Ing. Gerd Grube, Geschäftsführer der Dortmunder IGA mbH, beginnen die Kooperation mit der Entwicklung von ersten Assistenzsystemen auf Basis der Microsoft-HoloLens. Die HoloLens erlaubt es, 3D-Projektionen aus der virtuellen mit der realen Welt zu überlagern, sodass bereits die zu realisierenden Gewerke und Objekte auf der Baustelle betrachtet und beurteilt werden können, noch bevor sie fertiggestellt sind. „Dies kann natürlich auch für die Wartung und Instandsetzung interessant sein,“ erläutert Prof. Gerd Grube. „Neben der digitalen Baustellenassistenz wollen wir dementsprechend breite Anwendungsbereiche in der Aus- und Weiterbildung des Handwerks oder auch im Facility Management von Gebäuden erproben.“ Volker Walters geht davon aus, dass letztendlich nahezu alle Innungen der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen von diesen Technologien profitieren werden.
Bildzeile: Schulterschluss in Sachen Technologie: Volker Walters, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen (l.) und Prof. Dr.-Ing. Gerd Grube gehen gemeinsam die Entwicklung neuer Assistenzsysteme für das Handwerk an.
Foto: Kreishandwerkerschaft

Auszeichnung der bundesweit besten MedizinerRekordim Klinikum: Direktor der Urologie wirdviermal in der „Focus Ärzteliste“ 2020 genanntSooft wie sonst keiner: Prof. Dr. Michael Truß, Direktor der Klinik für Urolo-gie im Klinikum Dortmund, wird vo n dem Magazin „ insgesamt vier-mal als „Top Arzt“ 2020 ausgezeichnet. In den Bereichen Blasenkrebs, Nie-renkrebs, Prostatakrebs und gutartige Prostatavergrößerungen gilt er damitals herausr agender Mediziner, der von Patient*innen und auch Kolleg*innenweite rempfohlen wird. Schon seit 2010 ist P rof. Truß jedes Jahr in der Ärz-teliste vertreten. Nun stellt er mit den insgesamt vier Nennungen aber einenneuen Rekord auf, da kaum ein Mediziner so oft im gleichen Jahr in derListe ausgezeichnet wird.„Ind iesem Jahr wieder auf der Ärzteliste zu stehen und dann gleich viermal, ehrtmich natürlich sehr“, sagt Prof. Truß. „Uns ist es wichtig, den Patienten eineRundumversorgung in allen Fachrichtungen der Urologie zu bieten, damit auchP e rsonen mit spezielleren Erkrankungen die bestmö gliche Versorgung bekom-men Die Schwerpunkte der Klinik reichen von der Behandlung von Tumoren a nHarn und Geschlechtsorganen bis zu endoskopischen Techniken bei gutartigenProstatavergrößerungen. Dabei greift Prof. Truß zusammen mit seinem Team aufmodernste Behandlungstechnik wie z.B. den Operationsroboter „Da Vinci Xi“ zu-rü ck, mit dem minimalinvasiv operiert werden kann und dadurch weniger Narbenzurückbleiben.Umdie bundesweit besten Ärzt*innen zu finden, hat „ das RechercheInstitut Mun ich Inquire Media ( engagiert. Das Institut hat ein Jahr lang Da-ten zu den einzelnen Medizinern erhoben und Interviews mit Patient*innen undKolleg*innen aus dem Fachbereich geführt. Um für die „Focus Ärzteliste“ in Be-tracht zu kommen, muss das Können eines Mediziners nämlich durch mehrereunabhängige Quellen bestätigt werden. Auch die vom Mediziner veröffentlichtenStudien und Publikationen fließen mit in die Bewertung ein. Insgesamt werden2020 in der Liste 3.721 Ärzt*innen für 108 Erkran kungen oder Fachrichtungenempfohlen.Bildzeile: Prof. Dr. Michael Truß, Direktor der Klinik für Urologie im Klinikum Dort-mund, stellt einen neuen Rekord auf und wird von dem Magazin „Focus“ insgesamt viermal als „Top-Arzt“ 2020 ausgezeichnet.Foto: Klinikum Dortmund

Der Paritätische übergibt gespendete Masken
Ende August überbrachte Gunther Niermann, Geschäftsführer des Paritätischen in Dortmund, 3.000 Einweg-Masken für die Mitarbeitenden der Werkhof Projekt gGmbH. Diese sind Teil von insgesamt 5 Millionen Einweg-Mund-Nasen-Schutze, die der Wohlfahrtsverband seinen ca. 3.100 Mitgliedsorganisationen in NRW kostenlos zur Verfügung stellt. Gespendet wurden die Masken von der Firma BASF.
„Unsere Mitarbeitenden in den verschiedenen Angeboten der Arbeitsmarktförderung können häufig nicht auf engen Kontakt zu den Nutzer*innen verzichten. Beratung, Anleitung und Betreuung geht eben dauerhaft nicht vollkommen kontaktlos. Daher müssen wir sie mit entsprechender Schutzausrüstung ausstatten.“ stellt Christina Groth, Standortleiterin des Werkhofs in Dortmund fest. Holger Schelte, Prokurist des Werkhofs ergänzt: „Das ist für uns schon ziemlich problematisch, da die meisten unserer Angebote ja eher unterfinanziert sind und diese coronabedingten Mehrausgaben bislang nicht einkalkuliert werden konnten.“
Daher kommt die große Anzahl gespendeter Masken, z.B. für die Maßnahmen und Projekte in der Werkhof Gärtnerei am Werzenkamp in Grevel, wie gerufen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Mitgliedsorganisationen mit dieser Spende in ihrer Arbeit direkt unterstützen können!“ betont Gunther Niermann für den Paritätischen abschließend.
Bildzeile: „Gunther Niermann (Geschäftsführer des Paritätischen Dortmund, links) übergibt die von der Firma BASF gespendeten Masken für die Mitarbeitenden des Werkhofs. Prokurist Holger Schelte (zweiter von links), Standortleiterin Christina Groth (mitte), und Rita Breker-Kremer (Leiterin Gärtnerei, rechts) sowie Mitarbeiter*innen der Werkhof Gärtnerei freuten sich über die Unterstützung ihres Spitzenverbandes.“
Foto: Werkhof Projekt gGmbH

Wohlfühlen oder Action – neuer Schulhof der Albert-Schweitzer-Realschule bietet viel für alle
Das in die Jahre gekommene Außengelände der Realschule ist inzwischen – rechtzeitig vor dem Schulstart – fertiggestellt worden und bietet nun ganz neue Aufenthaltsqualitäten.
Die zuvor wenig attraktiven Möglichkeiten sich aufzuhalten und die Pause zu verbringen wurden komplett neu durchdacht. Beim Umbau wurden die erhaltenswerten Installationen behutsam erhalten. Das Grünflächenamt hatte die Umgestaltung in Abstimmung mit der Schulverwaltung in Angriff genommen.
Das Gelände ist in mehreren Phasen gestaltet worden. Im ersten Schritt wurden die desolaten Asphaltflächen aufgenommen. Ein Teil der aufgenommen Fläche wurde mit einem Fallschutz aus Kunststoff versehen. Dieser neue Raum ist für die jüngeren Kinder vorgesehen. Hier befinden sie sich im ganz in der Nähe der Klassen und erhalten somit einen sicheren Spielbereich, der mit unterschiedlichen Spielgeräten ausgestattet wurde.
Ein weiterer Teil der ehemaligen Asphaltfläche ist mit einer Dolomitsand-Decke versehen worden. Auf dieser Fläche entstanden neue Jugendbänke. Zudem ist der Lebensraum der Bäume erweitert worden, welche mit ihrem Wurzelvolumen bereits die alte Asphaltdecke aufgerissen hatten.
Die übrigen Flächen erhielten eine neue Asphaltschicht. Hier sind Gruppenspiele wie Basketball oder auch Tischtennis möglich. Außerdem sind diese Flächen jetzt für Inliner und Skater nutzbar. Die Aufenthaltsqualitäten und -möglichkeiten sind durch diesen Umbau vielfältiger geworden.
Im Freigelände zwischen den Bäumen entstand ein Aktivitäten-Parcours. Entlang eines Dolomitsand-Weges sind nun Sport- und Freizeitgeräte installiert. In Verbindung mit Sitzmöglichkeiten ist hier ein vielfältiger Aufenthaltsbereich für Jung und Alt entstanden.
Zusätzlich wurden noch Jugendbänke auf der Bolzplatzwiese installiert. Sie wurden aus Nordwärts-Mitteln angeschafft.
Die Neugestaltung der Fläche mit insgesamt rund 3.900 Quadratmetern kostete 375.000 Euro und wurde mit Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finanziert.
Am Heinrich Heine Gymnasium und an der Albert Schweitzer Realschule sind in den letzten 8 Jahren viele Projekte realisiert worden.
Unter anderem wurden folgende Maßnahmen, auch mit Mitteln der Bezirksvertretung umgesetzt:
• Einzäunung des Schulgeländes
• Sitzschlange und Platzfläche an der Albert Schweitzer Realschule
• Sitzforum und Pflanzungen am Heinrich Heine Gymnasium
• Zaunerweiterung am Heinrich Heine Gymnasium
• Beachvolleyballfeld
• Bolzplatztore wurden aufgestellt
• Schulhofneugestaltung der Albert Schweitzer Realschule
Foto: Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt

CJD-Radtour als politische Bildung
Dortmund war Etappenziel der Mission Zukunft
Eine Radtour der besonderen Art startete am 29. Juni in Rostock. Im August war Dortmund ein Etappenziel von drei Abiturienten des CJD Christophorus Gymnasiums aus Rostock. Ein Ziel, auf das sich die drei Fußballbegeisterten Jungs besonders freuen, denn nach einem offiziellen Treffen mit Bürgermeister Manfred Sauer erkundeten sie das Fußballmuseum.
Die jungen Männer fahren derzeit unter dem Motto „Eine Welt für Alle“ zwei Monate einmal quer durch Deutschland. Dabei besuchen sie 24 Einrichtungen, vor allem CJD Kitas (Kindertageseinrichtungen) und auch einige Bildungspartner des CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland). Die Radfahrer wollen mit Kindern und Jugendlichen in den Austausch gehen und deren Zukunftswünsche erfragen. Bis Ende August bewältigen sie auf 47 Etappen eine Strecke von rund 3.500 Kilometern mit fast 10.000 Höhenmetern. Am 27. August werden sie nach ihrer Rundtour wieder in Rostock ankommen.
„Wir wollen die Stimme der Kinder und Jugendlichen im CJD sichtbar machen. Junge Menschen sollen daran beteiligt werden, positive Zukunftsbilder für eine bessere Gesellschaft zu entwickeln“, erklärt Maxim. Niclas ergänzt: „Die aktuelle Situation mit Corona zeigt, welchen geringen gesellschaftlichen Stellenwert Bildung hat. Wir wollen mit unserer Radtour zwei wesentlichen gesellschaftlichen Themenfeldern eine stärkere Lobby verschaffen: der Bildung und dem Umweltschutz.“
Eigentlich wollten Maxim, Julian und Niclas nach ihrem Schulabschluss „einfach nur“ eine Radtour durch ganz Deutschland machen. Seitdem sie jedoch im November 2019 an der CJD Jugendkonferenz teilgenommen haben, sieht die Radtour anders aus. Die Jugendkonferenz ist ein Projekt der Politischen Bildung innerhalb des CJD. Bei der Jugendkonferenz trafen sich 300 Teilnehmende aus ganz Deutschland mit dem Ziel, konkrete Zukunftskonzepte zu erarbeiten.
Unter dem Motto „Eine Welt für Alle“ entwickelten sie zahlreiche Ideen, die die jungen Menschen aktiv umsetzen. Den Teilnehmenden ist klar, dass Zukunft nur gestaltet werden kann, wenn sie auch die ihnen nachfolgende Generation berücksichtigen. Deshalb waren pilotmäßig einige der insgesamt 67 CJD Kitas miteingebunden. Nicht nur in den CD-Berufsbildungswerken und Schulen, sondern auch in den KiTas gehört politische Bildung ganz selbstverständlich zur Bildung dazu.
Maxim, Julian und Niclas holen mit ihrer Tour nun noch mehr Kinder und Jugendliche ins Boot. Dafür haben die Teilnehmenden der Jugendkonferenz zusammen mit einer Elementarpädagogin einen Fragebogen entwickelt zu Wünschen und Ideen der Jüngsten und Jugendlichen für ihre Zukunft, aber auch zu ihren eventuellen Sorgen. Die gesammelten Ideen und Eindrücke fließen in die Ergebnisse der Arbeitsgruppe von Maxim, Julian und Niclas ein. Diese wollen die jungen Menschen dann dem Bundespräsidenten vorstellen.
Weitere Informationen zur Tour und der genaue Tourenverlauf finden sich auf dem Blog
https://cjdeineweltfueralle.de/
Bildzeile: Julian, Maxim und Niclas (v.l.) machten auf ihrer großen Deutschlandtour Halt in Dortmund.
Foto: Carolin Wrede/CJD Dortmund

Wir sind #zukunftsrelevant!
Im August war der Jugendring Dortmund zusammen mit der Evangelischen Jugend Dortmund und den Botschafter*innen der Erinnerung in und um Bad Karlshafen unterwegs.
Eigentlich sollte es diesen Sommer nach Torre Pellice in Italien gehen. Dort wollten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen intensiv mit der Geschichte der Waldenserkirche beschäftigen. Stattdessen ging es Corona-bedingt „nur“ in die Hugenottenstadt Bad Karlshafen in Nordhessen. Für die Teilnehmenden jedoch kein bisschen weniger interessant. Im Rahmen des Filmprojektes „Die Gedanken sind frei“ sind Dortmunder Jugendliche regelmäßig dort zu Gast, also lag das Ziel nahe.
Unter dem Motto „Wir sind #zukunftsrelevant“ stellten die jungen Leute aus Dortmund verschiedene Aktivitäten, Programmangebote und Themen der Jugendverbandsarbeit auf den Prüfstein. Wir sind #zukunftsrelevant! ist der Titel einer Kampagne der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej). Im Rahmen dieser Kampagne entwickeln Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter*innen aus der Kinder- und Jugendarbeit flexible, kreative und begeisternde Ferienangebote. So konnten die Dortmunder Jugendlichen entdecken, auf wie viele unterschiedliche Weisen Jugendarbeit relevant für die Zukunft sein kann.
Zum einen beschäftigten sie sich bei Wanderungen und Museumsbesuchen auch hier mit der Geschichte der Hugenott*innen und Waldenser*innen. Sie erfuhren viel über Widerstandsarbeit, Fluchtursachen und wie wichtig es sein kann, einen Ort zu finden, an dem man aufgenommen wird. Ebenfalls um Flucht und Vertreibung ging es bei dem Besuch des Forum Jacob Pins in Höxter. Der international anerkannte Künstler Jacob Pins floh vor dem nationalsozialistischen Terror nach Palästina und konnte dort überleben. Seinen künstlerischen Nachlass überließ er der Stadt Höxter. Das Forum präsentiert seine Werke und berichtet über die Geschichte der Jüdischen Bewohner*innen Höxters.
Ein weiterer Programmpunkt waren die Begegnungen mit der Evangelischen Jugend Helmarshausen, bei denen sich die Teilnehmenden über unterschiedliche Möglichkeiten der Jugendverbandsarbeit auf dem Land und in der Stadt austauschten – immer unter Berücksichtigung der Abstandsregel natürlich. Highlight dieser Begegnungen war sicherlich eine außergewöhnliche Kanutour, die nach 16 km mit der Schleusung in den Renaissance Hafen von Bad Karlshafen endete. Dort wurden die Jugendlichen von Bürgermeister Marcus Dittrich in Empfang genommen. In seiner Begrüßung betonte auch er die Wichtigkeit der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen und unterstützte die Aktion #zukunftsrelevant.
Die Kanufahrt war jedoch nicht die einzige sportliche Betätigung der Teilnehmenden. Da zu Beginn der Planungen noch nicht geklärt war, ob man Kleinbusse als Transportmittel benutzen kann, wurde die Fahrt so geplant, dass alle Ziele zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar waren. So kam es, dass die jungen Menschen an einem Tag 17 Kilometer wanderten und an einem anderen Tag 60 Kilometer mit dem Rad zurücklegten – Mobilität ist auch auf jeden Fall #zukunftsrelevant und für diese 14 Teilnehmenden aus Dortmund kein Problem.
Für Ariane Buchenau, Jugendbildungsreferentin der Evangelischen Jugend, war die Fahrt ein voller Erfolg: „Wir haben gezeigt, dass auch unter den Bedingungen einer Pandemie attraktive und kreative Freizeitangebote gelingen können. Für alle Beteiligten wird auch der Sommer 2020 unvergesslich bleiben.“ Erste Überlegungen für 2021 gäbe es auch schon berichtet Andreas Roshol, Jugendbildungsreferent beim Jugendring Dortmund: „Wir möchten gerne mit einer Gruppe Jugendlicher aus Bad Karlshafen und Dortmund die Waldensertäler im Piemont besuchen. Von der Auseinandersetzung mit der Geschichte dieser protestantischen Minderheit erhoffen wir uns neue Impulse für unsere Arbeit.“ Für die Botschafter*innen der Erinnerung stünde dabei der protestantische Widerstand gegen den italienischen Faschismus im Mittelpunkt. Bis dahin jedoch werden Dortmunder Jugendverbände weiterhin ihre Flexibilität und Kreativität unter Beweis stellen und weitere attraktive Angebote für und mit Kindern und Jugendlichen umsetzen.
Bildzeile: Einfahrt in den historischen Hafen von Bad Karlshafen.
Foto: Markus Löschner

Silberner Meisterbrief für
Kfz-Meister Jens Thiel in Scharnhorst
Meister der Auto-Service Blechschmid GmbH bekam zum Jubiläum Besuch von der Innung / Urkunde der Handwerkskammer Südwestfalen zu 25 Jahren Meistertätigkeit überreicht
Grund zum Feiern gab es jetzt in der Auto-Service Blechschmid GmbH in Dortmund-Scharnhorst. Jens Thiel (53), Kraftfahrzeugmeister des Betriebs, kann auf 25 Jahre meisterlicher Tätigkeit zurückblicken. Anlässlich des Jubiläums waren der stellvertretende Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung Dortmund und Lünen, Axel Winter, und Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas nach Scharnhorst gekommen. Beide gratulierten im Namen der Innung herzlich mit einem Blumenstrauß und überreichten die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Südwestfalen.
Von Thüringen nach Dortmund gekommen
Jens Thiel, der im Thüringischen Rudolstadt geboren wurde und dort seine Lehre absolvierte, kam 1991 nach Dortmund. Nach vier Jahren als Geselle bei der 1987 gegründeten Auto-Service Blechschmid GmbH, machte er 1995 seinen Meister und legte die Prüfung vor der Handwerkskammer in Arnsberg ab. 1997 übernahm er nach dem Tod des Inhabers Franz-Josef Blechschmid zusammen mit Uwe Bednarek den Betrieb an der Flughafenstraße. Heute hat das Handwerksunternehmen, das sich vor allem auf Reifen, TÜV/AU-Abnahmen sowie auf Fahrwerkstechnik, Achsvermessungen und Reparaturen spezialisiert hat, sieben Beschäftigte. Kraftfahrzeugmeister Jens Thiel selbst engagiert sich auch für den Fachkräftenachwuchs. Regelmäßig nimmt der Betrieb Praktikanten an und gibt ihnen einen fundierten Einblick in die Arbeiten des Kfz-Handwerks.
Bildzeile: Gratulation zum silbernen Meisterjubiläum: (v. l.) Stellv. Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung Dortmund und Lünen Axel Winter, Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas und Kfz-Meister Jens Thiel bei der Übergabe der Ehrenurkunde.
Foto: Kraftfahrzeug-Innung Dortmund und Lünen

Jugendliche Hockeyspielerinnen machen sich fürs Radfahren stark: Mia und
Pia sind UmsteiGERN-Botschafterinnen für Freizeitverkehr
Das Fahrrad ist für die beiden Hockeyspielerinnen Mia und Pia das ideale
Verkehrsmittel – ob zur Schule, zum Gelände des TSC Eintracht, wo die
beiden Hockey spielen, oder zum Einkaufen in die City sind die 14-Jährigen
klimafreundlich und unabhängig auf ihren Rädern unterwegs. Auch der
zusätzliche Trainingseffekt kommt ihnen dabei zugute.
Deshalb lautet ihre Botschaft: „Schule, Hockey oder Shopping: Auf dem Rad
beginnt unser Training schon unterwegs.“ Damit motivieren die 14-Jährigen
auf Plakaten und Postkarten, auf einer U-Bahn und auf der Projektwebsite
www.umsteigern.de zum Fahrrad- sowie Bus- und Bahnfahren. Schließlich
machen diese Verkehrsmittel sie unabhängiger von Mama und Papa: „Wenn ich
mich verabrede, nehme ich immer das Rad. Dann muss ich nicht auf meine
Eltern warten“, sagt Mia. „Mit dem Fahrrad komme ich viel leichter und
schneller zum Training. Denn so komme ich viel besser um parkende Autos
herum als meine Eltern mit dem Auto“, ergänzt Pia.
Beitrag fürs Klima und für die eigene Unabhängigkeit
Durch ihre klimafreundliche Mobilität leisten sie nicht nur einen
wertvollen Beitrag fürs Klima, sondern gewinnen auch Unabhängigkeit von
ihren Eltern und Spaß mit ihren Freund*innen: Morgens treffen sich die
14-Jährigen mit Mitschüler*innen, um zur Schule zu fahren. Nachmittags
geht’s auf dem Fahrrad zum Feldhockey-Training. Auch bei den meisten
anderen Freizeitaktivitäten kommen sie ganz ohne Mama und Papa klar – sie
radeln in die Innenstadt oder steigen in die Bahn, um Freund*innen zu
besuchen. Deshalb appellieren Mia und Pia an möglichst viele
Dortmunder*innen: einfach nur mal überwinden – den inneren Schweinehund
besiegen und sich auf den Sattel schwingen.
Auch am Bus- und Bahnangebot haben die beiden nichts zu meckern. Pia
findet: „Wir haben genug Bus- und Bahnverbindungen. Wenn Baustellen sind,
werden immer Alternativen geschaffen.“ Für weitere Strecken fahren sie gern
mit der Bahn, auch der Großteil ihrer Mitschüler*innen und Mitspielerinnen
kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie hoffen, dass sie mit ihrem
Beispiel möglichst viele Dortmunder*innen motivieren, sich wenigstens ab
und zu mit Bus und Bahn oder auf dem Fahrrad fortzubewegen.
Für eine klimafreundliche Gemeinschaft
Mit den jugendlichen Freizeitradlerinnen Mia und Pia aus der Innenstadt ist
die erste Serie der UmsteiGERN-Botschafter*innen komplett: Den Auftakt hat
Oberbürgermeister Ullrich Sierau mit seiner klimafreundlichen Mobilität per
Rad, Elektroauto und Bahn gemacht, gefolgt vom leidenschaftlichen Radfahrer
Daniel, der gut gelaunten Fußgängerin Sebina, der elektrisch motorisierten
Klimaschutzmanagerin Christine und der überzeugten Bus- und Bahnfahrerin
Stefanie. Sie alle wollen Lust machen auf klimafreundliche Mobilität und
zum Mitmachen bei der UmsteiGERN-Kampagne motivieren. Damit Nachbar*innen,
Kolleg*innen, Bekannte und Unbekannte es ihnen gleichtun und dazu
beitragen, Treibhausgasemissionen einzusparen.
Wer auch mitmachen und sich zu UmsteiGERN bekennen will, kann das eigene
Profilbild im Sammelalbum auf umsteigern.de hochladen oder sich als
Botschafter*in bewerben – je mehr mitmachen, desto größer ist die
klimafreundliche Gemeinschaft …
Als weitere ÖPNV-Botschafterin für die nächste Kampagnenphase suchen wir
noch eine Seniorin, die auch aus Überzeugung regelmäßig Bus und Bahn fährt
und mit ihrer Botschaft Nachbarn, Freund*innen, Bekannte und Unbekannte
ebenfalls zum Umsteigen auf klimafreundliche Verkehrsmittel motivieren
will. Interessentinnen können sich mit Informationen zu ihrem
Verkehrsverhalten bewerben unter
https://www.umsteigern.de/botschafter-werden.html
16 Maßnahmen für klimafreundliches Mobilitätsverhalten
Die Kampagne „UmsteiGERN. Du steigst um. Dortmund kommt weiter.“ ist eine
von 16 Maßnahmen des EU-Förderprojektes „Stadtluft ist (emissions-) frei –
Dortmunds Einstieg in eine emissionsfreie Innenstadt“. Die Europäische
Union und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützen das Förderprojekt mit
rd. 6,4 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE). Die Stadt Dortmund trägt 1,4 Millionen Euro dazu bei.
Foto: Roland Gorecki/Dortmund-Agentur

Steinernes, geflügeltes Nashorn aus Dura trifft wohlbehalten in Dortmund ein
Seit dem Jahr 2017 pflegt die Stadt Dortmund eine projektbezogene Städtepartnerschaft zu der Kommune Dura nahe Hebron in den palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland.
Bei Delegationsbesuchen sind den Gästen aus Dura die geflügelten Nashörner in Dortmund nachhaltig in Erinnerung geblieben, sodass der Beschluss gefasst wurde, ein solches Nashorn aus Stein als Freundschaftsgeschenk nach Dortmund zu entsenden.
Der in einem Steinbruch im Westjordanland gebrochene Steinblock hatte hierbei ein Gewicht von 26 Tonnen. Bearbeitet wurde der sog. „Jerusalem Stone“, eine spezielle Art Kaltsandstein aus dem auch große Teile der Altstadt von Hebron und Jerusalem erbaut sind danach in Dura. Allen Widrigkeiten der Corona-Pandemie zum Trotz wurde das nun nur „noch“ 2,5 Tonnen schwere Rhinozeros gut verpackt auf dem Seeweg nach Hamburg verschifft.
Von dort aus machte sich das Nashorn per LKW auf den Weg nach Dortmund, wo es auf der Kleppingstraße in Empfang genommen wurde. Bei der Verladung unterstützte die Dortmunder Feuerwehr mit entsprechendem Knowhow und technischem Gerät, sodass das Meisterstück wohlbehalten auf seinem finalen Platz in der Berswordthalle ankommen konnte.
Dort wurde es vergangene Woche offiziell an die Stadt Dortmund übergeben. Talal El-Hussein als benannter Vertreter des amtierenden Bürgermeisters von Dura, Ahmad Salhoub, übergab das Nashorn im Beisein aller Helferinnen und Helfer aus Verwaltung und Feuerwehr, sowie von Klaus Wegener, Präsident der Auslandsgesellschaft NRW und Ehrenbürger Duras an Stadtdirektor Jörg Stüdemann.
Fortan wird das Nashorn in der Berswordthalle als „Zeichen der Freundschaft und des Friedens“ – so sagt es die Inschrift, die auf Arabisch, Englisch und Deutsch verfasst ist – zusammen mit einer kleinen Bilderserie zu seiner Geschichte und zu seinem Transport zu sehen sein.
Bildzeile: v.l. Talal El-Hussein (Vertreter des amtierenden Bürgermeisters von Dura), Stadtdirektor Jörg Stüdemann, Matthias Kozka (Leiter des Büros des Stadtdirektors), Mark Aschemeier (Leiter des Bergungstrupps der Feuerwehr Dortmund), Klaus Wegener (Präsident der Auslandsgesellschaft NRW).
Foto: Stadt Dortmund/Roland Gorecki

Baugewerbe-Innung gratuliert RUNDHOLZ Bauunternehmung zu 75 Jahren Mitgliedschaft
75 Jahre Geschäftsgründungsjubiläum und Innungsmitgliedschaft der RUNDHOLZ Bauunternehmung: Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen überreicht Ehrenurkunde der Handwerkskammer Dortmund
Ende August gratulierten Obermeister Thomas Pape und Geschäftsführer Joachim Susewind, Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen, der RUNDHOLZ Bauunternehmung zu ihrem 75-jährigen Jubiläum und 75 Jahren Mitgliedschaft in der Baugewerbe-Innung. Zu diesem Anlass überreichten sie eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer Dortmund an Geschäftsführer Stefan Rundholz, der das Dortmunder Familienunternehmen heute in dritter Generation leitet, und seinen Vater Hanspeter Rundholz.
Die RUNDHOLZ Bauunternehmung hat sich auf den schlüsselfertigen Umbau bei laufendem Betrieb spezialisiert und beschäftigt am Firmensitz in Dortmund-Brackel circa 120 fest angestellte Mitarbeiter. Zu ihnen gehören neben eigenen Architekten und Bauingenieuren rund 70 Handwerker aller dem Rohbau verwandten Ausbaugewerke wie Maler, Maurer, Schlosser und Stahlbetonbauer, unter ihnen spezialisierte Fachkräfte wie zum Beispiel zertifizierte Schweißer.
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1945 durch Ofenmaurermeister Peter Rundholz. Er startete zunächst als Einmannbetrieb in Dortmund-Körne und beschäftigte schnell fünf Mitarbeiter. Unter der Regie seines Sohnes Dipl.-Ing. Hanspeter Rundholz, der 1967 die Geschäftsleitung übernahm, entwickelte sich die Firma zu einem kompetenten Partner für die Realisierung auch größerer Objekte im Wohnungs-, Industrie- und Verwaltungsbau. Dipl.-Ing. Stefan Rundholz trat 1997 in den Familienbetrieb ein und richtete gemeinsam mit seinem Vater Hanspeter das Unternehmen neu aus. Gezielt erweiterte er die vorhandenen Kompetenzen für den schlüsselfertigen Umbau bei laufendem Betrieb und erbringt heute als Generalunternehmer sämtliche Bauleistungen aus einer Hand.
Die Stärken des Familienunternehmens wissen mittlerweile sehr viele Krankenhäuser aus der Region zu schätzen. Mehr als 60 von ihnen stehen heute auf dessen Referenzliste. „Bei diesen Spezialimmobilien müssen bis zu 70 verschiedene Gewerke perfekt ineinandergreifen“, erläutert Stefan Rundholz. Sämtliche Arbeiten werden so geräusch- und staubarm wie möglich ausgeführt, um die Ruhe der Patienten und die Arbeit des Klinikpersonals zu gewährleisten. Aus den erworbenen Kompetenzen rund um den Krankenhausbau entwickelte Stefan Rundholz die Spezialisierung auf den Bau von Strahlentherapie-Zentren. Bis heute hat der Familienbetrieb neun moderne Zentren für Strahlentherapie gebaut, unter anderem für das Dortmunder St. Josefs-Hospital.
Zu den bedeutenden Referenzprojekten in Dortmund gehören das Dortmunder U, ANSON`S Herrenhaus und die Filiale von GALERIA Karstadt Kaufhof am Westenhellweg, das „Stadtfenster Dortmund“ an der Hansastraße oder der neu gestaltete DUSTMANN. Store im Herzen von Hombruch. Zu den jüngsten Vorzeigeprojekten zählt der 2019 fertiggestellte vierstöckige Erweiterungsbau der VOLKSWOHL BUND Versicherungen am Dortmunder Südwall.
Obermeister Pape ist stolz darauf, ein so leistungsstarkes, über die Grenzen von Dortmund hinaus bekanntes Bauunternehmen als Mitglied der Baugewerbe-Innung ehren zu können und bedankt sich für die Treue zur Innung und für das langjährige Engagement von Dipl.-Ing. Hanspeter Rundholz im Vorstand der Innung. Besonders hervorzuheben sind auch die Anstrengungen im Bereich der Ausbildung. Regelmäßig erhalten drei bis vier Auszubildende in jedem Jahr eine qualifizierte Ausbildung im Bauhandwerk.
www.rundholz.com
Bildzeile: Obermeister Thomas Pape (li.) und Geschäftsführer Joachim Susewind (re.), Baugewerbe-Innung Dortmund und Lünen, überreichten eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer Dortmund an Geschäftsführer Stefan Rundholz (3.v.l.) und seinen Vater Hanspeter Rundholz.
Foto: Rundholz Bauunternehmung

ADFC Dortmund wählte neuen Vorstand
Die Mitgliederversammlung des ADFC Dortmund musste leider um fünf Monate wegen Corona auf den 15. August 2020 verschoben werden. Im Saal der Bezirksverwaltungsstelle in DO-Hörde gab es dann vor den Mitglieder einen Rückblick auf die geleistete Arbeit in 2019 und das erste Halbjahr 2020. Im Vordergrund stand wieder die Fahrradtraining für Jung und Alt sowie die durchgeführten Touren. So wurden 2019 insgesamt 99 Radtouren durchgeführt an denen 1.600 Begeisterte teilnahmen. Aktuell sind wegen des Fahrbooms die Radcodierungen und neue Fahrradhäuser besonders gefragt.
Es wurde ein neuer Vorstand gewählt: Werner Blanke (Vorsitzender), Michael Twardon ( 2. Vorsitzender ) Andreas Bach (neu, Schatzmeister), Friedhelm Geisler (neu), Reinhold Hesse, Ulla Karrasch (neu), Sigrun Katscher Karl-Heinz Kibowski und Gerd Stemmann. Herbert Duda als Vorsitzender der Seniorenabteilung und Dieter Heuser für die Radfahrjugend gehören dem Vorstand ebenfalls an. Alle die mitmachen wollen oder Fragen haben, können sich per Mail melden unter buero@adfc-dortmund.de
Bildzeile: v.l. Dieter Heuser, Gerd Stemmann, Friedhelm Geisler (neu), Michael Twardon ( 2. Vorsitzender ) Andreas Bach (neu, Schatzmeister) Ulla Karrasch (neu), Werner Blanke (Vorsitzender), Karl-Heinz Kibowski, Sigrun Katscher, Herbert Duda, Reinhold Hesse.
Foto: ADFC Dortmund

Die Hälfte ist geschafft – von 24.000 Straßenleuchten sind bereits 12.000
ausgetauscht und setzen Dortmund bei Nacht in neues Licht
Auch in einer Zeit vieler coronabedingter Einschränkungen arbeiten
Tiefbauamt und DEW21 nicht nur am Erhalt der Infrastruktur, sondern auch an
ihrer Modernisierung. Um sicherzustellen, dass in den kommenden Jahren der
Betrieb der Straßenbeleuchtung bezahlbar bleibt, die Laternenmasten überall
standfest sind und durch altersbedingte Ausfälle keine Lawine von teuren
Störfällen ausgelöst wird, erfolgt im Auftrag des Tiefbauamtes im ganzen
Stadtgebiet eine umfangreiche Erneuerung. 24.600 Leuchten und 10.500
Laternenmasten werden in insgesamt acht Jahren ersetzt.
„Für viele sind die Laternen auf der Straße eine Selbstverständlichkeit,
sie sind einfach da. Doch ihre Wirkung spürt jeder“, sagt Arnulf Rybicki,
der Dezernent für Bauen und Infrastruktur. „Die Straßenbeleuchtung prägt
mit ihren mehr als 52.000 Standorten im ganzen Stadtgebiet das Bild, das
unsere Stadt des Nachts abgibt. Und sie sorgt dabei für eine sichere
Nutzung der Verkehrswege. Deshalb ist es wichtig alle technisch verfügbaren
Möglichkeiten auszuschöpfen, um den störungsfreien und effizienten Betrieb
dieses Teils der Infrastruktur zu gewährleisten. Gutes Licht in der Nacht
stärkt das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Es schafft
Atmosphäre und sorgt damit für die besondere nächtliche Aufenthaltsqualität
auf unseren Straßen und Plätzen.“
Die verwendete LED-Technik bringt neben der deutlich höheren
Lebenserwartung auch eine erhebliche Energieersparnis mit sich. Modernste
Funktechnik – durch die es möglich wird, die Lichtstärke der Leuchten
individuell zu steuern, kommt zum Einsatz. Gleichzeitig werden durch die
neue Technik Informationen über den Betriebszustand der Leuchten für die
Wartung geliefert. Für einige der umzurüstenden Straßen wird die
Beleuchtung auch in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen geschaltet.
Smart City geht ein Licht auf
Die Maßnahmen werden vom Konsortium Straßenbeleuchtung Dortmund (StraBelDo)
umgesetzt. Dies ist ein Zusammenschluss der Unternehmen DEW21 und SPIE SAG.
Bei der Umsetzung des „Leuchten-Plans“ Kurs in Richtung einer Smart City
auf.
„Durch die Umstellung praktizieren wir gemeinsam mit der städtischen
Verwaltung die Weiterentwicklung Dortmunds zur Smart City, “betont Peter
Flosbach, Technischer Geschäftsführer von DEW21. „Die Beleuchtung wird
smart und flexibel. Mit dem intelligenten, funkgesteuerten Lichtmanagement
können künftig rund 25.000 Lichtpunkte einzeln angesteuert, Störungen
schnell erkannt und die Beleuchtungsstärke individuell angepasst werden,
zum Beispiel mit Blick auf die aktuelle Verkehrslage.“ Durch die
Digitalisierung wird gleichzeitig ein System geschaffen, mit dem in Zukunft
auch weitere smarte Innovationen umgesetzt werden können.
Ersetzt werden Leuchtköpfe, die älter als 30 Jahre und Stahlmasten, die
älter als 50 Jahre sind. Rund 12.000 LED Leuchten sind aktuell bereits am
digitalen Funknetz der Straßenbeleuchtung aktiv. Etwa 2.500 Masten wurden
bereits ausgetauscht.
Bereits heute wurde mit Unterstützung der StraBelDo in den Stadtbezirken
Eving, Aplerbeck, Mengede, Huckarde, Innenstadt West und Brackel der
jeweils erste Erneuerungsschritt gemacht.
„Das laufende Erneuerungsprogramm der Straßenbeleuchtung sorgt nicht nur
dafür, dass ein wichtiger Teil der Straßeninfrastruktur in einem guten
Zustand gehalten wird“, sagt Sylvia Uehlendahl, die Leiterin des
Tiefbauamtes. „Es sorgt auch für eine wesentliche Steigerung der Effizienz
des gesamten Beleuchtungssystems, was eine Senkung der Energie und
Betriebskosten sowie eine Verringerung der Störungen und der daraus
resultierenden Reparatur und Wartungsaufwände mit sich bringt“, ist Sylvia
Uehlendahl überzeugt.
Hombruch leuchtet bald ganz neu
Für den Stadtbezirk Hombruch sieht der Plan 1.700 neue Masten und 3.500
Leuchten vor.
In Teilen werden auch hier nur die Leuchtköpfe ausgetauscht. Das hängt mit
dem jeweiligen Alter der Masten bzw. der Leuchten zusammen. So kann es
vorkommen, dass einige Masten oder Leuchten einer Straße unberücksichtigt
bleiben. Grundsätzlich wurde aber bei der Planung darauf geachtet, dass
keine Flickenteppiche entstehen.
Der Stand der Dinge in Hombruch: Rund 467 Masten sind bereits erneuert. Bei
den Leuchten wurden bereits 1.788 Stück getauscht.
In diesem Jahr wird versucht, trotz der erheblichen Probleme, die durch die
Covid-19-Pandemie verursacht wurden, die Erneuerungsmaßnahme in Hombruch
abzuschließen und die Arbeiten anschließend im Stadtbezirk Hörde zu
starten.
„Der Einsatz modernster Digitalfunktechnik macht individuelle
Beleuchtungslösungen erst möglich. Zusätzlich sorgt ein vollständiges
EDV-basiertes Anlagenmanagement, zusammen mit einer mobilen
Datenerfassungs- und Bearbeitungstechnik, für ein effizientes Handeln der
Monteure, die mit Erneuerung, Wartung und Reparatur betraut sind“, sagt
Meinolf Pflug, Fachkoordinator für Straßenbeleuchtung im Tiefbauamt der
Stadt Dortmund. „Dies führt schon jetzt zu mehr Schnelligkeit und Effizienz
bei Störungsbeseitigungen. Die jederzeit online verfügbaren
Anlageninformationen erleichtern dem Tiefbauamt eine bürgernahe, effiziente
Verwaltung der Straßenbeleuchtung.“
„Störung 24“ – der schnelle Weg für Fehlermeldungen
Mit dazu bei trägt das internetbasierte Onlinesystem „Störung 24“. Darauf
setzt die Stadt bereits seit dem Start in 2016, als mit dem Konsortium
Straßenbeleuchtung Dortmund GbR der Straßenbeleuchtungsvertrag
geschlossenen wurde.
Das System von „Störung 24“ zur Erfassung von Fehlermeldungen ist neben der
Browserversion auch als Mobilfunk-App für die Bürger*innen verfügbar. Nach
einer ausführlichen Erprobungsphase wurde „Störung 24“ Anfang 2019 den
Bürgern vorgestellt.
Bei der Einführung des Online-Meldesystems standen folgende Gründe im
Vordergrund:
· Verringerung der kostspieligen Nachtkontrollfahrten durch den
Betriebsdienstleister.
· Gewährleistung einer rund um die Uhr verfügbaren Anlaufstelle für
Störungen der Beleuchtung.
·
Verringerung der Fehlersuchfahrten aufgrund von unklaren Ortsangaben und
missverständlichen Fehlerbeschreibungen durch die Bürger.
· Transparenz des Störungsgeschehens durch eine einheitliche Form der
Störmeldungen.
·
Beschleunigung der Störungsbeseitigung durch direkte, automatisierte
Weiterleitung der Meldungen an den Entstörungsdienst.
Aktuell werden rund 50 Prozent aller Störmeldungen auf diesem Wege erfasst
und es werden immer mehr. Aus Rückmeldungen einzelner Bürger aber auch
aufgrund von Gesprächen mit den Mitgliedern von mehreren
Bezirksvertretungen wissen wir, dass die Akzeptanz des Systems in der
Öffentlichkeit hoch ist.
Dennoch gibt es auch die klassischen Wege Störungen zu melden: Die
24-Stunden-Störungshotline ist vor allem für Fehler der Straßenbeleuchtung
gedacht, die eine akute Gefahr für Leib und Leben darstellen können, z.B.
offenliegende Stromkabel oder offene Mastklappen. Erreichbar ist sie unter
54497-111. Meldungen können auch per E-Mail gesendet werden:
beleuchtungsstoerung@dew21.de.
Eine typische Meldung, die häufig eingeht, ist übrigens, dass in einer
Straße gleich mehrere Lampen tagsüber leuchten. Die Ursache dafür ist
schnell erklärt: Kommt es zu einer Störung der Steuerung und besteht die
Gefahr, dass die Einschaltung der Laternen bei Nacht nicht funktioniert,
dann werden Leuchten gezielt in Dauerfunktion gesetzt, um sicherzustellen,
dass im Dunklen keine Verkehrsgefahr entsteht.
Einige Störungen müssen auch zusammen mit dem Dortmunder Netzbetreiber
DONETZ beseitigt werden. Teilweise sind dafür Erdarbeiten erforderlich.
Hier kann es vorkommen, dass die Beseitigung der Störung mitunter einige
Wochen in Anspruch nimmt.
Egal ob die Laterne nachts nicht leuchtet, der Mast schief steht oder
verschmiert worden ist – alle diese Informationen sind wertvoll bei der
Aufgabe, die Straßenbeleuchtung jederzeit in einem guten Zustand zu
erhalten und Störungen schnell zu beseitigen.
Dortmunder Leuchten bleiben eine Familie
Erneuerung steht in den kommenden Jahren auch bei einem Leuchten-Typ an,
der nur in Dortmund zuhause ist.
Die hauptsächlich im Innenstadtbereich beheimatete „Dortmunder
Leuchten-Familie“ wurde bereits 1988 beinahe exklusiv für die
Straßenbeleuchtung der Stadt Dortmund konstruiert und angefertigt. Einige
Modelle diesen Typs sind ein optisches Exklusiv-Highlight – ein Modell
prägt das Erscheinungsbild des Friedensplatzes, ein anderes das des
Hansaplatzes. Andere Modelle finden sich in Dortmund an den großen Straßen
und in den Fußgängerzonen.
Die Leuchtköpfe sind in die Jahre gekommen und für einige Typen sind
Ersatzteile sind kaum noch verfügbar.
Ein vollständiger Umbau der Standorte bzw. der Ersatz der Leuchten-Type
durch eine am Markt verfügbare Standardleuchte ist jedoch nicht
beabsichtigt.
Vielmehr soll die, aus lichttechnischer und aus stadtplanerischer Sicht
erhaltenswerte Gattung, in technisch aktualisierter Form auch weiterhin das
Stadtbild prägen.
Hierzu wurden bereits in den vergangenen Jahren mehr als 300 Stück der
Leuchten, die mit dem charakteristischen „Saturn-Ring“ leicht
wiederzuerkennen sind, auf LED Technik umgerüstet.
Ähnlich soll bei den Leuchten verfahren werden, die zur funktionalen
Beleuchtung von Teilen des Wallrings und weiterer innerstätischer
Magistralen Verwendung finden.
Die Dortmunder Leuchten sind auch daran zu erkennen, dass ihre Masten alle
nachtblau lackiert sind. Alle anderen Lampenmasten tragen die Farbe
„verkehrsgrau“.
Die Dortmunder Leuchten sind ein unverwechselbares Stück Dortmund und
sollen auch weiterhin für gutes Licht in der Stadt sorgen.
Bildzeile: v.l. Arnulf Rybicki (Dezernent für Bauen und Infrastruktur), Meinolf Pflug (Fachkoordinator Straßenbeleuchtung), Bodo Cirkel (Firma Spies), Peter Flosbach (Technischer Geschäftsführer DEW21).
Foto: Stadt Dortmund

Ambulante Versorgung für Patient*innen
Behandlung im eigenen Zuhause: Klinikum hat
nun ein „Brückenteam“ für krebskranke Kinder
Neues Angebot entlastet Familien: Das Klinikum Dortmund hat nun ein
eigenes „Brückenteam“ für die Nachsorge krebskranker Kinder und
Jugendlicher ins Leben gerufen. Anstatt ein- bis zweimal wöchentlich für
Kontrolltermine in die Klinik zu fahren, werden die kleinen Patient*innen zu
Hause von einer Pflegekraft des „Brückenteams“ besucht, die dann die
notwendigen Untersuchungen durchführt. So sparen die Eltern Zeit –
gerade wenn die Anfahrten zur Klinik sehr lang sind. Gegründet wurde das
„Brückenteam“-Projekt von dem „Netzwerk für die Versorgung
schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V.“ und der „Gert Susanna Meyer
Stiftung“.
Wenn die Patient*innen die Zeit auf der Kinderkrebsstation hinter sich haben,
stehen ein- bis zweimal die Woche Kontroll- und Nachuntersuchungstermine in
der Klinik an – und das für ca. ein Jahr. „Mit dem Brückenteam ist das nicht mehr
nötig“, sagt Ulrike Jägermann, Leiterin der sozialmedizinischen Nachsorge im
Westfälischen Kinderzentrum. „Bisher haben die Eltern durch die zahlreichen
Besuche immens viel Zeit verloren. Nicht selten steht dann eine ganze Familie
Kopf, um die Termine in den Alltag zu integrieren. Nun können wir ihnen genau
diese Zeit schenken und das ist was ganz Wichtiges.“
Durch das „Brückenteam“ werden ab jetzt pflegerische Maßnahmen wie ein
Verbandswechsel, Blutentnahmen oder auch Beratungen bei bestimmten
Medikamenten direkt vor Ort durchgeführt. Dabei stehen die Pflegekräfte im
ständigen Kontakt mit den behandelnden Ärzten. So kann bei Komplikationen
oder Auffälligkeiten direkt Rücksprache gehalten und ggf. das Kind dann doch in
die Klinik gebracht werden. Das „Brückenteam“ ist damit für die Familien der
direkte Ansprechpartner in den eigenen vier Wänden und kann gezielt beraten.
Um eine flächendeckende ambulante Versorgung in diesem Bereich anzubieten,
hat sich das Klinikum Dortmund mit dem Universitätsklinikum Essen und der
Uniklinik Köln zusammengeschlossen. So soll es allen Kindern und Jugendlichen
im Rhein-Ruhr-Gebiet und vor allem im Bergischen Land möglich gemacht
werden, nach dem Krankenhausaufenthalt im eigenen Zuhause versorgt zu
werden. Die Idee dazu hatte das „Netzwerk für die Versorgung schwerkranker
Kinder und Jugendlicher e.V.“. Die Finanzierung übernimmt die „Gert und
Susanna Mayer Stiftung“.
Bildzeile: v.l. Alexandra Verfürden (medizinische Fachangestellte), Ulrike Jägermann (Leitung Sozialmedizinische Nachsorge), Britta Boelke-Gunkel (Stationssekretärin Onkologische Ambulanz), Nina Niederée (Pflegekraft des Brückenteams des Klinikums), OA Dr. Benedikt Bernbeck (Oberarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin), Stefanie Mund (stellv. Pflegedienstleitung der Kinderkrebsstation), Kim Jakob und Rebecca Baumeister(Koordinationsteam des Essener Netzwerks), Prof. Dr. Dominik Schneider (Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin); Dr. Marco Westkemper (Funktionsoberarzt in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin), in der Tür stehend Frau Christiane Bayer (Pflegekraft des Brückenteams des Klinikums)
Foto: Klinikum Dortmund

Abwechslungsreiche Sommerferienwoche in Derne
Anfang August waren die JFS Derne /AWO und der Bauwagen FLITZMOBIL für die Derner Kinder ak+v
vor Ort.
Die Ferienwoche fand nicht wie geplant auf dem Innenhof der Wohnanlage „Am Woldemey“ staP, sondern
Corona bedingt auf dem Schulgelände der benachbarten Dietrich-Bonhoeffer Grundschule. Hier haPen die
Mitarbeiter*innen der AWO und des Jugendamtes die Möglichkeit, die Hygieneregelungen sicher einzuhalten
und begrenzt Kinder teilnehmen zu lassen, um Kinderansammlungen zu vermeiden. So konnten die
Besucher*innen täglich in der Zeit von 13:00-17:00 Uhr an unterschiedlichen Sta+onen teilnehmen, wie dem
KlePerturm, Bewegungs- und Spielangebote rund um das Flitzmobil, Malen an Staffeleien und vielfäl+ge
Krea+vak+onen.
Ein besonderes Highlight, wie schon im letzten Jahr, war das digitale Medienangebot der S+_ung „Digitale
Chancen“ mit dem Programm „KULTUR TRIFFT DIGITAL“. In den angebotenen Workshops lernten die Kinder
vielfäl+ge Möglichkeiten der digitalen Medien kennen und konnten eigene krea+ve Ideen umsetzen.
Ausprobieren und Experimen+eren stand im Vordergrund. Eine Medienpädagogin begleitete sie dabei.
Im Rahmen des Nachhal+gkeitsprojekts „Global-Neutral“ konnten die Kinder solarbetriebene Fahrzeuge
(ähnlich wie Legotechnik) und sogar ein kleines Windrad bauen. Daneben wurden leere Terapacks zu
schönen Vogelhäuschen umfunk+oniert, um den Kindern zu zeigen, wie einfach Upcycling ist.
Täglich besuchten bis zu 30 Kinder die Ferienwoche und die Organisator*innen sind sehr zufrieden, trotz aller
Widrigkeit ein aPrak+ves Ferienprogramm auf die Beine gestellt zu haben.
An einem Tag bekamen die Derner Kinder Besuch von der Dortmunder Grafikdesignerin, Astrid Halfmann
und ihrer Mitarbeiterin. In der MalwerkstaP der Dortmunder Falken zeichneten die Kinder im Rahmen des
Projektes „KidsCourage“ Bilder zu den Kinderrechten.
Das „Rollende Sofa“ rollte ebenfalls an zwei Tagen vorbei. Unter Anleitung der Kulturpädagogin, Manuela
Wenz, improvisierten die Kinder kleine Szenen und Standbilder auf dem Sofa, die später in einer Ausstellung
präsen+ert werden.
„Gerade während der Coronazeit ist es für uns wich+g, den Kontakt zu den Kindern und deren Familien zu
halten. Wir senden das Signal, das wir weiter für sie da sind, wenn auch in anderer Form, in kleinen Gruppen,
mit Abstand und solidarischem „Aufeinander aufpassen“, so Wilhelm Hoffs+epel (AWO) und Conny Bothe
(Jugendamt).
Die Hygieneregeln wurden zu Beginn jeden Tages mit den Kindern besprochen und Abstandregeln spielerisch
geübt. So wurden alle gut vorbereitet und gemeinsames Spielen, Tanzen, Malen und Bewegen war möglich. „
Durch die Kleingruppen, haben die Kinder die Möglichkeit, die Angebote viel intensiver zu erleben, weil wir,
als pädagogisches Personal gezielter und mit mehr Zeit auf die Kinder eingehen können, “ so die
Organisator*innen.
Trotzdem wünschen sich natürlich alle, im nächsten Jahr wieder auf dem großen Freigelände des
Wohnquar+ers ak+v werden zu können, um möglichst vielen Kindern und Familien Ferienak+vitäten
anbieten zu können. In der Zwischenzeit wollen sich nach den Ferien alle pädagogischen Mitarbeiter der
mobilen, aufsuchenden Arbeit im Stadtbezirk Scharnhorst zusammensetzen und ihre Erfahrungen in dieser
besonderen Zeit zusammentragen, auswerten und neue Konzepte für die eingeschränkte Arbeit entwickeln. Denn eins ist klar, die Kinder und Familien brauchen dieses außerschulische Angebot mehr denn je.
Foto: AWO Dortmund

Ferien im Westfalenpark: PSD ParkSommer erfolgreich beendet – 105.000 Gäste und zehn TV-Stars
Die Sommerferien sind vorbei – und damit auch der PSD ParkSommer im Westfalenpark. Sechs Wochen lang hat die Stadt Dortmund gemeinsam mit der PSD Bank Rhein-Ruhr mit dem PSD ParkSommer ein Ferienprogramm für Familien auf die Beine gestellt. Das Ergebnis ist beeindruckend: Rund 105.000 Besucher*innen, darunter ca. 19.000 Kinder, verbuchte der Westfalenpark in den gesamten Sommerferien. An 17 Aktivstationen erlebten Kinder Spiel und Spaß, zehn beliebte Kindheitshelden sorgten für Stimmung im Westfalenpark.
Die Stadt Dortmund ermöglichte im Park bereits seit Beginn der Sommerferien unterschiedliche Angebote wie Open-Air-Shows, Slackline und andere Sportaktivitäten. In der zweiten Ferienhälfte startete dann die PSD Bank Rhein-Ruhr mit ihrem Teil des Programms und holte neben dem Löwenzahn-Bauwagen zahlreiche TV-Stars wie Ernie und Bert, das Krümelmonster, Rabe Rudi oder Ritter Rost als Walk Acts in den Park. Das sorgte für einzigartige Fotomotive für Familien und Freude bei den Kindern.
„Die vielen positiven Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern vor Ort, über unsere Sozialen Netzwerke und auch in Kundengesprächen haben uns sehr überwältigt“, sagt August-Wilhelm Albert, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr. „Daher können wir uns sehr gut vorstellen, nächstes Jahr – hoffentlich dann ohne Corona-Beschränkungen – etwas ähnliches beizutragen.“
Auch die Stadt Dortmund will den PSD ParkSommer im kommenden Jahr fortführen. „Das zusätzliche Programm der PSD Bank hat die Feriengestaltung im Westfalenpark wirklich großartig bereichert“, sagt Birgit Jörder, Bürgermeisterin der Stadt Dortmund sowie Schirmherrin der Veranstaltung. „Wir bedanken uns herzlich für dieses Engagement und freuen und schon jetzt, diese tolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit auch die nächsten Jahre erhalten oder sogar ausbauen zu können.“
Foto: PSD Bank

Gelebte Inklusion an Schulen
Schulbegleiter*innen nehmen ihren Dienst bei der Caritas Dortmund auf
Im Katholischen Centrum begrüßte die Caritas Dortmund ihre neuen „FSJ’ler“: 19 junge Frauen und Männer werden ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Kindertagesbetreuung und Behindertenhilfe der Caritas absolvieren. Der überwiegende Teil von ihnen wird als sogenannte*r Schulbegleiter*in ein Kind mit Behinderung beim Besuch einer Regelschule begleiten und Hilfestellungen geben, wo es erforderlich ist. Der Caritasverband Dortmund e.V. trägt dadurch zur Umsetzung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen bei.
Ein Freiwilliges Soziales Jahr ist eine gute Gelegenheit herauszufinden, ob der Bereich auch dauerhaft als Beruf Freude bereiten kann. Um die jungen Leute bestmöglich auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten und im Vorfeld schon etwas Unterstützung zu geben, gibt es zunächst eine Einführungswoche im Kath. Centrum. Die FSJ‘ler werden während ihres Einsatzes pädagogisch begleitet und nehmen zudem an 25 Seminartagen (5 Wochen á 5 Tage) teil, die von IN VIA Dortmund, dem Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres, geleitet werden. Insgesamt setzt der Caritasverband Dortmund e.V. 55 Schulhelfer an mehr als 20 Schulen ein. Neben den Helfer*innen im Freiwilligen Sozialen Jahr sind auch festangestellte Mitarbeiter*innen in diesem Arbeitsfeld tätig.
Im Vergleich zu den Vorjahren ging die Zahl der FSJ’ler bei der Caritas in diesem Jahr ein wenig zurück, die Corona-Pandemie ist der wahrscheinliche Grund. Es sind daher immer noch Plätze frei! Interessierte können sich noch für ein Freiwilliges Soziales Jahr bewerben und kurzfristig starten.
Bildzeile: Die neuen Freiwilligen im Sozialen Jahr bei der Caritas Dortmund.
Foto: Caritasverband Dortmund

Bunte Steinkette vor dem Landtag
Kinder aus Dortmund bemalen Wunsch-Steine
Vor dem Landtag Nordrhein-Westfalen soll eine der längsten Steinketten des Bundeslandes entstehen – mit bunt bemalten Steinen von Kindern aus ganz Nordrhein-Westfalen. Bis zum Weltkindertag am 20. September 2020 kann jedes Kind bei der „Aktion Wunsch-Stein – Eure Ideen für die Zukunft“ mitmachen. Auch Kinder aus Dortmund können dabei sein. Die Landtagsabgeordneten Anja Butschkau, Armin Jahl, Nadja Lüders und Volkan Baran nehmen die Steine mit zum Landtag nach Düsseldorf.
Während der Schließungen von Kitas und Schulen sind im ganzen Land Steinschlangen entstanden, als Ermunterung und Zeichen des Zusammenhalts in der Corona-Pandemie. Diese Initiative greift der Landtag mit der „Aktion Wunsch-Stein“ auf. Es liegen bereits mehr als 400 Steine vor dem Parlamentsgebäude, darunter Regenbögen, Tiere und lachende Gesichter, versehen mit Wünschen wie „Gesundheit“, „Glück“ oder „sauberes Wasser“.
Und so geht es: Einfach einen Stein bunt anmalen, gerne einen Wunsch für die Zukunft darauf schreiben und das Wahlkreisbüro der Dortmunder Abgeordneten informieren. Die gesammelten Werke aus Dortmund werden dann Teil der Steinkette vor dem Parlamentsgebäude von Nordrhein-Westfalen. So entsteht nicht nur buntes Bild, sondern eine Sammlung von Kinder-Wünschen aus dem ganzen Land.
Auch Kitas und Schulen in Dortmund können sich an der Aktion „Wunsch-Stein“ beteiligen und den Dortmunder Abgeordneten die gesammelten Kunstwerke übergeben.
Am Weltkindertag am 20. September 2020 begrüßt der Landtag in Düsseldorf von 12 bis 18 Uhr Kinder zu einem kleinen Programm mit Führungen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Jedes Kind, das an der „Aktion Wunsch-Stein“ teilgenommen hat, bekommt dann ein kleines Geschenk.
Foto: Landtag NRW

Lebensraum Streuobstwiese: Bitte nicht ausplündern, sonst wird das
Obstpflücken zum bitteren Zankapfel
Der Sommer gibt zurzeit alles – und gerade in Corona-Zeiten suchen Menschen
Erholung in der nahen Umgebung. Da gibt es kaum etwas Schöneres als auf dem
Spaziergang in der freien Landschaft im Vorbeigehen auf einer Obstbaumwiese
Äpfel zu pflücken und zu essen.
Gegen diese besonders reizvolle Art des Naturgenusses ist auch nichts
einzuwenden, zumal auch Kinder und junge Leute auf diese Weise erleben
können, dass Obst nicht nur im Supermarkt zu finden ist.
Kritisch ist allerdings der Obstraub im großen Stil, bei dem ungefragt mit
Körben und Fahrzeugen komplette Bäume oder gar ganze Obstwiesen zu
gewerblichen Zwecken „abgeerntet“ werden. Derzeit treffen wieder einzelne
Meldungen ein, dass Menschen beobachtet wurden, die sich nach dem Abernten
mit ganzen Autoladungen voller Obst wieder aus dem Staub machen.
Das Umweltamt der Stadt Dortmund weist mit Nachdruck darauf hin, dass das
Pflücken nur für den Eigenverbrauch in haushaltsüblichen Mengen erlaubt
ist. Das Obst darf nicht verkauft oder sonst gewerblich genutzt werden. Bei
Zuwiderhandlungen behält sich das Umweltamt das Recht vor, den Diebstahl
zur Anzeige zu bringen. Dann ist mit der Behörde im wahrsten Sinne des
Wortes nicht gut Kirschen essen. Hinweise von Zeug*innen aus der
Bevölkerung nimmt das Umweltamt gerne entgegen. Der einfachste Kontaktweg
läuft über E-Mail: umweltamt@stadtdo.de.
Zudem weist das Umweltamt auch auf die besonderen Regeln zum Schutz der
Bäume und Obstwiesen hin. Denn diese Orte bieten Platz für enorm viele
Lebewesen. Mit zunehmendem Alter entwickeln sich Streuobstwiesen zu
Lebensräumen mit hoher Artenvielfalt und einer Fülle von
unterschiedlichsten Pflanzen, Pilzen, Flechten, Insekten und Vögeln.
Deshalb dürfen die Obstbaumwiesen auch nicht mit Fahrzeugen befahren
werden. Das Klettern auf Bäume und das Abbrechen von Ästen ist untersagt.
Die Bäume auf den Streuobstwiesen sind also definitiv keine Leistungsbäume,
die der „Obstproduktion“ dienen.
Das Umweltamt der Stadt Dortmund betreut rund 50 Streuobstwiesen im
gesamten Stadtgebiet. Gepflegt werden diese Streuobstwiesen übrigens durch
Schafbeweidung oder zweimaliges Mähen pro Jahr. Denn damit Blühpflanzen
ausblühen und sich versamen können, ist eine extensive Nutzung und
schonende Pflege notwendig.
Foto: Stadt Dortmund/Umweltamt

Dem „Schmalflügligen Pelzbienen-Ölkäfer“ auf der Spur: Naturmuseum unterstützt LWL bei der Suche
Biologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) sind in Zusammenarbeit mit dem Käferspezialisten Dr. Johannes Lückmann dem „Schmalflügeligen Pelzbienen-Ölkäfer“ in Nordrhein-Westfalen auf der Spur. Sie wollen die Ausbreitung der Käfer besser beurteilen und bewerten. Darum bittet das LWL-Museum für Naturkunde in Münster die Bevölkerung um Mithilfe: Aufgerufen werden alle Naturfreunde, ihre Beobachtungen über den schwarzen, ein Zentimeter großen Ölkäfer aber auch über andere Ölkäfer-Arten mitzuteilen und Fotos zu schicken. Das Naturmuseum Dortmund unterstützt die Suche nach diesem besonderen Sechsbeiner.
Bis zu Beginn der 90er Jahre war „Sitaris muralis“, so der wissenschaftliche Name, ausschließlich in der Rheinebene Baden-Württembergs, in Rheinland-Pfalz und Hessen bekannt. 2005 tauchte der Ölkäfer erstmals auch in Niedersachsen auf und 2006 im Saarland, 2009 in Bayern fest und 2010 in Brandenburg. Auf Grund der Nachweise vermuten die Forscher, dass sich die Käferart auch in Nordrhein-Westfalen, vor allem entlang des Rheins, ausbreitet.
Zusammenhang mit Klimaerwärmung?
Die Wissenschaftler versprechen sich Erkenntnisse im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um die Klimaerwärmung. Dr. Heinrich Terlutter vom LWL-Museum für Naturkunde: „Die Natur liefert die besten Indikatoren für Umweltentwicklungen, und sie ist immer in Bewegung. Da taucht zum Beispiel das Taubenschwänzchen, ein Schmetterling aus südlichen Gefilden, plötzlich im Ruhrgebiet an Blüten auf.“
Gift-Produzent
Zurzeit rätseln die Experten noch, warum der Käfer wieder aufgetaucht ist. „Sitaris muralis“ ist zwar äußerlich unscheinbar, kann nicht fliegen, steckt aber voller Besonderheiten. So produziert der Käfer das hochwirksame Reiz- und Nervengift Cantharidin, das ihn vor Feinden schützt. Das Gift ist seit mehr als 2.000 Jahren bekannt. In großen Mengen aufgenommen, kann es zum Tod führen. In mittleren Dosen hat der Stoff eine heilende Wirkung.
Vermehrung per „Taxi“
Eine weitere Besonderheit der Ölkäfer besteht in ihrer einzigartigen Vermehrungsstrategie. Seine Larven entwickeln sich als Parasiten in den Nestern von Bienen, die in der Erde und in Mauerritzen nisten. In die Nester ihrer Wirte gelangen die Larven „per Taxi“: Im Frühjahr klammern sie sich im Haarkleid der ausfliegenden Bienen-Männchen fest, wechseln bei der Paarung auf die Weibchen über und lassen sich von ihnen in die Nester tragen. Dort verlässt die Käferlarve die Biene und vertilgt deren Pollen, Nektar und Bieneneier.
Bis zum Frühjahr des folgenden Jahres entwickelt sich die Larve zum Käfer. Jetzt im August schlüpfen die Käfer und sind bis Anfang September auch in Stadtbiotopen selbst von Laien zu erkennen. Nur wenige Tage darauf legen die Weibchen in der Nähe der Wildbienennester ein Eipaket von bis zu 2.700 Eiern ab. Nach drei bis vier Wochen schlüpfen die Larven, überwintern und nehmen im Frühjahr darauf ihrerseits das Taxi.
Früher nisteten so genannte Solitärbienen oft an Hohlwegen, Lösswänden und unverputzten Hauswänden. Diese Nistplätze sind zu einem großen Teil aus der Kulturlandschaft verschwunden, so dass Fundmeldungen des Schmalflügeligen Pelzbienen-Ölkäfers selten wurden, der wie alle Ölkäfer auf der Roten Liste der bedrohten Arten steht. In jüngster Zeit findet man den Käfer gelegentlich an regengeschützten und sonnenexponierten Stellen von Wänden oder Balkonen. Auch Ritzen, Fugen, Stopper von Rolläden sowie Wildbienen-Nisthilfen sind Ersatzlebensräume für die Bienen und damit mögliche Entwicklungsorte für den Käfer.
Foto: Bernd Stein

Nashorn Willi als „Smart Rhino“-Maskottchen
Nashorn Willi und Smart Rhino? Geht das? Natürlich geht das: Willi ist das smarte Rhino.
Willi ist der Star im Zoo Dortmund – populär und quirlig. Willi ist Symbol für die Zukunft der Nashornhaltung im Zoo Dortmund und ein wichtiger Sympathieträger für die Zukunft der vom Aussterben bedrohten Nashörner der Welt.
Smart Rhino ist das Stadtquartier der Zukunft. Symbol einer fortschrittlichen Stadt, die fit für die Zukunft ist. Ebenso wie Willi Mensch und Tier vernetzt, vernetzt Smart Rhino Wissen, Leben und Fortschritt in der Stadtgesellschaft. Und damit vernetzt Willi auch den Zoo Dortmund mit Smart Rhino. Der Zoo Dortmund ist schon jetzt ein national bedeutender urbaner Grünraum und Wissenschaftsstandort, der zur Stärkung der Wissensmetropole Ruhr beiträgt – einem der zentralen Ziele von Smart Rhino.
Smart Rhino ist ein Projekt der Thelen Gruppe mit der Stadt Dortmund, der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund (IHK) und der Fachhochschule Dortmund. Der Zoo Dortmund als Teil der Stadtfamilie ist damit ein natürlicher Partner des Projektes. Mit der offiziellen Übernahme der Patenschaft über Nashorn Willi heute seitens der Thelen Gruppe startet die symbolträchtige Partnerschaft.
Smart Rhino entwickelt auf der Brachfläche des ehemaligen Unternehmens Hoesch Spundwand (HSP) ein neues urbanes Quartier. Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft sollen hier gemeinsam Raum finden. Das Quartier soll sowohl inhaltlich als auch durch innovative Partizipation Modellcharakter haben.
Bildzeile: Übernahme der Patenschaft durch die Thelen Gruppe: Wolfgang Thelen, Christoph Thelen, Dr. Solveigh Backes (Thelen Gruppe), Prof. Wilhelm Schwick (FH Dortmund), Michaela Bonan (Stadt Dortmund), Wulf-Christian Ehrich (IHK zu Dortmund).
Foto: Torsten Tullius/Stadt Dortmund

Themen-Spielplatz in Eving – Am Externberg sind jetzt die Echsen los
Aus dem Wortspiel mit dem Namen der Straße „Externberg“ entstand das Thema
„Berg der Echsen – Leben der Zauneidechsen“. Jetzt ist die Umgestaltung des
Spielplatzes in der Grünanlage am Externberg in der Nähe des Evinger
Parkwegs abgeschlossen.
Entstanden ist das Projekt des Grünflächenamtes im Auftrag des Büros für
Kinder- und Jugendinteressen, das auch das pädagogische Konzept
ausgearbeitet hat. Für die Spielgeräte haben sich das Jugendamt und die
Bezirksvertretung die Kosten von rund 80.000 Euro fast geteilt. Für den
Garten- und Landschaftsbau kamen weitere 2.700 Euro aus dem Etat des
Grünflächenamtes hinzu.
Diese Umgestaltung ist der Auftakt von mehreren Baumaßnahmen zur Um- bzw.
Neugestaltung, die künftig noch im Park realisiert werden sollen. In die
Jahre gekommene und teilweise aus Sicherheitsgründen demontierte
Spielgeräte ließen den Spielplatz in der vergangenen Zeit für immer weniger
Kinder und deren Spielbedürfnisse ausreichend nutzbar sein. Durch die nun
fertig gestellte Umgestaltung sind wieder Kinder aller Altersgruppen
angesprochen.
Für die Allerkleinsten ist in der Nähe der Sitzbänke eine Sandspielanlage,
der „Echsen-Fels“, installiert worden. Diese ist teilweise inklusiv
nutzbar. Hier kann an einer kleinen Sandbaustelle gespielt werden und man
kann sich dort auch verstecken. Im Zugangsbereich zum Spielplatz wartet die
„Echsen-Wand“ auf neue Nutzer. In einem Memory sind Beutetiere, Fressfeinde
sowie die Lebensumstände der Zauneidechsen dargestellt und können paarweise
einander zugeordnet werden. Und: Es gibt auch eine Murmelbahn neben dem
Echsen-Memory. Einfach Murmeln von zuhause mitbringen. Auf der angrenzenden
Wiese können viele Kinder gleichzeitig auf einer großen Echse wippen. Im
Sandspielbereich nebenan gibt es nun neben der Doppel-Schaukel und der
Drehscheibe eine vielfältige Kletter- und Bewegungsspielanlage bis auf den
angrenzenden Hügel, den „Echsen-Berg“ hinauf. Hier im Kletterstangen-Gewirr
begegnen sich eine männliche und eine weibliche Zauneidechse.
Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind eingeladen, den Spielplatz
zu beleben und dabei pfleglich mit ihm umzugehen. Dann haben alle lange
etwas davon. Neben den Bürger*innen im direkten Parkumfeld kann diese
Anlage nun auch wieder von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden, die
in der Nähe die Grundschule, die Hauptschule, Kindertageseinrichtungen oder
die Jugendfreizeitstätte besuchen.
Foto: Stadt Dortmund

help and hope besetzt sechsköpfige Förderpreis-Jury
Förderpreis für das Engagement gegen Cybermobbing
Die Stiftung help and hope besetzte die diesjährige Förderpreis-Jury mit sechs fachkundigen Juroren. Bereits zum siebten Mal schreibt die Stiftung help and hope, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt, einen mit 10.000 Euro dotierten Förderpreis aus.
Gesucht wurden gemeinnützige Organisationen, die sich dem Thema Cybermobbing bei Kindern und Jugendlichen annehmen. „Denn das Internet vergisst nicht. Im Gegenteil: dem Gedächtnis des Internets sind keine Grenzen gesetzt. Es ist von Anonymität geprägt und bietet Unmengen an Möglichkeiten. Auch wenn das Internet keine Stimme hat, wird Cybermobbing immer lauter“, so Sandra Heller, Vorstandsvorsitzende der Stiftung help and hope.
Neben Lukas Pohland, ein fünfzehnjähriger Schüler aus Schwerte, der als Experte für Cybermobbing gilt und als Geschädigter mehrfach in Talkshows oder Anhörungen politischer Gremien eingeladen wurde, sind Dr. Catarina Katzer, eine deutsche Sozialpsychologin und Soziologin, die sich besonders mit den psychologischen und sozialen Auswirkungen und dem Denken und Handeln in der digitalen Welt befasst, Nadja Lüders, Abgeordnete im Landtag Nordrhein-Westfalen und Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen sowie Oliver Nauditt, Dortmunder Fotograf und Botschafter der Stiftung, Teil der diesjährigen Förderpreis-Jury. Vervollständigt wurde die Jury von Katharina Breiter, Verantwortliche im Bereich Projektförderung der Stiftung help and hope, und von Sandra Heller.
In der Jury-Sitzung, die nun auf Gut Königsmühle stattfand, wurde über eine Auswahl der Bewerber gesprochen und diskutiert. Ziel war es, einen würdigen Förderpreis-Sieger zu ermitteln. Dabei wäre die Mischung der Jury besonders wichtig: „Wie jedes Jahr haben wir bei der Auswahl der Jury bewusst auf eine bunte Mischung gesetzt und gleichzeitig eine sehr fachkundige Jury zusammengestellt. Wir haben die Bewerbungen intensiv betrachtet und nach verschiedenen Kriterien bewertet. Die tollen Bewerbungen machen es uns jedes Mal nicht leicht, sich für einen Sieger zu entscheiden. Dieses Jahr haben wir aber erschreckend festgestellt, dass das Thema nach wie vor nicht ausreichend behandelt wird. Umso erfreulicher, das Thema mithilfe unseres Förderpreises weiter in den Fokus zu rücken und auch dem Sieger damit eine wichtige Plattform für die wertvolle Arbeit zu geben“, so Heller abschließend.
Noch sei der Preisträger geheim, doch die Stiftung wird sich bald persönlich vor Ort ein Bild von dem Projekt machen und den Preis mitsamt dem Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro an die Verantwortlichen überreichen.
Bildzeile: v.l. Nadja Lüders, Oliver Nauditt, Lukas Pohland, Sandra Heller, Katharina Breiter.
Foto: help and hope-Stiftung Dortmund

Zeit nutzen mit Bus und Bahn: UmsteiGERN-Botschafterin Stefanie ist aus
Überzeugung auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen
Stefanie aus Barop nutzt Bus und Bahn aus Überzeugung. Den täglichen
Arbeitsweg in die Innenstadt legt sie mit der Bahn zurück. Dank der
nahegelegenen Haltestelle braucht sie so von Tür zu Tür nur 20 Minuten. Da
alle 10 Minuten eine U-Bahn in die Innenstadt fährt, ist es auch kein
Problem, wenn sie mal eine verpasst. „Nur eine klimafreundliche Stadt ist
eine schöne Stadt. Deshalb fahre ich gern mit Bus und Bahn.“ So lautet ihre
Botschaft, mit der sie auf Bussen, Bahnen, Plakaten, auf den
DSW21-Infoscreens in Stadtbahnhaltestellen und auf der Projektwebsite
www.umsteigern.de zum Umsteigen motiviert.
„Lieber warte ich kurz auf die manchmal verspätete U-Bahn, als Ewigkeiten
im Stau zu stehen“, sagt die 33-jährige UmsteiGERN-Botschafterin. Bus und
Bahn haben für sie überzeugende Vorteile: Der kurze Weg zur Haltestelle
bringt tägliche Bewegung und frische Luft, weniger Autos auf den Straßen
bedeuten für sie ein schöneres Stadtbild, und auch ihre Nerven werden
geschont, da sie nicht frustriert an roten Ampeln oder auf vollen Straßen
stehen muss. Außerdem nutzt sie die Zeit in der Bahn, um zu lesen, mit
Freund*innen zu schreiben oder entspannt einen Podcast zu hören. In ihrer
Freizeit steigt sie außerdem gern aufs Rad – und kann beim Einkaufen die
großen Packtaschen an ihrem E-Bike beladen. Da kam ihr die
UmsteiGERN-Kampagne genau recht, um sich als Botschafterin zu bewerben und
mit einem professionellen Fotoshooting belohnt zu werden.
Zum Umsteigen motivieren
Stefanie und ihr Partner haben festgestellt, dass sie ihr Auto in Dortmund
nicht benötigen. Daher haben sie es zu einem Camper umgebaut, mit dem sie
durch Deutschland touren. „Dann genieße ich das Autofahren auch“, räumt die
Baroperin ein.
Gern möchte sie auch andere zum Umsteigen motivieren. Deshalb wünscht sie
sich, dass möglichst viele Dortmunder*innen probeweise auf das Auto
verzichten: „Ein Tag in der Woche reicht ja schon, um zu merken, dass das
eigene Kfz gar nicht so essenziell für den Weg in die Innenstadt ist“,
schlägt sie vor.
Für eine klimafreundliche Gemeinschaft
Wer auch mitmachen und sich zu UmsteiGERN bekennen will, kann das eigene
Profilbild im Sammelalbum auf umsteigern.de hochladen oder sich als
Botschafter*in bewerben – je mehr mitmachen, desto größer ist die
klimafreundliche Gemeinschaft …
Als weitere ÖPNV-Botschafterin suchen wir noch eine Seniorin, die auch aus
Überzeugung regelmäßig Bus und Bahn fährt und mit ihrer Botschaft Nachbarn,
Freund*innen, Bekannte und Unbekannte ebenfalls zum Umsteigen auf
klimafreundliche Verkehrsmittel motivieren will. Interessentinnen können
sich mit Informationen zu ihrem Verkehrsverhalten bewerben unter
https://www.umsteigern.de/botschafter-werden.html
16 Maßnahmen für klimafreundliches Mobilitätsverhalten
Die Kampagne „UmsteiGERN. Du steigst um. Dortmund kommt weiter.“ ist eine
von 16 Maßnahmen des EU-Förderprojektes „Stadtluft ist (emissions-) frei –
Dortmunds Einstieg in eine emissionsfreie Innenstadt“. Die Europäische
Union und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützen das Förderprojekt mit
rd. 6,4 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE). Die Stadt Dortmund trägt 1,4 Millionen Euro dazu bei.
Bildzeile: Stefanie mit v.l. Projektleiter Andreas Meißner, DSW21- Marketingleiter Dr.
Heinz-Josef Pohlmann und Planungsamtsleiter Stefan Thabe.
Foto: Roland Gorecki/Dortmund-Agentur

DSW21 – so bunt wie Dortmund!
Stadtwerke werden für ihr Engagement für Vielfalt und Chancengleichheit ausgezeichnet
Die Dortmunder Stadtwerke AG ist so international und weltoffen wie die Stadt. Vielfalt ist die Stärke von DSW21 und der gesamten Unternehmensgruppe, die mit ihrem breiten Leistungsspektrum die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger betreibt: ÖPNV, Strom, Gas, Wasser, Wohnen, Logistik und Transport, Stadtentwicklungsprojekte – alles 21! Als buntes Verkehrsunternehmen bringt DSW21 mit Bussen und Bahnen Jahr für Jahr mehr als 130 Millionen Fahrgäste von A nach B. Jedenfalls in Jahren ohne Corona-Pandemie. Das klare Bekenntnis zu einer vielfältigen Stadtgesellschaft ist jetzt auch gut sichtbar. Am Eingang zur zentralen Stadtbahn-Haltestelle „Stadtgarten“ hängt neuerdings eine Tafel mit dem Schriftzug „DSW21 Wir fahren bunt!“ Das Motiv zeigt Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religion.
Bürger*innen aus mehr als 160 verschiedenen Nationen leben in Dortmund. Rund 110.000 der knapp über 600.000 Einwohner*innen haben ihre familiären Wurzeln nicht in Deutschland – das ist fast jede/r Fünfte. Sie verständigen sich in 150 verschiedenen Sprachen. Und DSW21 – ist genau so bunt und vielfältig. Beinahe 300 der knapp 2.000 Beschäftigten stammen ursprünglich aus anderen Ländern. Die Türkei (93) und Polen (69) sind dabei am stärksten vertreten. Aber auch Kolleg*innen aus Mali, Kamerun und Syrien, aus Brasilien, Laos, Tadschikistan und Kirgisistan, von der Elfenbeinküste und Sri Lanka bereichern das Unternehmen mit ihrem kulturellen Hintergrund.
„Für uns spielt es überhaupt keine Rolle, wo auf der Welt jemand seine Wurzeln hat“, sagt Verkehrsvorstand Hubert Jung. Und Arbeitsdirektor Harald Kraus ergänzt: „Was zählt, ist, dass aus den individuellen Talenten und Potenzialen bei DSW21 und den anderen Unternehmen der Gruppe eine verbindende Zusammenarbeit wird.“
Die Unterschiedlichkeit der Beschäftigten nicht nur hinsichtlich ihrer Herkunft trägt maßgeblich zur modernen und zukunftsfähigen Ausrichtung der Unternehmen der 21-Gruppe bei. Übrigens: Das Engagement für Chancengleichheit hat DSW21 jetzt auch Schwarz auf Weiß. Bereits zum dritten Mal hat der Verein Total E-Quality Deutschland die Dortmunder Stadtwerke mit dem Prädikat „Total E-Quality“ und in diesem Jahr erstmals auch mit dem Zusatz „Diversity“ ausgezeichnet. In der Begründung hebt die Jury u.a. die zahlreichen Maßnahmen zur Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung, die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Beteiligung von Kirsten Fronz als Referentin für Diversity-Management an allen relevanten Prozessen im Unternehmen hervor.
Bildzeile:
DSW21-Arbeitsdirektor Harald Kraus, Verkehrsvorstand Hubert Jung und die Diversity-Referentin Kirsten Fronz vor dem sichtbaren Bekenntnis zur Vielfalt in der Station „Stadtgarten“.
Foto: DSW21/Jörg Schimmel

Arbeiskreis Sexuelle Bildung informierte an zwei Standorten
Nachhilfe in Sachen Lust und Liebe während
des Nachmittagspaziergangs im Westpark
Die richtigen Quiz-Antworten waren nicht das Wichtige, sondern das Gespräch über die Themen an sich: Lust und Liebe, Sex und Gefühle, Coming Out und Recht sowie sexuell übertragbare Infektionen – viele Menschen, die am Dienstag an einem der beiden Stände des Dortmunder Arbeitskreises Sexuelle Bildung stehen blieben, gingen nach der Unterhaltung mit mehr Wissen weiter als sie vorher hatten. Von unterschiedlichen Kondomgrößen hatten einige Standbesucher*innen hier zum ersten Mal gehört wie auch von dem lateinischen Namen Frenulum für das Vorhautbändchen. Ob alles gewusst war oder nicht: Als Preis gab’s auf jeden Fall Gummis – Gummibärchen und Kondome.
20 Jahre existiert der Arbeitskreis mittlerweile. Dieser Geburtstag sollte im Herbst mit einer Aktionswoche gefeiert werden. Die wurde gestrichen aus Vorsicht vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus. Und da auch die meisten Unterrichtsbesuche der Vereine, die im Arbeitskreis Mitglied sind, im ersten Halbjahr ausfielen, überlegte man sich die Aktion mit den Info-Ständen. Sowohl im Westpark wie an der Reinoldikirche konnten Interessierte erst auf Dosen werfen und am Glückrad drehen, dann Quizfragen beantworten und sich viele Broschüren mitnehmen, die viel Wissenswertes enthalten. „Wir hatten drei Stunden lang gut zu tun“, sagt Mareike Wellner von der AWO. „Interessierte jeden Alters machten mit.“
Mareike Wellner, Michael Schank von Sozialen Zentrum und Sophie Prickler von der Aidshilfe kamen im Westpark ins Gespräch mit Jugendlichen und Erwachsenen, vor der Reinolidkirche betreuten den Stand und die Passant*innen Katharina Sonnet von Lebedo, Anne Lanfermann vom Förderverein zur Bekämpfung von Aids sowie Alexandra Demel und Stefanie Menneken vom Jugendamt.
Alle Vereine und kommunale Beratungsstellen, die sich im Arbeitskreis zusammengetan haben, bieten Workshops zur sexuellen Bildung in Schulen und Jugendzentren an. „Wir sind sehr gut gebucht. Man kann schon sagen: Es gibt zu wenig von uns“, so Mareike Wellner, die auch für die Kooperationspartner*innen spricht. Wer in den Schulstundenplan oder das Jugendzentrum-Programm eine Weiterbildung in Sachen Körper und Gefühl, das erste Mal, Verhütung und Sex und Gesetz aufnehmen möchte, wendet sich direkt an die Arbeitskreis-Mitglieder. Der Flyer mit den Adressen und Telefonnummern aller ist im Netz auf der Seite www.awo-dortmund.de/sexual-bildungsarbeit zu finden.
Bildzeile: v.l. Michael Schank vom Sozialen Zentrum, Sophie Prickler von der Aidshilfe und Mareike Wellner von der AWO.

Dortmunder Architekten mit polis Award für Baugruppen-
Projekt ausgezeichnet
Das Dortmunder Architektur- und Stadtplanungsbüro post welters + partner hat den dritten
Preis beim diesjährigen polis Award in der Kategorie »soziale Quartiersentwicklung«
gewonnen. Der renommierte Preis würdigt bundesweit Projekte, die über ihren eigenen
Rahmen hinaus einen Beitrag für das öffentliche Wohl einer Stadt erbringen. Den Juryvorsitz
hatte in diesem Jahr Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Ein
weiteres Mitglieder der prominent besetzen Jury waren die Aachener Planungsdezernentin
Frauke Burgdorff.
Aus über 150 eingereichten Projekten wurde das familienfreundliche Wohnhaus für die
Baugruppe »wmk3 – Wohnen mit Kindern« in Düsseldorf-Gerresheim mit dem 3. Polis Award in
der Kategorie »soziale Quartiersentwicklung« ausgezeichnet. Die Baugruppe »wmk3 – Wohnen
mit Kindern« realisierte hier ihr Wohnprojekt mit 30 individuell geplanten Eigentums- und
Mietwohnungen, einem Gemeinschaftshaus und einer Tiefgarage.
Erklärtes Ziel der Baugruppe war es, familienfreundliche Wohnungen in Gemeinschaft zu
planen und zu realisieren. Sie sollten für alle Generationen attraktiv und für junge Familien
bezahlbar sein. Erste Priorität hatte daher kostengünstiges Bauen. Nachhaltigkeit/Ökologie,
ausreichende Flächen für Begegnung und Gemeinschaft und eine hohe Gestaltqualität waren
die weiteren wichtige Ziele. Die Planer wollten Begegnungen auf den Schnittstellen alltäglicher
Wege fördern und so mit der Architektur den Gemeinschaftsgedanken stärken. Die
Erschließung aller Wohnungen erfolgt daher über offene Galerien und einen zentralen,
skulpturalen Treppen- und Aufzugsturm. Das »Gemeinschaftshaus« wurde als eigenständiger
Baukörper am Schnittpunkt der Wohnflügel ausgebildet.
Besonderen Wert legte die Gruppe auch auf den Mehrwert fürs Quartier: Ein großer Gartenhof
mit einem öffentlichen, von der Baugruppe eigens erstellten Quartiers-Spielplatz, wird von
den Gebäudeflügeln des Wohnhauses städtebaulich gefasst. Der Gemeinschaftsraum im
Erdgeschoss öffnet sich mit einer Außenterrasse zum öffentlichen Raum.
Mit seiner »kommunikativen« Architektur bietet das Haus seinen Bewohnern differenzierte
Räume, die zu informellen Begegnungen einladen. Das architektonisch verbindende Element
sind die zum Hof orientierten Erschließungsgalerien. Zwischen den Galerien und zum Hof
ergeben sich vielfältige Blickbeziehungen und somit – auf jedem alltäglichen Weg zur
Wohnung – die Chance einem Nachbarn zu begegnen. Die Galerie bietet je nach Bedarf Platz
für ein zwangloses Schwätzchen oder zum Bobbycar fahren – auch bei Regen.
Foto: Cornelia Suhan

Dortmunds Polizeipräsident begrüßt neue Einsatzkräfte: „Wir bieten und verlangen viel“
Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange begrüßte im regionalen Trainingszentrum der Polizei in Aplerbeck 159 neue Kolleginnen und Kollegen. Darunter 136 graduierte Polizeikommissarinnen und -kommissare, die nach einer intensiven dreijährigen Ausbildung ihren Dienst beim Polizeipräsidium Dortmund antreten, und 23 Polizeivollzugsbeschäftigte, die nach Dortmund versetzt worden sind.
Sie alle sind ab sofort in Dortmund, Lünen und bei der Autobahnpolizei im Einsatz. Im Trainingszentrum in Aplerbeck legten die neuen Kommissarinnen und Kommissare den Diensteid ab.
In seiner Begrüßung skizzierte Polizeipräsident Gregor Lange die Aufgabenvielfalt, und Herausforderung die der Polizeiberuf auch in Dortmund und Lünen bietet und allen zugleich viel Verantwortung abverlangt: „Wir müssen weiter Straftaten aufklären und verhindern und die Zahl der Verkehrsunfälle reduzieren – auch wenn wir dabei bereits erfolgreich sind: Wir brauchen Sie dringend. Wir alle müssen noch mehr Sicherheit produzieren, um den Erfolg fortsetzen zu können“, sagte er am Dienstag mit Blick auf die seit mehreren Jahren schon sinkenden Zahlen sowie aktuelle und zukünftige Herausforderungen.
Das Polizeipräsidium Dortmund bietet und verlangt viel, wie dieses Beispiel zeigt: „Mit unseren Konzepten gegen die Clan-Kriminalität und gegen den Rechtsextremismus bilden wir wichtige Schwerpunkte im Einsatz für eine sichere Stadt und für die Demokratie“, sagte Gregor Lange, „zugleich stehen wir aktuell vor besonderen Herausforderungen: Die Vermischung von Pandemieleugnern und Rechtsextremisten ist brandgefährlich. Die Polizei muss sehr wachsam sein. Auch Sie, die neuen Einsatzkräfte, sind nach einer fundierten Ausbildung Garanten für den Rechtsstaat und die Demokratie. Das erfordert rechtsstaatliches Denken und Handeln, Professionalität und ein hohes Maß an Engagement.“
Am 1. September 2020 haben 284 Kommissarsanwärterinnen und -anwärter ihr Bachelorstudium begonnen. Ihre Praktika absolvieren sie während des Studiums im Wach- und Wechseldienst des Polizeipräsidiums Dortmund. Die Leitende Regierungsdirektorin Ines Verhaaren begrüßte die neuen Studierenden und auch acht Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter (RIA). Die RIA beginnen ihre Ausbildung in der Direktion für Zentrale Aufgaben beim Polizeipräsidium Dortmund.
Die Direktion für Zentrale Aufgaben regelt u. a. interne Verwaltungsangelegenheiten, managt den Immobilienbestand, ist für das Waffen- und Versammlungsrecht zuständig und sorgt in vielen (auch technischen) Bereichen dafür, dass die Polizei funktioniert.
Das Polizeipräsidium Dortmund beschäftigt an seinen 25 Standorten in Dortmund, Lünen und an den Autobahnen insgesamt 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Alle zwei Wochen beginnt um 16 Uhr im Präsidium an der Markgrafenstraße 102 für Interessenten eine Inforunde über Studium und Polizeiberuf. Die nächsten Termine: 9. und 23. September 2020. Anmeldungen per E-Mail an: personalwerbung.dortmund@polizei.nrw.de
Polizeipräsident Gregor Lange vereidigte die neuen Polizeikommissarinnen und -kommissare.
Foto: Polizei Dortmund / Maik Müller

Halbzeit bei der Hörder Wanderbaum-Allee
Nachdem die Wanderbaum-Allee bereits in vier Straßen rund um den Hörder Neumarkt zu Gast war, ist mit dem Einzug der Bäume in die Beukenbergstraße am 7. September die Halbzeit des Projekts erreicht. Die Aktion wird vom Amt für Stadterneuerung durchgeführt und soll den Anwohner*innen die Wirkung von Straßenbäumen verdeutlichen. Ziel ist es, mit ihrer Hilfe die Entscheidung über tatsächliche Baumstandorte zu treffen.
Auf der Internetseite https://beteiligung.hoerder-stadtteilagentur.de/wanderbaumaktion/ stellt die Hörder Stadtteilagentur die Aktion im Auftrag der Stadt Dortmund detailliert vor. Dort können Anwohner*innen Fragen zur Wanderbaum-Allee stellen und angeben, welche der ausgewählten Straßen sie für Bäume vorschlagen.
E-Mail: info@hoerder-stadtteilagentur.de
Foto: Stadt Dortmund

Nach nur einem Jahr Bauzeit: Oberbürgermeister Ullrich Sierau übergibt zwei neue Dreifach-Sporthallen in Brackel
Am Standort der Geschwister-Scholl GES/Haferfeldstraße wurden jetzt nach nur einem Jahr Bauzeit zwei neue Dreifachsporthallen fertiggestellt, die heute von Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, übergeben wurden.
Nach Erteilung der Baugenehmigung im Juli 2019 wurde im August 2019 mit den Bauarbeiten der neuen Dreifachsporthallen begonnen. Durch eine intensive Projektvorbereitung mit den Vertragspartnern konnte eine optimale Projektkoordination erzielt werden. „Beide Dreifachsporthallen konnten in der Rekordzeit von nur einem Jahr fertig gestellt werden“, hebt OB Ullrich Sierau hervor. „Dieses sportliche Tempo ist auch bei weiteren Hallen unser Maßstab. Der kontinuierliche und Millionen schwere Ausbau der sportlichen Infrastruktur steht ganz oben auf unserer Tagesordnung, so dass Dortmund seinem Ruf als Sportstadt weiter gerecht werden kann.“
Halle 01 fasst bis zu 600 Besucher
Die Sporthalle 01 ist mit einer elektrisch ausfahrbaren Tribünenanlage für bis zu 600 Besucher ausgelegt und kann baurechtlich als Versammlungsstätte genutzt werden. Die Sporthalle 02 wurde ebenfalls mit einer elektrischen Tribünenanlage ausgestattet und ist für eine Nutzung mit bis zu 199 Personen ausgelegt.
Die Gebäudehülle und die Heizungsanlage entsprechen den Anforderungen der geltenden Energieeinsparverordnung und den energetischen Standards der Stadt Dortmund. Alle Dachflächen haben eine extensive Begrünung erhalten.
Gesamtkosten von rund 10,6 Millionen Euro
Die Kosten für den Neubau inklusive Ausstattung mit Sportgeräten, sowie der Abbruch der beiden alten Hallen werden mit insgesamt ca. 10,6 Mio. EUR beziffert. Die Finanzierung ist mit Fördermittel aus dem Kreditprogramm Gute Schule 2020 ermöglicht worden.
Die Außenanlagen rund um die neuen Sporthallen stehen kurz vor der Fertigstellung. Planmäßig sollen die alten Sporthallen Brackel I und II Ende 2020/Anfang 2021 abgerissen werden.
Sporthallenprogramm
Die Stadt Dortmund arbeitet weiterhin an einer kontinuierlichen Verbesserung der Sportlandschaft. So investiert die Stadt kontinuierlich und nachhaltig in die Bildungsinfrastruktur, unter anderem auch unter Verwendung diverser Förderprogramme aus Bundes- und Landesmitteln wie zum Beispiel dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm oder Gute Schule 2020.
Diese Investitionsmaßnahmen betreffen auch Dortmunds Sport- und Turnhallen. Damit sie fit für die Zukunft werden, hat die Stadt allein im vergangenen Jahr bereits über 20 Millionen Euro in diesem Bereich eingesetzt. Weitere rund 108 Millionen Euro wird die Stadt in den kommenden Jahren für die Sanierungsarbeiten bzw. Neubauten von Sportstätten investieren. Derzeit werden 40 Sanierungs- und Baumaßnahmen an Sport- und Turnhallen ausgeführt bzw. geplant. Erst kürzlich wurde der Bau für eine Dreifachsporthalle in der Gartenstadt begonnen. Bauliches Vorbild ist das Projekt in Brackel.
Bildzeile: Innenansicht einer der Hallen.
Foto: Städtische Immobilienwirtschaft/Hamann

Einbürgerungsfeier 2020
Einbürgerung wird gefeiert
Anfang September fand in der Messehalle 1 des Kongress Dortmund die traditionelle jährliche Einbürgerungsfeier der Stadt Dortmund statt. Mit dieser jährlich ausgerichteten Feier wurden in diesem Jahr, die Menschen geehrt, die im Jahr 2019 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben. Im vergangenen Jahr haben sich 1.280 Personen zu diesem Schritt entschlossen. Rund 150 Eingebürgerte sind der Einladung von Oberbürgermeister Sierau gefolgt und haben mit familiärer Begleitung an der Veranstaltung teilgenommen.
Dortmund hat seit Jahren konstante Einbürgerungszahlen, auch begleitet durch verschiedene Maßnahmen und Kampagnen der Verwaltung und des Integrationsrates. Die Integration von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft ist ein Schwerpunkt der Dortmunder Politik, denn eine gelungene Integrationspolitik ist der Schlüssel für die Zukunft der Stadt. Die Einbürgerung ist dabei ein starkes Instrument. Sie ermöglicht Bürger*innen mit Migrationshintergrund mehr politische Mitbestimmung. Die Feier, welche in diesem Jahr bedingt durch die Corona Pandemie mit ausreichend Abstand zueinander durchgeführt wurde, soll die neu Eingebürgerten in ihrer neuen Staatsbürgerschaft willkommen heißen. Sie dient ihrer Anerkennung und würdigt die Bereitschaft, mit der Einbürgerung ihre gesellschaftliche Partizipation, Integration und Identifikation zu stärken.
Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung, welche aufgrund der Covid 19 – Pandemie unter Einhaltung besonderer hygienischen Schutzmaßnahmen in der Messehalle 1 des Kongress Dortmund stattgefunden hat und von Ester Festus moderiert wurde, war die Ehrung der/des jüngsten und ältesten Eingebürgerten durch Oberbürgermeister Ullrich Sierau und die Vorsitzende des Integrationsrates, Aysun Tekin. Diese erhielten stellvertretend für alle Eingebürgerten eine kleine Aufmerksamkeit.
Veranstalter der Einbürgerungsfeier ist das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Dortmund (MIA-DO-KI) sowie der Integrationsrat der Stadt Dortmund.
Bildzeile: OB Ullrich Sierau und die Vorsitzende des Intergrationsrates Aysin Tekin mit dem jüngsten Eingebürgerten George Vanea (zweieinhalb Jahre alt).
Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Heike Heim ist neue Botschafterin von Löwenzahn
Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn in Dortmund freut sich, dass Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung der DEW21 ab jetzt Botschafterin für die gute Sache ist.
Heike Heim unterstützt den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn, der im August 2018, also vor fast genau zwei Jahren in Dortmund an den Start ging. 41 Kinder und Jugendliche konnten seitdem in die Begleitung aufgenommen werden. In zwei Gruppen treffen sich Geschwister von lebensverkürzend erkrankten Kindern einmal monatlich.
„Wir freuen uns darüber, dass Heike Heim unser Projekt auf diese Weise mit bekannt macht und hilft, es weiter anzuschieben,“ sagt Beate Schwedler, Vorsitzender des Trägervereins Forum Dunkelbunt e.V., „gerade Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind haben es in der Coronazeit besonders schwer gehabt und wir versuchen, sie mit unseren Ehrenamtlichen im Alltag zu unterstützen.“
„Ich habe große Hochachtung vor der Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Löwenzahn. Die ehrenamtliche Unterstützung aus der Stadtgesellschaft kommt genau dort an, wo sie dringend benötigt wird,“ begründet Heike Heim ihr Engagement. „Besonders bemerkenswert ist, dass der Dienst sein Augenmerk auch auf die Arbeit mit Geschwistern legt, die in solchen schweren Situationen manchmal nur an zweiter Stelle stehen.“
Den Dortmundern ist Heike Heim schon länger bekannt. Als sie am 1. Juli 2017 den Vorsitz der Geschäftsführung der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH übernahm, bekamen die DEW21 erstmals eine Chefin. Sie verantwortet u.a. den kaufmännischen Bereich, Vertrieb, Handel und IT/Digitalisierung.
Heike Heim hat an der TU Darmstadt als Diplom-Wirtschaftsingenieurin mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik abgeschlossen. Nach ihrem Studium sammelte sie erste Praxiserfahrungen im Bereich Anlagenbau/Energietechnik und in der IT-Branche.
Nach einer knappen Dekade in der internationalen Beratungsbranche folgte 2011 die Rückkehr in die Energiewirtschaft zur MVV Energie AG als Bereichsleiterin Controlling und Risikomanagement. 2013 wurde sie zur Vorstandsvorsitzenden der Energieversorgung Offenbach AG ernannt, bevor sie dann zur DEW21 wechselte.
Bildzeile: DEW-Chefin Heike Heim ist neue Botschafterin des Kinder- und Jugendhospizdienstes Löwenzahn.
Foto: DEW21

200 Quartiersmasken für Schüler*innen der Grundschulen in Westerfilde & Bodelschwingh genäht
Dank ehrenamtlicher Unterstützung freut sich die Schulleiterin der Westhausen Grundschule und natürlich die Schüler*innen über rund 100 selbstgenähte Quartiersmasken, die vom Quartiersmanagement Westerfilde & Bodelschwingh überreicht wurden.
In kurzer Zeit haben Ehrenamtliche für beide örtlichen Grundschulen zweihundert Mund-Nasen-Schutze aus dem beliebten Quartiersstoff genäht, den das Amt für Stadterneuerung produzieren ließ und samt aller notwendigen Materialien den Ehrenamtlichen zur Verfügung stellte.
Zum Beginn des neuen Schuljahres stand auch für die Grundschulen in den Stadtteilen Westerfilde & Bodelschwingh die Maskenpflicht für ihre Schüler*innen fest. Grundsätzlich müssen die Eltern der Schulkinder für die Ausstattung ihrer Kinder, auch mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, sorgen. Aber trotzdem war klar, einige Masken werden vergessen, verloren oder nicht regelmäßig gewechselt und daher war der Bedarf für die Grundschulen ganz klar – sie benötigen Masken!
Da ist es nur gut, dass es in den beiden Stadtteilen Westerfilde & Bodelschwingh ein gut funktionierendes Hilfenetzwerk aus ehrenamtlich nähenden Nachbar*innen gibt.
Foto: Benito Barajas

Silbernes Betriebsjubiläum
für kreative Schneidermeisterin
Monika Granzner-Süshardt schneidert seit 25 Jahre hochwertige Mode für ihre Kundinnen / Exklusive und tragbare Garderobe ist Markenzeichen des Modeateliers in Waltrop
Auf 25 Jahre erfolgreiche Tätigkeit als selbstständige Damenschneidermeisterin kann die Waltroperin Monika Granzner-Süshardt zurückblicken. Anlässlich des Jubiläums ließen es sich Inge Szoltysik-Sparrer, Obermeisterin der Innung für Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet und Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas nicht nehmen, persönlich zur Gratulation zu kommen und die Ehrenurkunde des Handwerks zu übergeben.
Ein Leben für die Mode
Monika Granzner-Süshardt, die ihr Modeatelier am Waldweg 12 in Waltrop betreibt, kann auf eine bewegte berufliche Laufbahn zurückschauen. Nach ihrer Ausbildung 1968 in Wattenscheid besuchte die junge Schneidergesellin die Fachschule für Mode und Schnitttechnik M. Müller & Sohn in Düsseldorf, absolvierte dort eine Directricen-Ausbildung (Schnitttechnik) und ging danach nach Rotenburg ob der Tauber. Mit viel Elan machte sie sich anschließend an die Meisterausbildung und legte im Juni 1976 erfolgreich ihre Prüfung vor der Handwerkskammer Düsseldorf ab. Danach trat sie eine Stelle beim Modekonzern Klaus Steilmann in Wattenscheid an, wo sie 17 Jahre lang – zuletzt in leitender Position – blieb. Aus familiären Gründen verließ sie dann das Unternehmen und machte sich 1995 mit ihrem eigenen Modeatelier selbstständig. Zunächst schneiderte sie Kindermode, später exklusive Damenoberbekleidung.
Exklusive Damenmode aus Waltrop
Diesem Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die 67-Jährige bis heute treu geblieben. Zu ihren Aufträgen gehören vor allem Maßanfertigungen für qualitäts- und modebewusste Kundinnen. „Das muss nicht immer die Festtagsgarderobe sein“, erklärt Monika Granzner-Süshardt. „Mir macht es auch Spaß für meine Kundinnen hochwertige Alltagsmode herzustellen oder fachgerechte Änderungen an Kleidung vorzunehmen – ganz nach den Wünschen meiner Auftraggeber.“ Dass der Spaß an der Arbeit bis jetzt geblieben ist, sieht man Monika Granzner-Süshardt an, besonders, wenn Sie von Geschichten glücklicher Kundinnen erzählt, zum Beispiel bei Hochzeitskleidern. Und davon weiß sie viele zu erzählen.
Bildzeile: Herzliche Glückwünsche der Innung zum 25-jährigen Betriebsjubiläum überbrachte Inge Szoltysik-Sparrer (l.) , Obermeisterin der Innung für Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet, an Schneidermeisterin Monika Granzner-Süshardt in Waltrop.
Foto: Innung

Im Kirchenkreis Dortmund kann man Organist/in werden
‚Auf Du und Du‘ mit der Königin der Instrumente
Sie wird nicht umsonst die ‚Königin der Instrumente‘ genannt. Eine Orgel beeindruckt – zumeist in Kirchen – durch ihr Klangvolumen, sehr unterschiedliche Klangfarben und die erhabene Atmosphäre, die ihre Musik zu schaffen vermag. Orgelklassiker von Bach oder Händel, aber auch modernere Werke, etwa des französischen Komponisten Olivier Messiaen, bieten für Musikliebhaberinnen und –liebhaber großen Hörgenuss.
Die wenigsten von ihnen aber haben die Gelegenheit, selber auf so einer Orgel zu musizieren. In Dortmund und Lünen wird das jetzt möglich. Denn der Evangelischen Kirchenkreis bietet dafür eine niederschwellige kirchenmusikalische Ausbildung an. Teilnehmen kann jede und jeder, die/der grundlegende musikalische Vorkenntnisse mitbringt. Wer also beispielsweise Klavier spielt, Noten lesen kann oder Erfahrung aus dem Chorgesang mitbringt, der kann sich für den Ausbildungskurs, der an Wochenenden und Abenden laufen wird, anmelden. Kantorinnen und Kantoren des Evangelischen Kirchenkreises ebnen ihnen dann einen Weg zur ‚Königin der Instrumente‘.
Ein gutes Jahr wird die Ausbildung dauern und in eine kirchenmusikalische D-Prüfung münden. In dem Kurs lernen Teilnehmende neben dem Orgelspiel, das in Einzelunterricht vermittelt wird, musikalische Grundlagen wie Harmonielehre oder Gehörbildung. Auch wie man einen Chor oder den Gesang der Gemeinde anleitet, steht auf dem Ausbildungsplan.
Nicht zuletzt gibt es einen Einblick in Gottesdienstformen und Gesangbuchkunde. Denn die Orgel kommt oft in Andachten und Gottesdiensten zum Einsatz. Wer sie spielen kann, wird von Zeit zu Zeit in einer Kirche mitwirken können.
Engagierte Kirchenmusikerinnen und –musiker, die Freude am Orgelspiel oder auch am gemeinsamen Musizieren in Gruppen und Chören haben, sind in vielen Gemeinden sehr begehrt. So werden die künftigen Organistinnen und Organisten zahlreiche Gelegenheiten finden, ihre erlernte Kunst zum Einsatz zu bringen. Wer Freude an Musik hat und sich in Kirchenräumen wohl fühlt, der kann sich auf diese Weise eine erfüllende neue Aufgabe schaffen.
Künftige Organistinnen und Organisten müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Sie sollten nach Möglichkeit einer christlichen Kirche angehören. Für die kirchenmusikalische Ausbildung erhebt der Evangelische Kirchenkreis eine Teilnahmegebühr in Höhe von 80,- Euro. Eine Ermäßigung ist aber im Einzelfall auf Anfrage möglich.
Die Ausbildung beginnt im September mit einer kleinen Aufnahmeprüfung. Der Termin kann individuell vereinbart werden. „Da schauen wir miteinander, ob der Kurs wirklich für die Interessentin oder den Interessenten das Richtige ist“, sagt Kreiskantor Wolfgang Meier-Barth. Niemand müsse indes vor der Prüfung Sorge haben. Der Kreiskantor ist Ansprechpartner für alle, die Lust haben mitzumachen. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei ihm melden. Dann steht der persönlichen Freundschaft mit der Königin der Instrumente nichts mehr im Wege.
Kontakt: Kreiskantor Wolfgang Meier-Barth, Tel.: 02306.370641,
E-Mail: meier-barth@gmx.de.
Bildzeile: Kreiskantor Wolfgang Meier-Barth und die Kantorinnen Bettina Knorrek und Jutta Timpe (am Klavier) verschaffen zusammen mit weiteren Kantorinnen und Kantoren den Zugang zur ‚Königin der Instrumente‘.
Foto: Stephan Schütze

Algenschatz im PHOENIX See – Armleuchteralge ist regionaler Exportschlager und sorgt für gute Wasserqualität
Die vergangenen von extremer Hitze und Trockenheit geprägten Sommer der Jahre 2018 und 2019, aber auch der gegenwärtige Sommer, haben bundesweit örtlich zu Problemen bei den Stillgewässern geführt. Sinkende Pegelstände in Verbindung mit hohen Wassertemperaturen führten bei nicht wenigen Gewässern gar zu dem befürchteten „Umkippen“ mit teils drastischen Folgen für Wasserflora und -fauna.
Der PHOENIX See hat hingegen die beiden vergangenen Extrem-Sommer sowie den laufenden Sommer gut überstanden. Der See-Pegel sank dabei im Maximum um 34 Zentimeter (im Jahr 2018), in diesem Sommer lediglich um rd. 10 cm. Ursache für den vergleichsweise moderaten Spiegelabfall ist die ergiebige Grundwasserspeisung, die die hohen Verdunstungsraten ausgleichen konnte. Das zuströmende Grundwasser sorgte dabei zugleich für eine Kühlung des sogenannten Seewasserkörpers. Dies kam der bereits gut entwickelten Fischpopulation (kein Fischsterben!) sehr zugute. Die in der Haupt-Windrichtung West-Ost ausgerichtete Orientierung des Sees und die dadurch ausgelöste Umwälzung begünstigte zudem eine stets gute Sauerstoffversorgung des Seewassers.
Oberbürgermeister Ullrich Sierau macht in diesem Zusammenhang deutlich: „Die richtungsweisende Entscheidung der Stadt Dortmund zur Realisierung des PHOENIX Sees ist eine pure Erfolgsgeschichte. Davon zeugt neben der Verleihung des Deutsche Städtebaupreises 2018 der vor Ort erlebbare Mehrgewinn für die Natur und den Menschen und hier nicht zuletzt der positive Effekt für das Stadtklima.“
Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft ergänzt: „Der Phoenix See ist ein Musterbeispiel dafür, welche Impulse vom Umbau der Emscher ausgehen können. Hier am Phoenix See kommen Wohnen, Arbeiten, Technologie und Freizeit zusammen. Wir zeigen so, welch städtebaulichen Meilensteine wasserwirtschaftliche Themen setzen können.“
Damit der PHOENIX See auch in den Sommermonaten seine hervorragende Wasserqualität behält, werden dem See ständig Nährstoffe entzogen. Dazu dient insbesondere die im Hafenbereich errichtete, von der Emschergenossenschaft im Auftrag der Stadt Dortmund betriebene Phosphat-Eliminationsanlage. Auch die kontinuierliche Entnahme von Wasserpflanzen per Amphibienfahrzeug durch die Stadtentwässerung Dortmund (Betrieb PHOENIX See) trägt dazu bei.
Doch auch wenn Wasserpflanzen Nährstoffe grundsätzlich binden können, was positiv zu werten ist, führen zu viele Nährstoffe häufig zu unerwünscht starkem Pflanzenwachstum. Um das zu vermeiden und den ganzjährig stattfindenden Bootsverkehr nicht durch zu hohe Algen zu behindern, entschied man sich bei der Seegestaltung für eine ganz besondere Pflanze: Auf dem Seegrund wurde flächig die von niedrigem Wuchs (30-40 cm) geprägte Armleuchteralge (lat. Characeae) angesiedelt. Hierbei handelte es sich um ein in dieser Größenordnung bundesweit einmaliges Pilotprojekt. Im Ergebnis kann das Projekt als voller Erfolg gewertet werden.
Ein von der Stadtentwässerung Dortmund beauftragtes Gutachten belegt, dass mehr als drei Viertel des Seegrunds mittlerweile mit einem sehr dichten, niedrig wachsenden Pflanzenteppich belegt sind, der andere unerwünschte, höherwachsende Wasserpflanzenarten (z. B. „Wasserpest“, lat. Elodea – oder „Tausendblatt“, lat. Myriophyllum) verdrängt hat.
Der PHOENIX See hat seine Armleuchteralge bereits an andere Seen exportiert, deren Bootsverkehre in den letzten Jahren in weiten Teilen durch höherwachsende Wasserpflanzen beeinträchtigt wurden. So konnten u.a. an den Ruhrverband im Zuge eines Forschungsvorhabens für den Baldeneysee einige durch Taucher aus dem PHOENIX See entnommene Armleuchteralgen übergeben werden. Somit können auch weitere Gewässer vom „Algenschatz“ aus dem PHOENIX See profitieren.
Bildzeile: v.l. Ortstermin mit Armleuchteralge: Bernd Möhring, Prof. Dr. Uli Paetzel, Ullrich Sierau und Georg Sümer.
Foto: Stadt Dortmund

„Picture your MINT!“-Videofilm-Wettbewerb
Offizielle Preisübergabe durch Jurymitglieder
Ende Juni rief das Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund (KITZ.do) unter dem Motto „Picture your MINT!“ erstmalig zum Videofilmwettbewerb auf.
Gefragt waren Videos, selbstgedreht und frei in der Themenwahl, die wissenschaftliche Phänomene inhaltlich richtig und unterhaltsam erklären.
Die Idee entstand in den ersten Tagen der Covid19-Maßnahmen und die daraus resultierenden eingeschränkten Möglichkeiten eines Regelbetriebs. Dr. Ulrike Martin, Leiterin KITZ.do: „Wir möchten mit diesem Wettbewerb eine Plattform schaffen, die zeigt, wieviel Kompetenz bei den jungen Leuten in der Nutzung digitaler Medien schon vorhanden ist und einen Anreiz geben, diese auch für die MINT-Bereiche zu nutzen.“
Die eingereichten Beiträge überzeugten die Jurymitglieder Prof. Metin Tolan, Professor für Experimentelle Physik an der TU Dortmund, Dr. Marcel Beller (Unternehmensverbände der Metallindustrie Dortmund und Umgebung e.V.) und Dr. Ulrike Martin.
Sie prämierten gestern die Besten aus und entschieden spontan, einen Sonderpreis zu verleihen.
Prof. Metin Tolan: „Mit dem Preis möchten wir das besondere Engagement einer ganzen Familie auszeichnen, aus der gleich drei Kinder im Alter von 6, 11 und 13 Jahren teilnahmen. Wir freuen uns sehr über diese wunderbare private MINT-Förderung innerhalb der Familie.“
Zunächst als einmaliges „Extra“ im KITZ.do-Angebot gedacht, war sich die Jury nach Sichtung der Filme einig. Dr. Beller: „Die Beiträge haben uns so beeindruckt, dass wir den MINT-Videowettbewerb „Picture your MINT!“ auch im nächsten Jahr wieder ausrufen möchten, vielleicht sogar ab jetzt jährlich.“
Die Gewinnervideos sind ab sofort auf dem KITZ.do-youtube-Kanal zu sehen, erreichbar über die Homepage kitzdo.de.
Als erste Preise gab es die individuell zusammengestellten KITZ.do-Experimente-Koffer mit professionellem Labor- und Experimentier-Equipment und einen Bausatz für den KITZ.do-Marsroboter.
Alle Teilnehmer*innen erhielten Mitmachpreise.
Die Preisträger der ersten Preise:
Familie Nierhoff mit Ilvie, Fiete und Lasse aus Mülheim für die Altersgruppe 6-14 Jahre mit den Filmen „Teebeutelrakete“ von Ilvie Nierhoff (6 Jahre), „Polarlichter“ von Fiete Nierhoff (11 Jahre) und „Ist Meerwasser-Eis salzig?“ von Lasse Nierhoff.
Jurybegründung: Neben der sehr kreativen und wissenschaftlich richtigen Darstellung in allen drei Beiträgen überzeugte die Jury das besondere Engagement der Familie Nierhoff. Deshalb bekommen die Teilnehmer*innen den ersten Preis als Sonderpreis für die ganze Familie.
Luisa J. (12 Jahre) und Lilly M. (Namen bekannt, Veröffentlichung nicht gewünscht) (12 Jahre) aus Herdecke für die Altersgruppe 11-14 Jahre mit dem Film „Immunabwehr“.
Jurybegründung: Neben der fundierten wissenschaftlichen Erklärung zur Immunabwehr haben Luisa und Lilly auf sehr sympathische und natürliche Weise unterhaltsam und nachvollziehbar die wissenschaftlichen Zusammenhänge dargestellt.
Hakon Wessling (17 Jahre) aus Essen für die Altersgruppe 15-21 Jahre mit dem Film „Chemilumeneszens“.
Jury-Begründung: Neben der herausragenden, fundierten wissenschaftlichen Erklärung zur Chemilumineszens hat Hakon Wessling die Inhalte mit großer Kreativität sehr überzeugend als Erklärvideo umgesetzt.
Bildzeile: Vorne: Fiete, Ilvie und Lasse Nierhoff, Lilly M., Luisa J., Hakon Wessling
Hinten: Dr. Ulrike Martin, Prof. Metin Tolan, Dr. Marcel Beller.
Foto: KITZ.do