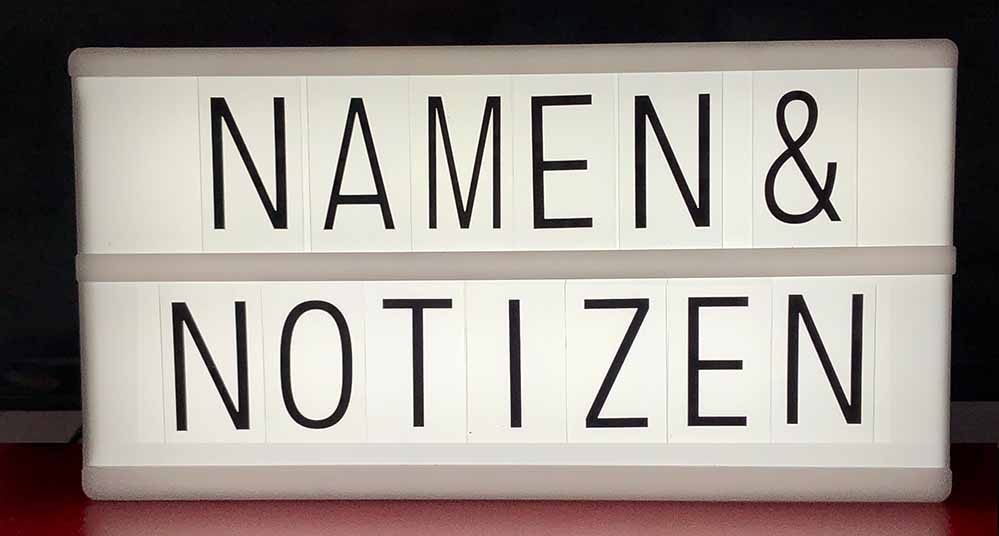 Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“
Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“
Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“.

Aufgesprühte Piktogramme auf dem Pflaster weisen in den Fußgängerzonen auf die Maskenpflicht hin
Zusätzlich zu den Schildern, die auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes hinweisen, gibt es bald nach und nach Piktogramme auf den Pflastersteinen in den Fußgängerzonen.
Die Symbole sind die gleichen, die schon von den Hinweisschildern und aus dem Netz bekannt sind. Sie werden mit Schablonen und Sprühfarbe auf das Pflaster aufgetragen. Den Auftrag aus dem Ordnungsamt setzen Tiefbauamt und Stadtteilwerkstatt seit heute gemeinsam um. Begonnen haben die Arbeiten am Vormittag am oberen Westenhellweg.
Wie bei der Beschilderung werden zunächst Westen-, Ostenhellweg und Brückstraße mit den Boden-Piktogrammen ausstattet. Danach geht es weiter mit Münsterstraße, Nordmarkt und Hörde (einschließlich PHOENIX See). Hombruch sowie die anderen Fußgängerzonen der Stadtteilnebenzentren folgen im Anschluss in den kommenden Tagen.
Die Farbe ist zwar regenfest, aber nicht von Dauer. Nach gut einem halben Jahr wird die Farbe fast komplett verblasst sein.
Bei dem weiterhin sehr dynamischen Infektionsgeschehen in Dortmund sollen Schilder und Boden-Piktogramme den Bürger*innen helfen, an die Maskenpflicht zu denken. Denn es ist wichtiger denn je, dass sich alle Dortmunder*innen daran halten.
Foto: Stadt Dortmund

Jugendliche stimmen online ab über neue Spiel- und Sportgeräte in Hörde
Das Amt für Stadterneuerung will die Fläche vor der Sporthalle an der Faßstraße ganz neu gestalten. Unter dem Titel „Stadteingang“ soll hier ein Bereich entstehen, der vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht ist. Der Autohändler wird demnächst mit seinem Betrieb an einen anderen Standort umziehen.
Das vom Grünflächenamt beauftragte Planungsbüro wbp Landschaftsarchitekten macht die Planung. Vorausgegangen war ein Wettbewerbsentwurf für den Schulhof des Phoenix-Gymnasiums und den Stadteingang. Der Schulhof ist bereits umgebaut worden. Jetzt folgt der Stadteingang, nachdem das Privatgrundstück des Autohandels angekauft wurde.
Das Planungsbüro macht Vorschläge, welche Geräte und Sitzmöbel in das neue, ummauerte Feld eingebaut werden könnten. Diese Spiel- und Bewegungsgeräte und die Sitzelemente zum Chillen stellt die Hörder Stadtteilagentur mit Beispielfotos online vor: https://beteiligung.hoerder-stadtteilagentur.de/stadteingang-hoerde/. Hier kann man direkt seinen Favoriten auswählen.
Die Online-Beteiligung läuft ab sofort und geht bis zum 30. November 2020. Das Ergebnis wird kurz danach bekannt gegeben. Das Planungsbüro fügt die ausgewählten Geräte und Sitzmöbel dann in den Entwurf ein. Dieser Plan wird ebenfalls online vorgestellt. In dieser zweiten Beteiligungsphase wird die Planung für den neuen Stadteingang parallel mit einem Flyer der Hörder Bevölkerung vorgestellt. An ca. 4.000 Haushalte in der Umgebung des Stadteinganges wird der Flyer verteilt. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu informieren und Anregungen zur Planung zu geben.
Kontakt für Anregungen ist die Hörder Stadtteilagentur:
E-Mail: info@hoerder-stadtteilagentur.de, facebook.com/HoerderStadtteilagentur, hoerde-zentrum.dortmund.de
Adresse: Alfred-Trappen-Straße 18, 44263 Dortmund
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr, Telefon: 0231 2220 2313.
Foto: Stadt Dortmund

Schutz vor Hochwasser
DONETZ verlegt 25 Meter Leitung in einem Stück
Ein ziemlich dickes Ding hatte die Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) Anfang November am Haken. Am Brüggenfeld in Scharnhorst überquert der Dortmunder Netzbetreiber mit einer Wasserversorgungsleitung mit 80 cm Durchmesser den Erlenbach. Bei einem Jahrhunderthochwasser wäre die Leitung aber in Gefahr, daher hat sich DONETZ entschlossen, die Leitung entsprechend höher zu führen. Hierzu wurde ein 25 m langer über 7 t schwerer so genannter Rohrdüker – ein Rohr mit entsprechenden Biegungen – in einem Stück neu eingesetzt. Nachdem das Unternehmen am Vortag das alte Teilstück ausgebaut hatte, wurde der neue Rohrdüker mittels eines 130 t Autokrans in Position gebracht und montiert. Da er vorab gebaut, isoliert und desinfiziert wurde, konnte die Leitung, mit der große Teile der nördlichen Stadtgebiete versorgt werden, bereits kurze Zeit später wieder in Betrieb genommen werden.
Foto: DONETZ

FDP-MdB Müller-Böhm, Junge Liberale und betroffene Bürger demonstrieren zu Corona-Maßnahmen
Unter dem Motto #Mondaysforliberty versammelten sich am Montagnachmittag etwa 80 Bürgerinnen und Bürger bei einer Demo auf Einladung der Jungen Liberalen (JuLis) vor dem Dortmunder Rathaus. Sie wandten sich gegen die pauschalen Schließungen ausgewählter Branchen im Rahmen des zweiten Lockdowns.
Der Vorsitzende der Dortmunder JuLis, Nils Mehrer, forderte von der Bundeskanzlerin ebenso wie von der Landesregierung, nicht nur mit Verordnungen zu regieren. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Roman Müller-Böhm machte ebenfalls deutlich, dass die Corona-Entscheidungen zurück in die Parlamente gehören. Der Oberhausener ist nicht nur der jüngste Abgeordnete der FDP-Bundestagsfraktion, sondern auch im Tourismusausschuss zuständig für besonders hart betroffene Branchen. Nadine Spiekermann, Mitglied des FDP-Kreisvorstandes und Mit-Initiatorin der Demonstration, betonte: “Wir müssen die Corona-Gefahr ernst nehmen, aber es müssen zielgerichtetere Maßnahmen ergriffen werden. Das würde auch mehr Akzeptanz schaffen.”
Der Redebeitrag von Patrick Arens, Vorsitzender des Schaustellervereins Rote Erde, machte besonders betroffen. Emotional schilderte er, dass einige seiner Kollegen am Ende ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind und sich dadurch psychische Probleme manifestieren. Er skizzierte den Zusammenbruch einer Branche mit 1,6 Millionen Beschäftigen, wenn es nicht bald wieder Möglichkeiten gibt, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Bildzeile: v.l. Ratsmitglied Antje Joest, Nadine Spiekermann, Roman Müller-Böhm, Nils Mehrer.
Foto: FDP Dortmund

Caritas sucht zu Weihnachten wieder gebrauchtes SpielzeugDie Weihnachtszeit ist nicht mehr weit. In den Caritas-Sozialläden soll auch in diesem Jahr gebrauchtes Kinderspielzeug angeboten werden, um die Gabentische der Kinder sozialschwächerer Familien in Dortmund etwas bunter zu machen. Gesucht wird zum Beispiel: Lego, Dupla, Playmobil, Spielzeugautos, Puppen, Puppenwagen, Kinderbücher, Holzspielzeug. Stofftiere können aus hygienischen Gründen nicht angenommen werden.Die Spenden können in der Caritas-Spendenannahmestelle abgegeben werden oder nach telefonischer Terminabsprache.Caritas-Spendenannahme, Minister-Stein-Allee 5, 44339 Dortmund-EvingMontags bis donnerstags 8 bis 16 Uhr, freitags 8 bis 15 UhrJeden ersten Samstag im Monat 9 bis 14 UhrTerminvereinbarung unter Tel.: 0231/981 299 921

Grünes Licht für Projekt „StromFahrer“ – 30 Elektro-Busse verstärken DSW21-Flotte bis Mitte 2022
DSW21 steigt in die Elektromobilität ein: Bis Mitte 2022 wird das Dortmunder Verkehrsunternehmen im Rahmen des Projekts „StromFahrer“ seine Flotte mit 30 elektrisch angetriebenen Bussen verstärken. Dafür hat der Aufsichtsrat nun grünes Licht erteilt und die Investition von rund 24 Mio. € freigegeben. Hinzu kommen Fördergelder in Höhe von voraussichtlich 17,8 Mio. € von Bund und Land.
„Unsere Busflotte zählt bereits heute zu den modernsten in ganz NRW. Mit den dreißig emissionsfreien Fahrzeugen wollen wir die Elektrobustechnologie in unserer Flotte etablieren und einen Beitrag zur Verminderung der Lärm- und Abgasimmissionen in Dortmund leisten“, sagt DSW21-Verkehrsvorstand Hubert Jung. Alle 172 Diesel- und Hybridbusse des Dortmunder Verkehrsbetriebs verfügen über eine grüne Plakette, fast alle erfüllen zudem die EURO VI-Norm. Der Ausstoß von Partikeln und Stickoxiden wurde in den zurückliegenden 20 Jahren bereits um rund 90 % reduziert. Durch das Projekt „StromFahrer“ werden die verbleibenden Stickoxid-Emissionen in 2022 nochmals um weitere ca. 40 % gesenkt – im Vergleich zur Anschaffung konventioneller Fahrzeuge.
ÖPNV ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems
Hubert Jung betont in diesem Zusammenhang noch einmal: „Grundsätzlich hat der ÖPNV nur einen ganz geringen Anteil am innerstädtischen Schadstoff-Ausstoß – insofern sind wir seit jeher Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.“ Das Projekt „StromFahrer“ ergänze in einer angemessenen Art und Weise die Maßnahmen der Stadt Dortmund zur Verringerung der Lärm- und Schadstoffbelastungen. Damit würden zugleich die Vorgaben des rechtsverbindlichen Vergleichs der Stadt Dortmund mit der Deutschen Umwelthilfe erfüllt.
Seit mehreren Jahren hat DSW21 die Entwicklungen der Bushersteller genauestens verfolgt und sieht nun den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in die Elektromobilität gekommen. „Unsere Fahrgäste vertrauen auf die Zuverlässigkeit unseres Fahrplans und erwarten einen stabilen Linienbetrieb. Daher mussten vor der Entscheidung für Elektrobusse die entsprechenden Rahmenbedingungen gegeben sein. Das ist nun der Fall“, sagt DSW21-Betriebsleiter Ralf Habbes und verweist auf serienreife Elektrobusse in ausreichender Stückzahl sowie verlässliche Standards und Kompatibilitäten bei Fahrzeugen und der Ladeinfrastruktur. Innerhalb der nächsten zehn bis zwölf Jahre könnte die gesamte DSW21-Busflotte elektrifiziert sein.
440, 470 und 437 werden zu Premieren-Linien
Ab spätestens Mitte 2022 werden die Fahrgäste der miteinander verknüpften Linien 470, 440 und 437 von E-Bussen durch die Stadt chauffiert. Die insgesamt rund 39 Kilometer lange, stark frequentierte Linien-Verknüpfung, die von Mengede bis nach Sölde führt, wurde ganz bewusst für den Premieren-Einsatz ausgewählt. Schließlich bietet sie ausreichende Möglichkeiten, die Auswirkungen der Elektromobilität im Hinblick auf Umwelt, Personal, Betrieb, Technik und Fahrgäste unter die Lupe zu nehmen. „Wegen der eingeschränkten Batterie-Reichweiten werden wir beispielsweise am Betriebshof in Brünninghausen eine Umsteigehaltestelle einrichten, an der die E-Busse getauscht werden. Natürlich interessiert uns auch, wie die Fahrgäste so etwas aufnehmen“, so Habbes.
Der DSW21-Betriebsleiter verweist in diesem Zusammenhang auch nochmal auf die umfangreichen Vorarbeiten, die vor Inbetriebnahme der ersten E-Busse notwendig sind: So müssen nicht nur eine acht Megawatt starke Stromleitung zum Betriebshof, sondern auch entsprechende Zuleitungen zu den einzelnen Stellplätzen, an denen die Aufladung der Busse mittels Pantograph erfolgt, gelegt werden. Auch die Installation von mindestens drei Trafostationen, die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen sowie die Installation eines Betriebshof-Managementsystems stünden auf der Agenda. Habbes: „Es wartet noch ein gutes Stück Arbeit auf uns, aber wir sind gut vorbereitet und haben ein ausgeklügeltes Konzept vorliegen.“
Bildzeile: DSW21- Verkehrsvorstand Hubert Jung.
Foto: DSW21/Christian Bohnenkamp

Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter hat bei Leonardo Hotels oberste Priorität
Offizielle Zertifizierung festigt Vertrauen in die Hygienemaßnahmen
Mit fundierten und erweiterten Maßnahmen zu Sauberkeit und Infektionsschutz in ihrem breit angelegten Hygienekonzept sorgen Leonardo Hotels für höchstmögliche Sicherheit in all ihren Häusern. Diese lässt sich die Hotel-gruppe mit Hauptsitz ihrer Divison Central Europe in Berlin nun offiziell mit dem Prüf-siegel „Clean&Safe Hotel SGS in Kooperation mit HRS“ zertifizieren, um das Vertrauen ihrer Hotelgäste zu festigen. Im Zuge der aktuellen Entwicklungen soll damit einer möglichen weiteren Verunsicherung von Geschäfts- und Freizeitreisenden klar entge-gengewirkt werden.
„Höchste Sauberkeits-, Sicherheits- und Hygienestandards sind das A und O bei Leonardo Hotels, und waren es auch schon vor Corona“, so Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels. „Un-sere verlässlichen Maßnahmen, die wir im Zuge der Corona-Pandemie erweitert haben, möchten wir offiziell validieren lassen, um das Vertrauen aller unserer Gäste zu festigen. Sie sollen wissen, dass wir beste Rahmenbedingungen in allen Bereichen der Hotels gewährleisten – gestützt durch unsere hygienebewussten Mitarbeiter und Infektionsschutzhelfer“.
Offizielles Prüfsiegel für Sauberkeit & Sicherheit
Das offiziell ausgestellte „Clean&Safe“-Prüfsiegel von der Société Générale de Surveillance SA (SGS), dem weltweit führenden Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen, in Kooperation mit HRS unterliegt verschiedenen Kriterien, die unter anderem die Abstandsregelungen, Gefährdungsanalysen sowie die Reinigungs- und Desinfektionsintervalle bis in die letzte Hotelecke unter die Lupe nehmen. Wie umfangreich diese Audits sind, zeigen die Fragenkataloge mit ausführli-chen Unterpunkten, die sowohl vor und während der Prüfung vor Ort im Hotel zum Zuge kommen und mit einer gründlichen objektiven Bewertung aller internen Abläufe und Prozesse enden. Aktuell laufen die Audits in vollem Gange. Als erstes Hotel mit dem Prüfsiegel wurde just das Leonardo Royal Mu-nich zertifiziert. Es ist eines der größten Tagungshotels der Hotelgruppe. Alle weiteren Zertifizierungen sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.
Hygienebewusstsein wird intern gestärkt
Durch den Einsatz von engagierten Hygienebeauftragten pro Hotel wird weiterhin sichergestellt, dass die Hygienemaßnahmen stets eingehalten und kontrolliert werden. Sie sind ebenso Ansprechpartner für Gäste, Kunden und Partner. Zudem unterstützt Leonardo Hotels die bundesweite Initiative Infektionsschutzhelfer für Hotel und Gastgewerbe und ruft die Mitarbeiter auf, die Online Ausbildung dafür zu absolvieren. Mit ihren Kollegen sorgen sie dafür, dass Abstandsregelungen für die Gäste, eine sinnvolle Personal- und Pausenplanung bis hin zu neuen Reinigungsplänen mit klar definierten Desinfektionszyklen eingehalten werden.
Bildzeile: Der Konferenzraum im Leonardo-Hotel Dortmund.
Foto: Leonardo Hotels Central Europe

SCHWANGER! ALKOHOL? DEIN KIND TRINKT MIT!
City-Light-Poster-Aktion des Gesundheitsamts macht auf Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft aufmerksam
Das Gesundheitsamt möchte mit einer Informationskampagne auf die oft unterschätzten Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft hinweisen. Ende Oktober machten 150 City-Light-Poster z.B. an Bushaltestellen auf die Gefahr aufmerksam, ab Anfang November sind es noch 73 Standorte.
Konsumiert eine schwangere Frau Alkohol, trinkt das ungeborene Kind mit. Mehr noch: Da das Kind im Mutterleib nur sehr begrenzt Abbauenzyme für Alkohol zur Verfügung hat, ist es dem Alkohol viel länger ausgesetzt als seine Mutter. Das Kind wird nicht nur in seiner Entwicklung gehemmt, sondern erfährt je nach Reifestadium und Alkoholmenge körperliche und kognitive Schädigungen.
Das Gesundheitsamt möchte mit einer Informationskampagne auf die oft unterschätzten Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft hinweisen. Ende Oktober machten 150 City-Light-Poster z.B. an Bushaltestellen auf die Gefahr aufmerksam, ab Anfang November sind es noch 73 Standorte. Ermöglicht wird die Kampagne durch eine Spende der Sparkasse Dortmund in Höhe von 20.000 Euro. Bereits im September 2019 hatte das Gesundheitsamt eine entsprechende Kampagne gestartet die nun aufgrund der positiven Resonanz wiederholt wird.
Fetale Alkoholspektrumstörungen
Schädigungen des Kindes, die durch den Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft entstehen, werden unter dem Begriff FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Fetale Alkoholspektrumstörungen) – erfasst. Sie sind die häufigste nicht erblich bedingte Ursache für kindliche Behinderungen. Dabei wären sie durch den Verzicht auf Alkohol in der Schwangerschaft zu 100 Prozent vermeidbar.
Schätzungen zufolge werden in Deutschland jährlich etwa 10.000 Kinder mit alkoholbedingten Schädigungen geboren. Etwa 4.000 von ihnen haben das Vollbild des Fetalen Alkoholsyndroms (FAS) und sind lebenslang körperlich und geistig behindert.
Das Spektrum der nicht heilbaren Folgeerscheinungen ist vielfältig: weitreichende Entwicklungsstörungen, körperliche Fehlbildungen, eingeschränkte Impulskotrolle, sozial unangemessenes Verhalten, Hyperaktivität, Merk- und Lernschwierigkeiten. Die betroffenen Kinder haben später große Probleme in der Bewältigung des Alltags.
Bildzeile: Präsentieren City-Light-Poster an der Rheinischen Straße / Nähe Westentor (v.li.): Gesundheitsdezernentin Birgit Zoerner, Uta Nagel (Gesundheitsamt) und Frank Mertin (Sparkasse Dortmund).
Foto: Torsten Tullius/Dortmund-Agentur

SPD Wickede dankt Friedhelm Sohn für 3 Jahrzehnte Arbeit für Wickede
Am 08.10.2020 endete für Friedhelm Sohn seine letzte Ratssitzung. Am 31.10.2020 endet damit eine Arbeit die er 1989 von Willi Spaenhoff, seinem Vorgänger als Ratsvertreter für Wickede, übernommen hat.
Willi Spaenhoff hatte diese Funktion von 1964 bis 1989 inne und nach 25 Jahren an Friedhelm Sohn übergeben, welcher von den Menschen in Wickede auch zum Ratsvertreter gewählt wurde. Die Fußabdrücke die Willi Spaenhoff hinterließ, schienen Anfangs übergroß, aber Friedhelm Sohn hat diese mit eigener Persönlichkeit und Präsenz in und für Wickede erfolgreich ausgefüllt. Friedhelm Sohn hat seine eigenen Schwerpunkte gewählt und damit eigene Pflöcke eingeschlagen, die nicht minder nachhaltig sind. Seine Schwerpunkte in der Kinder und Jugendarbeit haben für viele neue Kindergärten und Kindertagesstätten, die Sanierung von Schulgebäuden und den Erhalt von Jugendfreizeitstätten geführt. Seine herausragende Arbeit in diesem Bereich wurde ihm bei seiner Verabschiedung als Vorsitzender im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie über alle Parteigrenzen hinweg gedankt. Seine Mitgliedschaft in vielen Vereinen machte ihn zu
einem wichtigen Ratgeber und Türöffner für die Vereine. Er war und ist eine Stimme die Kraft seiner herausragenden Wickeder Verwurzelung in Dortmund stets gehört wurde.
Wickede wurde immer von Persönlichkeiten im Rat der Stadt Dortmund vertreten und dies ist bis heute im Ort erkennbar. Viele Maßnahmen in Wickede sind auf dieses Wirken zurückzuführen, wie z.B. der Bau von Siedlungen, Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Turnhallen, Sportplätzen, Gartenanlagen, öffentlichen Grünflächen, Kirchen, Straßen und Wegen. All dies sind Beispiele erfolgreicher Kommunalpolitik, die mit Persönlichkeiten verbunden sind, zu denen Friedhelm Sohn an vorderster Stelle gehört. Die Wickeder SPD dankt Friedhelm Sohn, der trotz damaliger schwerer Erkrankung nicht aufgegeben, den Kampf aufgenommen und letztendlich den Kampf auch gewonnen hat. 2011 wurde ihm auf der 110 Jahr Feier der Wickeder SPD der Ehrenbrief und die Willy-Brandt-Medaille durch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft übergeben. Die Wickeder SPD ist stolz durch Friedhelm Sohn repräsentiert worden zu sein.
Foto: Alex Völkel/Archiv

Train of Hope e.V. gewinnt Engagementpreis mit Carepaket-Projekt
Der Verein FES-Ehemalige e.V. hat am Freitag, 23. Oktober 2020, zum vierzehnten Mal den Engagementpreis an vier herausragende soziale Initiativen verliehen. Gesellschaftspolitisches Engagement ist in diesem Jahr besonders wichtig, die Preisverleihung fand erstmalig online statt. Unter den Gewinner/innen sind auch zwei Initiativen aus dem Ruhrgebiet.
Glückwünsche an die Preisträger/innen sendeten unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Ministerin a.D. Christina Kampmann, Comedienne Tahnee Schaffarczyk, Staatsminister Michael Roth, Generalsekretär Lars Klingbeil und Comedian Fabian Köster.
Insgesamt € 8.000 gewonnen haben folgende vier Inititativen: das Integrationsprojekt nouranour aus Witten, das Demokratieprojekt youmocracy, die Corona-Care-Pakete des Train of Hope aus Dortmund und das neue Klimaschutzprojekt GemeinschafftNatur.
Das vollständige Video der Preisverleihung ist abrufbar unter: https://youtu.be/JqBWbQRPxUg
Drei Gewinner/innen-Projekte wurden von einer unabhängigen Jury mit Akteurinnen und Akteuren aus Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft ausgewählt. Ein weiterer Preis wurde per Online-Abstimmung ermittelt.
Zitate der Preisträgerinnen und Preisträger
Integrationsprojekt nouranour. Lernwerkstatt und Bildungsort für Frauen verschiedener Kulturen (Signal of Solidarity e.V.):
„Unser Einsatz für Solidarität, zivilgesellschaftliches Engagement und eine offene und plurale Gesellschaft, in der jede*r gleichberechtigt teilhaben kann, geht weiter und mit diesem Preis hoffentlich umso schneller voran.“
Youmocracy e.V. Demokratie braucht dich:
„Die finanzielle Unterstützung, das Netzwerk der FES und die öffentliche Aufmerksamkeit sind genau die richtigen Impulse, um youmocracy jetzt deutschlandweit voranzubringen. Für diese wertvolle Förderung sind wir unglaublich dankbar.“
Corona-Care-Pakete (Train of Hope e.V.):
„Ein Gewinn für ein friedliches Miteinander: ‚Hoffnung entsteht Miteinander‘ ist für uns im Train of Hope Dortmund e.V. nicht nur ein Motto, sondern unsere Vision von einem gemeinschaftlichen Leben. Genau deswegen war das Unterstützen unserer Mitmenschen in diesen herausfordernden Zeiten von höchster Priorität. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir den diesjährigen Engagementpreis gewonnen haben. Dies ermöglicht uns, weiterhin Hilfeleistungen anzubieten, das Ehrenamt weiterhin aufrechtzuerhalten und ein konstanter Ansprechpartner für unsere Communities und für die Gesellschaft sein zu können. Ein herzliches Dankeschön von der gesamten Train of Hope-Familie an FES-Ehemalige e.V. für diese Anerkennung und auf eine hoffnungsvolle Zusammenarbeit.“
GemeinSchafftNatur – Klimaschutz inklusiv gestalten!
„Herzlichen Dank für das Vertrauen, dass Sie uns mit dem Engagementpreis entgegenbringen! Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement für einen inklusiven, innerstädtischen Klimaschutz gewürdigt wird. Gemeinsam können wir nun die Idee einer sozialgerechten und grünen Stadt voranbringen.“
Die vier Initiativen erhalten jeweils ein Preisgeld von € 2.000 sowie ideelle Unterstützung.
Der Engagementpreis wird seit 2007 von den Mitgliedern des FESEhemalige e.V. gestiftet und jährlich an herausragende soziale Initiativen und Projekte verliehen. Zu den Auswahlkriterien zählt, wie brisant das Thema der jeweiligen Initiative ist und wie nachhaltig und vielversprechend das Projekt umgesetzt wird.
FES-Ehemalige e.V. ist ein Netzwerk der ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Seit 2004 verbindet der Verein auf Bundesebene und weltweit Ehemalige aller Generationen.
Foto: Train of Hope e.V.
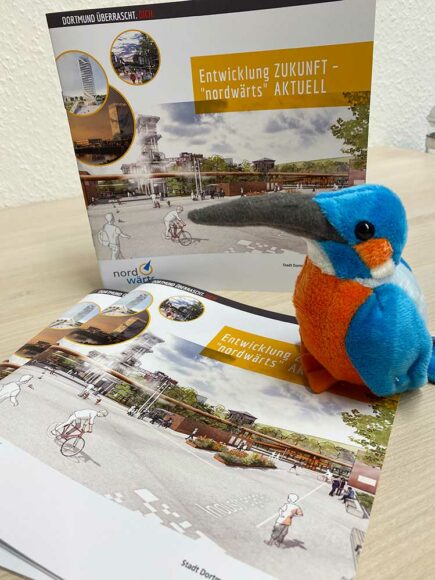
„ZukunftsOrte“ entdecken: Große Entwicklungspotenziale Dortmunds liegen „nordwärts“
Das nördliche Dortmund zeigt bereits überraschend hochkarätige Potenziale für die Zukunft der Stadt. Hier finden derzeit – teils noch unbemerkt – großflächige Entwicklungen statt. Zur Projekthalbzeit hat das Beteiligungsprojekt „nordwärts“ mit der Broschüre ´Entwicklung Zukunft –“nordwärts“ aktuell` die markantesten und die Zukunft der Stadt prägenden Projekte als „ZukunftsOrte“ des nördlichen Stadtgebietes zusammengestellt. Die Entwicklungspotenziale zeichnen sich durch zukunftsträchtige Impulse und konzeptionelle Innovationen aus: So entstehen Auenlandschaften, innovative Mobilitätslösungen, Areale gemeinschaftlichen Nutzens, Wohnungen und Arbeitsplätze, Bildungsorte und viel Lebensqualität.
Mail-Anhang.gif
In den Projektentwicklungen, „erhalten die Dortmunder*innen zukünftig Gelegenheit, sich aktiv zu beteiligen“, motivieren gleich zu Beginn der Broschüre Oberbürgermeister Ullrich Sierau, die Projektleiterin von „nordwärts“, Michaela Bonan und der Vorstandsvorsitzende des „nordwärts“-Kuratoriums, Ubbo de Boer die Stadtgesellschaft zur Mitwirkung an der Stadt von morgen.
Zu erfahren ist Interessantes über die zukunftsweisende Herangehensweise der Treiber*innen und Macher*innen der geplanten Großprojekte. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind die angestrebten Werte der konsequenten und ganzheitlichen Entwicklung der ZukunftsOrte. Auch zeigen die Bauprojekte von Stadtgesellschaft und Wirtschaft, wie durch das Miteinander, gemeinschaftliche Anstrengungen sowie Kooperationen gewinnbringend zusammengearbeitet wird. Mit diesen u.a. vom Projekt „nordwärts“ geförderten Ansätzen, zeichnet sich ein Struktur- bzw. Kulturwandel im nördlichen Dortmund bereits heute deutlich ab. Gut erkennen lässt sich dies auf einen Blick anhand der Übersichtskarte „Hier entwickelt der Norden Zukunft!“.
Vorgestellt werden:
Hafen/Speicherstraße
Ehemaliges Hoesch-Spundwand (HSP)-Areal /SMART RHINO
Hauptbahnhof Nord
Borsigplatzquartier
EnergiePlusHäuser/Brechtener Heide
Bürgerhaus Pulsschlag/Zeche Dorstfeld
Internationale Gartenausstellung IGA 2027/Emscher nordwärts
Nördliche Gewässer
Ehemaliges Areal des Kraftwerkes Knepper
Smart City Dortmund
Energiecampus
Ehemaliges Areal der Westfalenhütte
Die mit QR-Codes ausgestatteten Beiträge zu den jeweiligen ZukunftsOrten führen zu digitalen Flügen über die Areale im 3D-Stadtmodell, zu YouTube-Videos, spannende Links und weiterführende Informationen. Bspw. ist ein Überflug über die Westfalenhütte oder die Vision des Zukunftscampus SMART RHINO aus der Drohnenperspektive zu bestaunen. Auch computeranimierte Visualisierungen, wie z.B. Entwürfe zum Borsigplatzquartier machen Veränderungen und Planungen transparent und damit leichter nachvollziehbar und regen die eigene Wahrnehmung und Vorstellungskraft zu den jeweiligen „ZukunftsOrten“ an.
Unter https://dortmund-nordwaerts.de/aktionsjahr-2020-2021/formate-mit-abstand/entwicklungspotenziale/ gibt es die Broschüre natürlich auch als PDF-Dokument.
Foto: Stadt Dortmund

RuhrKunstMuseen wählen neue Netzwerk-Sprecher*innen
Das Museumsnetzwerk der RuhrKunstMuseen (RKM) hat turnusgemäß zwei neue Sprecher*innen gewählt. Peter Gorschlüter und Regina Selter sind für die kommenden drei Jahre die „Sprachrohre“ des Netzwerks der 21 Kunstmuseen der Region.
Die RuhrKunstMuseen – mittlerweile 21 an der Zahl – präsentieren jährlich rund 130 Kunstausstellungen auf einer Fläche von 45.000 Quadratmetern in 16 Städten des Ruhrgebiets. Die facettenreiche Museumslandschaft der Metropole Ruhr sichtbar und kunstinteressierte Bewohner*innen auf das geballte Kulturgeschehen der Region aufmerksam zu machen sowie Kulturinteressierte in die Region zu locken – das sind die Aufgaben, denen sich das Netzwerk mit vereinten Kräften widmet.
Auf der Plenumssitzung des Netzwerks am 28. Oktober 2020 im Kunstmuseum Bochum wurden Peter Gorschlüter, Direktor des Museum Folkwang in Essen, und Regina Selter, stellvertretende Direktorin und Leitung des Teams des Museum Ostwall im Dortmunder U, durch die Vertreter*innen der 21 RuhrKunstMuseen gewählt.
Das neue Sprecher*innen-Team übernimmt nun die Aufgaben von Leane Schäfer, Direktorin des Kunstmuseum Gelsenkirchen, und Dr. Hans Günter Golinski, Direktor des Kunstmuseum Bochum, die in ihrer bisherigen Funktion als Sprecher*innen äußerst engagiert und erfolgreich die Geschicke der RuhrKunstMuseen geleitet haben.
„Mittlerweile werden die RuhrKunstMuseen nicht mehr ‚nur‘ als Netzwerkgemeinschaft, sondern als kulturpolitische Kraft verstanden“, resümiert Dr. Hans Günter Golinski die bereits mehr als zehnjährige Netzwerkarbeit im und für den Kulturstandort Metropole Ruhr. Darüber hinaus freut sich Leane Schäfer, „den Staffelstab an würdige Nachfolger weitergeben zu können.“
Peter Gorschlüter ist seit Juli 2018 Direktor des Museum Folkwang und war zuvor u.a. stellvertretender Direktor des MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Regina Selter ist seit März 2006 für das Museum Ostwall im Dortmunder U tätig und seit 2011 stellvertretende Direktorin des Museums. Zudem leitet sie gemeinsam mit Peter Daners vom Museum Folkwang erfolgreich die AG Künstlerische Bildung undVermittlung des Netzwerkes und ist verantwortlich für das neue Projekt „RuhrKunstUrban“, das die 21 RuhrKunstMuseen, Schulen und weitere Orte im städtischen Umfeld verbindet.
„Das Besondere am Netzwerk der RuhrKunstMuseen ist nicht nur die nachhaltige Struktur, sondern darüber hinaus die effektive Nutzung der Schnittstellen der Häuser, die auch in Zukunft die Vernetzung zwischen unterschiedlichen öffentlichen und privaten Kulturschaffenden und Kulturträgern in der Region sicherstellt“, so Regina Selter.
Peter Gorschlüter ergänzt: „Die Zusammenarbeit der RuhrKunstMuseen ist eine große Bereicherung für die Kulturlandschaft und die Menschen in der Region. Durch den Zusammenschluss der 21 Museen wurden und werden auch in Zukunft neue Impulse für den Kunst- und Kulturbereich ausgehen, in den Bereichen der Bildung, Forschung und Digitalisierung, aber auch in gemeinsam entwickelten Angeboten für ein breites Publikum.“
Bildzeile: Vorgänger*innen und Nachfolger*innen – von links: Peter Gorschlüter, Leane Schäfer, Regina Selter, Dr. Hans Günter Golinski.
Foto: Alessandra Carpentiere

erg Haustechnik in Brackel feiert
25-jähriges Geschäftsjubiläum
Obermeister der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gratuliert Fachbetrieb zum silbernen Jubiläum / Andreas Berg gründete 1995 erfolgreiches Handwerksunternehmen
Hohen Besuch von der Innung für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen bekam jetzt die Firma Andreas Berg Haustechnik Am Westheck in Dortmund-Brackel. Obermeister Ralf Marx ließ es sich nicht nehmen, Geschäftsinhaber Andreas Berg persönlich zum 25-jährigen Bestehen seines Unternehmens zu gratulieren. „Ein Vierteljahrhundert erfolgreiches Arbeiten im Handwerk sind der Beweis für großes Können und hohe Qualität“, so Ralf Marx bei der Übergabe der Ehrenurkunde der Innung. „Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Namen der gesamten Innung auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.“
Als junger Meister angefangen
Der heute 59-jährige Betriebsinhaber Andreas Berg hatte in den 1980er-Jahren seine Lehre im Sanitärhandwerk abgeschlossen und nach mehreren erfolgreichen Gesellenjahren selbst den Weg zum Meister eingeschlagen. 1994 legte er in Dortmund seine Prüfung zum Meister im Gas- und Wasserinstallateurhandwerk vor der Handwerkskammer ab. Ein Jahr später, im November 1995, gründete er dann sein eigenes Unternehmen. „Ich habe den Betrieb damals als Einzelkämpfer quasi aus der Garage heraus aufgebaut“, erinnert er sich. „Im zweiten Jahr kam dann mein Bruder als Monteur zur Verstärkung hinzu, der bis heute im Betrieb beschäftigt ist.“ Mit der Zeit wuchs das Unternehmen auf heute sechs Mitarbeiter. Auch Auszubildende hat Andreas Berg regelmäßig eingestellt, um den beruflichen Nachwuchs in seinem Gewerk zu sichern. Über die Jahre änderte sich auch der Arbeitsschwerpunkt des Handwerksbetriebes. Während er am Anfang eher auf Bäder spezialisiert war, sind es heute vor allem Heizungsanlagen, die Andreas Berg und seine Mitarbeiter für die überwiegend privaten Kunden installieren, reparieren und warten. „Im Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre haben wir einen rasanten Wandel erlebt, der die Arbeitsweisen und Arbeitsmaterialien in unserem Handwerk bestimmt“, resümiert Berg. „Aber durch regelmäßige Weiterbildungen haben meine Mitarbeiter und ich das über all die Jahre gut gemeistert. Und auch einige Stammkunden sind uns seit 25 Jahren treu geblieben.“
Bildzeile: Herzliche Gratulation zum Jubiläum: (v. l.) Obermeister Ralf Marx von der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Betriebsinhaber Andreas Berg.
Foto: Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen

OB Sierau übergibt neues Leichtathletik- und Fußballstadion an den BV Teutonia Lanstrop 1920 e.V.
Der Zeitpunkt passt genau: Ende Oktober hat Oberbürgermeister Ullrich Sierau das neue Leichtathletik- und Fußballstadion an der Büttnerstraße an den BV Teutonia Lanstrop 1920 e.V übergeben – pünktlich zum 100. Geburtstag dieses Traditionsvereins im Dortmunder Nordosten.
Herausragende Infrastruktur
Mit der Anlage an der Büttnerstraße verfügt die Stadt Dortmund neben dem Stadion Rote Erde als Bundesleistungszentrum, dem neuen Stadion in Hacheney und vielen Stadien mit neuen leichtathletischen Nebenanlagen über eine herausragende Infrastruktur für seine Vereine und den Schulsport.
„Wir investieren kontinuierlich in den Breiten- und Spitzensport Dortmunds. Die Eröffnung dieser neuen Anlage ist dafür ein weiteres Beispiel“, so Oberbürgermeister Ullrich Sierau, für den die Eröffnung in Lanstrop sein letzter offizieller Termin als Oberbürgermeister war. „Dass es jetzt im Zeichen der Corona-Pandemie zum 100jährigen Vereinsjubiläum kein tolles Sportfest geben kann, ist nicht zu ändern. Aber wir hoffen, dass dieses Ereignis im nächsten Jahr nachgeholt werden kann.“
Unermüdlicher Einsatz
Wenn man die Entstehungsgeschichte der neuen Sportanlage reflektieren will, lässt sich mit einem Zitat von Martin Luther beginnen: „Jedermann schneidet gern die Bretter da, wo sie am dünnsten sind.“ Mit seinem ersten Vorsitzenden Gerhard Niemeyer hat der Verein jemanden an der Spitze, der auch bereit war, die ganz dicken Bretter zu bohren. Seinem unermüdlichen Einsatz und dem Einsatz seiner Mitstreiter ist es zu verdanken, dass heute den erfolgreichen Leichtathleten in Lanstrop eine neue schmucke Trainings- und Wettkampfstätte und den Fußballern des Vereins ein neuer Kunstrasenplatz übergeben werden konnte.
Seit sich Ende 2016 zum ersten Mal die Perspektive der Aufgabe der bestehenden und in Eigenregie des Vereins erstellten Trainingsanlage neben der Brukterer-Grundschule im Tausch gegen einen Neubau auf dem maroden Ascheplatz bot, hat Gerhard Niemeyer dieses Projekt voran getrieben – und am Ende Politik und Verwaltung von der Sinnhaftigkeit eines neuen Leichtathletikstützpunktes im Dortmunder Norden überzeugen können.
Vom Grünflächenamt geplant
Die vom Grünflächenamt der Stadt Dortmund geplante und mit einem externen Auftragnehmer umgesetzte Maßnahme umfasst neben dem Umbau des Tennenplatzes als Kunstrasen mit Sand-Kork-Füllung, den Neubau einer modernen Rundlaufbahn, zwei Weitsprunggruben, Anlagen für Hoch- und Stabhochsprung, Sprintbahnen und eine Kugelstoßanlage. Dazu kommen eine neue technische Ausstattung mit Flutlicht, eine Zeitmessanlage, ein Sprecherhäuschen und eine überdachte Sitzstufenanlage.
An den Gesamtkosten von rund 1,6 Millionen Euro beteiligt sich der Verein durch die Aufgabe der bisherigen Trainingsanlage, die damit grundsätzlich auch für höherwertige bauliche Nutzungen zur Verfügung steht, sowie mit weiteren Eigenmitteln- und Eigenleistungen in Höhe eines größeren fünfstelligen Betrages.
Bildzeile: v.l. Ullrich Sierau, Gerhard Niemeyer, Heinz Pasterny.
Foto: Stadt Dortmund

Fast 3.400 neue Studierende an der FH Dortmund
Erstsemesterbegrüßung digital im Livestream und Chatroom
Knapp 3.400 neue Studierendende hieß Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick Ende Oktober an der Fachhochschule Dortmund willkommen. Erstmals fand die Erstsemesterbegrüßung rein digital statt. Insgesamt sind an der FH Dortmund fast 15.000 Studierende eingeschrieben.
„Die Zeit ist eine besondere“, betonte Prof. Dr. Wilhelm Schwick in seiner Live-Ansprache, die mehr als 2.600 Nutzer*innen auf den verschiedenen Kanälen vor den heimischen Bildschirm oder unterwegs am Smartphone verfolgten. Die Pandemie stelle die Gesellschaft vor eine große Herausforderung. Mit einem umfassenden Hygienekonzept könne die FH Dortmund den Studierenden aber dennoch „in jedem Fachbereich eine Kombination aus digitaler Lehre und zugleich wichtigen Präsenzveranstaltungen gerade für Erstsemester anbieten“, sagte der Rektor. „Verlassen Sie sich drauf, dass die Fachhochschule und die Fachbereiche Sie adäquat ausbilden und auf das Berufsleben vorbereiten werden.“
Wenige Tage vor der Amtsübergabe warb Dortmunds noch amtierender Oberbürgermeister Ullrich Sierau für den Wissenschaftsstandort Dortmund mit „hervorragenden Jobaussichten“ für die künftigen Absolvent*innen. „Sie haben sich entschieden, hier an der Fachhochschule zu studieren, und ich kann Ihnen sagen: Das ist genau die richtige Entscheidung“, sagte Sierau. Er forderte die Erstsemester zugleich auf, sich aktiv in die Stadtgesellschaft einzubringen.
Für die neuen Studierenden im Studienjahr 2020 stand zunächst aber die Orientierung im Fokus. Nach 45 Minuten Live-Show mit unterhaltsamer Moderation von Poetry Slammer Rainer Holl ging es für die Erstsemester virtuell in den Fachbereichen weiter. Studierende beantworteten in Video-Chats Fragen zu Stundenplänen und Vorlesungen. Im interaktiven Online-Escape-Room konnten die Erstsemester gemeinsam und zugleich auf Distanz spielerisch die FH Dortmund erleben.
Bildzeile: Erstsemesterbegrüßung digital: Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick wandte sich per Livestream an die neuen Studierenden an der FH Dortmund.
Foto: FH Dortmund / Benjamin Gottstein

Vereinbarung unterzeichnet: Neue Planungssicherheit für die Jugendarbeit
Oberbürgermeister Ullrich Sierau und Jugenddezernentin Daniela Schneckenburger sowie Mitglieder der Vorstände des Jugendringes Dortmund und der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der offenen Jugendarbeit in Dortmund (AGOT) haben Ende Oktober die Vereinbarungen zur Förderung der Träger für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren unterzeichnet
Das seit den 1990er Jahren mit allen Beteiligten gemeinsam entwickelte Fördersystem war das bundesweit erste seiner Art und hat sich seitdem zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Träger der Jugendverbandsarbeit und offenen Kinder- und Jugendarbeit erhalten durch die Vereinbarungen abermals eine langfristige Planungssicherheit. Die inhaltlichen Ziele und Angebote in den Arbeitsfeldern sind einvernehmlich zwischen der Stadt Dortmund als dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe und den freien Trägern abgestimmt.
Die Gesamtfördersumme beträgt rund 1,9 Mio. Euro jährlich. Davon erhalten der Jugendring Dortmund mit den angeschlossenen Jugendverbänden rund 878.000 Euro und die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der offenen Jugendarbeit rund 1,1 Mio. Euro. Auf diese Fördersummen verständigten sich die Vertragspartner einvernehmlich.
Die Förderung des Jugendringes Dortmund und der anerkannten Dortmunder Jugendverbände wird bereits seit 1994, die der AGOT seit 1999 in Fünfjahresverträgen geregelt. Für den Jugendring Dortmund und die Mitgliedsverbände stellen diese kontinuierlichen Vereinbarungen Planungssicherheit für ihre Arbeit her. Dies bedeutet eine große Unterstützung in der Durchführung von Angeboten und Projekten in der Jugendverbandsarbeit. Der Jugendring Dortmund wird dadurch zu einem verlässlichen Partner für Kinder und Jugendliche.
Im Jugendring Dortmund und den Dortmunder Jugendverbänden machen Kinder und Jugendliche an vielen Stellen Erfahrungen mit praktischer und gelebter Demokratie. In Beteiligungsprojekten erfahren sie, dass ihr Wort zählt und dass aus Ideen und Beschlüssen Wirklichkeit werden kann.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erinnerungsarbeit, in deren Rahmen sich viele junge Menschen für Menschenrechte und gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus engagieren.
Die Einrichtungen der Mitglieder der AGOT sind an mehr als 400 Stunden in der Woche geöffnet, abends und an den Wochenenden. Somit werden professionell begleitete Freizeitangebote direkt vor Ort in den Stadtbezirken ermöglicht. Die pädagogischen Angebote der Mitglieder der AGOT stellen darüber hinaus die Beteiligung junger Menschen, die Partizipation, die Prävention, Integration und Emanzipation sowie die Gleichstellung von Jungen und Mädchen in den Fokus.
Bildzeile: v.l. Ralf von Gratowski (Kassierer Jugendring), Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Reiner Spangenberg (stellv. Vorsitzender Jugendring), Regina Kaiser (Beisitzerin Jugendring), Daniela Schneckenburger (Dezernentin für Schule, Jugend und Familie), Uwe Ihlau (Geschäftsführer Jugendring).
Foto: Roland Gorecki/Dortmund Agentur

Flüchtlingskindern Raum für gesunde, kindgerechte Entwicklung geben
Projekt „Eltern stärken – international“ erhält schul.inn.do-award 2020
Der schul.inn.do-award 2020 geht in diesem Jahr an das Projekt „Eltern stärken – international“ des Diakonischen Werks Dortmund und Lünen gGmbH. „Wir zeichnen ‚Eltern stärken – international‘ insbesondere für die nachhaltige und respektvolle Unterstützung von Flüchtlingsfamilien aus. Mittels interkulturellen Dialogs und Austausches rund um das Thema Erziehung stärken die Projekt-Mitarbeiter die Eltern in ihrer Rolle und ermöglichen den Kindern damit ihren Schulalltag und ihre Freizeit unbeschwert erleben zu können“, begründet Martina Blank, Vorstandsvorsitzende des schul.inn.do e.V., die Preisvergabe. Der Award ist mit 1.500 Euro dotiert.
Circa ein Drittel der geflüchteten Menschen in Deutschland sind Kinder. Sie erleben hier auf der einen Seite Schutz vor Krieg und Vertreibung. Auf der anderen Seite ist ihr Alltag von großer Unsicherheit geprägt. Kinder sind oft besonders von den Folgen schwieriger Fluchterfahrungen betroffen, beispielsweise in Form von Traumatisierungen der Familie. Viele Eltern nehmen zwar ihre Rolle der Erziehung wahr, sind mit den Anforderungen des neuen Kulturkreises aber nicht vertraut. Mangelnde Sprachkenntnisse verstärken die Unsicherheit. Des Weiteren leiden sie selbst oft unter gesundheitlichen Folgen ihrer Erlebnisse, sodass ihre Kapazitäten zur Förderung der Kinder eingeschränkt sind.
„Durch den Besuch von Kindergärten und Schulen werden Kinder wesentlich schneller in die lokale Gesellschaft integriert als ihre Eltern. So können sie schneller Kontakte zu Menschen und der örtlichen Kultur knüpfen sowie eine neue Sprache lernen. Das hat zur Folge, dass die Mädchen und Jungen in ihren Familien wichtige Aufgaben, wie Übersetzungstätigkeiten und die Begleitung zu Ämtern übernehmen müssen“, berichtet Martina Herold, Projektkoordinatorin der Stabsstelle Migration und Integration des Diakonischen Werks. „Diese Aufgaben gehen mit viel Verantwortung einher. Oft übersteigt das Maß der Anforderungen ein für Kinder leistbares Pensum. Raum für eine gesunde, kindgerechte Entwicklung bleibt wenig.“
Konkrete Umsetzung
Pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von „Eltern stärken – international“, das seinen Sitz im von der Diakonie betriebenen Nachbarschaftstreff „NebenAn“ in Westerfilde hat, nehmen über verschiedene Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten Kontakt zu den Familien auf. Sie sprechen verschiedene Sprachen und stammen häufig selbst aus den Ländern der Geflüchteten. Zunächst gilt es, Hilfe beim Ausfüllen und Übersetzen von Briefen der Schule, verschiedener Ämter oder Vermietenden zu leisten. Im gegebenen Einzelfall wird über Unterstützungsangebote informiert bzw. über konkrete Lösungsansätze gesprochen. Schrittweise wird Vertrauen aufgebaut. Dadurch werden Voraussetzungen geschaffen, sich persönlichen Themen rund um Problematiken und Ressourcen der Erziehung nähern zu können.
In anschließenden wöchentlichen Treffen sprechen die Pädagoginnen und Pädagogen mit den Familien über Erziehung, Ernährung, Bewegung, kindgerechte Beschäftigungen, Umgang mit Medien und vieles mehr. Es werden Ideen für geeignete Eltern-Kind-Aktionen gesammelt und auch immer wieder gemeinsame Ausflüge in die nahe Umgebung unternommen. „Damit soll die Möglichkeit eines Austauschs untereinander und mit den Pädagoginnen geschaffen werden, in dem die geflüchteten Menschen von ihren Gefühlen und von ihrer Grundhaltung erzählen können, ohne Bewertung und Bevormundung. Durch das Ankommen in der eigenen Gefühlswelt und anschließender Reflexion bekommen die Eltern die Möglichkeit sich selbst und auch ihre Kinder besser zu verstehen“, so Herold.
Im Verein schul.inn.do e.V. engagieren sich seit 2001 Vertreter aus Bildungseinrichtungen und Unternehmen für eine zukunftsorientierte Bildung und den Aufbau regionaler Bildungsnetzwerke in Dortmund. Zu den selbst gewählten Aufgaben zählt die Unterstützung innovativer Schulprojekte in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Schule.
www.schulinndo.de
Das Projekt „Eltern stärken – international“ wurde mit dem schul.inn.do-award 2020 ausgezeichnet. Darüber freuen sich v.l.n.r.: Martina Herold, Projektkoordinatorin der Stabsstelle Migration und Integration des Diakonischen Werks Dortmund und Lünen gGmbH, Martina Blank, Vorsitzende schul.inn.do e.V., Stefanie Gerszewski, stellv. Vorsitzende schul.inn.do e.V., Sabine Hirsch, Projektteam „Eltern stärken – international“, Saadiye Mola- Khalil, Projektteam „Eltern stärken – international“, sowie Manfred Hagedorn, Geschäftsführer schul.inn.do e.V.
Foto: Stephan Schütze

OB Ullrich Sierau: „Neuer Landschaftsplan unterstützt massiv das Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung“
Der neue Landschaftsplan Dortmund ist nun rechtskräftig. Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat heute die Bekanntmachung des Plans, der während seiner Amtszeit erstellt wurde, unterschrieben.
Den für den gesamten baulichen Außenbereich geltenden Plan hatte der Rat der Stadt am 18.06.2020 als Satzung beschlossen. Nach der ohne Beanstandungen erfolgten Prüfung durch die Höhere Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung in Arnsberg löst der neue Landschaftsplan damit die drei bis dato gültigen Landschaftspläne Dortmund-Nord, -Mitte und -Süd nach nunmehr 30 bzw. 20 Jahren Laufzeit ab. Er weist über 1000 Hektar mehr an Naturschutzgebieten aus als seine Vorgänger. Sie haben jetzt einen Anteil von 10,56 Prozent am gesamten Stadtgebiet.
Seit 2013 wurde kontinuierlich an der Neuaufstellung des Landschaftsplanes gearbeitet. Die Neuaufstellung des Landschaftsplans Dortmund wurde mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zu 80 Prozent der entstandenen Planungskosten finanziell gefördert. Der Fachplan fußt auf einer Vielzahl europäischer, bundes- und landesrechtlicher Gesetze und Vorgaben. Unter aktivem Einbezug und unter sehr reger Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Behörden und Trägern öffentlicher Belange ist ein umfassendes Planwerk entstanden.
Für die Förderung der biologischen Vielfalt und zum Schutz seltener und sensibler Tier- und Pflanzenarten finden sich im Landschaftsplan verschiedene Maßnahmen: Die Anlage, Pflege und Wiederherstellung von Feuchtbiotopen, Streuobstwiesen, Brachen und Grünlandflächen sowie die Pflanzung von Baumreihen und Hecken.
„Das Hauptaugenmerk des Landschaftsplan liegt auf dem Erhalt des Ökosystems als Lebensgrundlage für Mensch und Fauna“, so Oberbürgermeister Ullrich Sierau. „Die festgesetzten Maßnahmen dienen einerseits dem Erhalt und der Förderung der Tier- und Pflanzenwelt, gleichzeitig dem Klimaschutz. Der Landschaftsplan unterstützt damit zudem maßgeblich das Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung.“
Grundlegend für die Wirksamkeit des Landschaftsplanes ist nicht nur sein Maßnahmenkatalog, sondern auch die Beachtung der festgesetzten Ge- und Verbote. Hierbei ist jede*r Einzelne wichtig und dazu aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten.
Die Hundeanleinpflicht ist nun für alle Dortmunder Naturschutzgebiete und geschützten Landschaftsbestandteile klar geregelt. Grundsätzlich gilt: Mit dem Hund zusammen auf den Wegen bleiben („Wegegebot“). Außerhalb des Waldes sind Hunde in Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen immer an der Leine zu führen. Im Wald – auch wenn dieser als Naturschutzgebiet oder geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen ist – besteht die Anleinpflicht nicht, wohl aber das Wegegebot zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen.
In den Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen sollen an Rändern von Gewässern und Wegen krautreiche Säume entwickelt werden. Auf Grünlandflächen gibt es Einschränkungen in Bezug auf die Düngung und ein Pestizidverbot auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Das kommt vor allem der Tier- und Pflanzenwelt zugute. Durch die extensive Nutzung werden krautige Pflanzen gefördert, von denen sich verschiedene Insekten ernähren, die wiederum Nahrungsquelle der Vögel unserer Feldflur und des Waldes sind.
Eine ökologisch orientierte Waldpflege soll den Altholzanteil erhöhen, die Naturverjüngung und den Struktur- und Artenreichtum der Wälder fördern. Nicht nur Specht und Fledermaus finden hier ihre Heimat, auch viele verschiedene Moose, Flechten sowie Pilze.
Durch die Schutzgebietsausweisungen und die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes wird ein Flächennetzwerk geschaffen, welches verschiedene Lebensräume miteinander verbindet und einen sogenannten Biotopverbund bildet. Die Flächen erfüllen verschiedenartige Lebensraumfunktionen als Teil- oder Ganzjahreslebensraum wie Ansitz- und Nistplatz, Nahrungsraum, Deckungsmöglichkeit vor Witterung und Feinden sowie als Überwinterungsquartier.
Ziel des Biotopverbundes ist es, Flächen und Populationen von Tier- und Pflanzenarten miteinander zu vernetzen, um einer genetischen Verarmung und Isolation von Populationen entgegenzuwirken. Dafür macht sich Dortmund als Gründungsmitglied der „Kommunen für biologische Vielfalt“ stark.
Um an Gewässern die Störung für die regelmäßig brütenden und rastenden, teilweise sehr seltenen Vogelarten zu minimieren, sind im neuen Landschaftsplan zeitliche Einschränkungen der Jagd an einzelnen Gewässern in Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen vorgesehen. Die Ausbildung brauchbarer Jagdhunde ist durch gesonderte Regelungen gewährleistet.
Die jagdlichen Regelungen, im Einvernehmen mit Jagdinteressierten und Naturschützern getroffen, zeigen als gutes Beispiel, dass das Einbinden ehrenamtlich Wirkender in Planungsprozesse sehr konstruktiv und erfolgreich ist.
Mehr Informationen zum Landschaftsplan hat das Umweltamt der Stadt Dortmund ins Internet eingestellt – abrufbar unter www.umweltamt.dortmund.de.
Bildzeile: v.l. Dr. Uwe Rath (Leiter des Umweltamtes), Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Sonja Terme (Abteilungsleiterin Umwelt- und Landschaftsplanung, Untere Naturschutzbehörde), Ludger Wilde (Planungsdezernent)
Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Ehrenamtliches Engagement für die Artenvielfalt: Neuanpflanzungen im Loki-Schmidt-Garten
Gewöhnliche Moosbeere, Berg-Sandglöckchen, Schwarze Tollkirsche – diese und viele weitere heimische Wildpflanzen wurden im Loki-Schmidt-Garten des Botanischen Gartens Rombergpark zum Abschluss des Gartenjahres neu gepflanzt.
Zupfen, Harken, Zurückschneiden, Ausputzen sind normalerweise die monatlichen Aktivitäten der Beetpaten im Loki-Schmidt-Garten während der Gartensaison. »Die Arche«, wie der Garten auch genannt wird, will gehegt und gepflegt werden, um den Besuchern heimische Wildpflanzen in verschiedenen Lebensräumen präsentieren zu können. Darunter sind auch seltene und gefährdete Arten zu finden. Beim letzten Treffen wurde allerdings auch mal etwas Neues eingepflanzt – und das mit viel Freude. Denn im Laufe der Zeit verschwinden aus verschiedenen Gründen manche Pflanzen aus dem Bestand, das ist ganz normal. Daher beschloss das Team der ehrenamtlichen Gärtnerinnen und Gärtner des Loki-Schmidt-Gartens in diesem Jahr: »Wir möchten nachpflanzen – unsere Beete sollen wieder artenreicher sein!«
Gesagt, getan. Ende Oktober 2020 erhielt fast jedes Beet neue Pflanzen: Arten die inzwischen fehlten oder sich noch zu wenig ausgebreitet haben wurden aufgestockt. Das Ergebnis wird man zwar erst im nächsten Gartenjahr so richtig begutachten können, umso größer ist aber jetzt schon die Vorfreude. Finanziert wurden die Pflanzeneinkäufe von den Freunden und Förderern des Botanischen Gartens Rombergpark e.V.
Der Loki-Schmidt-Garten ist ein Projekt der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens Rombergpark e.V. in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten Rombergpark.
Bildzeile: Beetpaten des Loki-Schmidt-Gartens trafen sich zur Pflanzaktion.
Foto: Freundeskreis Botanischer Garten Rombergpark

Fabian Schmidt schließt Lehre als Produktdesigner mit Note 1 ab
Ausbildung an der Technischen Universität
Dortmund als guter Einstieg ins Studium
Fabian Schmidt hat seine Ausbildung an der TU Dortmund mit der Traumnote 1 abgeschlossen. Jetzt stehen ihm berufliche, aber auch akademische Türen weit offen: Im November nimmt er ein Maschinenbau-Studium an der FH Dortmund auf.
Vor seinem Abitur am Mallinckrodt-Gymnasium in Dortmund ging es Fabian Schmidt so wie vielen anderen: Er hatte keine rechte Vorstellung, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen sollte. Abhilfe brachte seine Recherche im Internet: Er bewarb sich um einen Ausbildungsplatz als „Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion“, ein Beruf, dessen Abkürzung TPDMAK schon sperrig klingt. Nach bestandenem Auswahlverfahren nahm er die Lehre an der TU Dortmund auf, wo er schwerpunktmäßig an der Fakultät Maschinenbau bei Prof. Bernd Künne lernte.
Spannende Zeiten erlebt Schmidt in seiner Ausbildung: Er ist eingebunden in konkrete Projekte, zum Beispiel bei seiner Abschlussarbeit. Und der Lockdown am 16. März fällt in die Zeit seiner Vorbereitungen für die Abschlussprüfung Teil 2; der 22-Jährige wechselt wie die gesamte Fakultät ins Homeoffice.
Hier entsteht – in ständiger Rückkopplung mit den Ausbildern, aber auch mit seinem Projekt-Paten Thomas Kallenbach – sein „Gesellenstück“, wie früher die Abschlussarbeit genannt wurde. Schmidt konstruiert am Rechner ein Sicherungssystem, das das Verrutschen von Palletten verhindern soll, die in Containern transportiert werden und teilweise tausende Kilometer über die Meere schippern. Der Auszubildende entscheidet sich für dieses konkrete Projekt. Alternativ hätte er eine Aufgabe bearbeiten können, die die prüfende Industrie- und Handelskammer (IHK) ihm vorgelegt hätte. Der Ausgang des Verfahrens ist bekannt: Seine Ausbildung an der TU Dortmund schließt Fabian Schmidt mit der Note 1 ab. Dass seine Ausbildung wegen guter Leistung um ein halbes Jahr verkürzt wurde, ist dabei eine Selbstverständlichkeit.
„Wir waren ein glücklicher Jahrgang“, meint Schmidt. Und das gilt nicht nur für seine Berufsschulklasse. Die TU Dortmund hat ihn in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen und ihm die Möglichkeit eröffnet, ab November seine Stundenzahl am Arbeitsplatz zu verringern und in der gewonnenen Freizeit zu studieren. Schmidt hat sich für ein Maschinenbaustudium an der FH Dortmund entschieden. „In den Alltag eines Maschinenbaustudenten habe ich während meiner Ausbildung schon hereingeschnuppert“, beschreibt er seine gute Ausgangsposition für das Studium. „Ich weiß, was mich erwartet, und bringe schon viel praktisches Wissen für das Studium mit.“ Wissen und auch Unterstützung durch die Fakultät: Sein Projekt-Pate Thomas Kallenbach ist nämlich auch den Weg über eine Ausbildung in der Fakultät und ein anschließendes Studium an Fachhochschule und Universität gegangen. Jetzt hat sich für ihn der Kreis geschlossen, und er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Maschinenbau der TU Dortmund – eine Laufbahn, die auch Fabian Schmidt machen könnte und für die ihm seine Ausbildung die besten Voraussetzungen bietet.
Bildzeile: Dieses Sicherungssystem hat Fabian Schmidt als Abschlussarbeit konstruiert.
Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Kaugummis für den Dortmunder Katzenschutzverein
Verein startete besondere Spendenaktion am Tag der schwarzen Katze
Katzenhalter und Tierfreunde sollten sich den 27. Oktober unbedingt im Kalender notieren, zumindest wenn es nach unseren britischen Nachbarn geht, die dieses Datum zu ihrem nationalen Tag der schwarzen Katze (engl. National Black Cat Day) erklärt haben.
So geht dieser Aktionstag auf eine Initiative der britischen Tierschutzorganisation Cats Protection aus dem Jahre 2010 zurück, die hiermit auf die niedrigen Adoptionsquoten von schwarzen Katzen aus Tierheimen aufmerksam machen möchte. Nur am Rande sei hier erwähnt, dass auch schwarze Hunde es, im Gegensatz zu Vierbeinern mit hellerer Fellfarbe, ähnlich schwer haben ein neues Zuhause zu finden. Das Negativimage der schwarzen Katze hat in Europa eine lange kulturhistorische Tradition, denn nach wie vor sehen viele Menschen in den Tieren einen schlechtes Zeichen bzw. einen Unglücksbringer. In Filmen und Büchern wird zudem kaum eine Hexe ohne die Gesellschaft einer schwarzen Katze gezeigt.
Diesen besonderen Tag hat der Dortmunder Katzenschutzverein e.V. als Startzeitpunkt einer ganz besonderen Spenden-Sammelaktion genommen: Ein restaurierter Kaugummiautomat im Stadtteil Hombruch gibt seit dem 27.Oktober für 50 Cent eine süße Erinnerung an die eigene Kindheit und das mit dem nostalgischen Flair einer Technik, die in deutschen Städten immer weniger zum Stadtbild gehört. Der Erlös dieser Aktion kommt dabei zu 100% den Dortmunder Samtpfoten zur Gute, und das aber unabhängig von der Fellfarbe.
Die Vorsitzende Dr. Gudrun Heinisch äußert sich hierbei klar zu den Herausforderungen mit denen der Verein gerade in dieser Jahreszeit zu kämpfen hat: „Unsere aktuellen Probleme liegen in diesem Jahr in der sehr hohen Anzahl der gemeldeten Tiere, insbesondere sind es Mutterkatzen mit ihren Kitten, die untergebracht und versorgt werden müssen. Wir brauchen zurzeit viel Kittenfutter für die Pflegestellen und das muss leider alles bezahlt werden“ so Heinisch und sieht auch mit einem kleinen Augenzwinkern weitere Einsatzmöglichkeiten, falls viele Dortmunder*innen sich für die Katzenhilfe mittels Kaugummi entscheiden sollten: „Vielleicht können wir mit den Einnahmen auch Zahnsanierungen von älteren Katzen unterstützen“.
Partner und Spender dieser Aktion ist der Dortmunder-Automatenerfinder Sebastian Everding, der mit seinem Bienenautomaten-Projekt zur Unterstützung von Wild- und Honigbienen bundesweite Bekanntheit erlangt hat. „Ich habe in den letzten Monaten mehr als hundert alte Kaugummiautomaten restauriert und in alle Winkel Deutschlands versendet, dabei kam mir die Idee auch mit einem aufgearbeiteten Kaugummiautomaten etwas Gutes zu bewirken und Spenden zu sammeln, so Everding und ergänzt seine Beweggründe, den Dortmunder Katzenschutzverein zu unterstützen: „Ich war selber einige Jahre im Vorstand eines Tierheims aktiv und habe dort viel Tierleid aber auch viele motivierte Tierschützer kennenlernen dürfen“.
Der Spenden-Kaugummiautomat hängt seit dem 26.Oktober an der Hauswand in der Kuntzestraße 75 in Dortmund-Hombruch. Die Kunstoffkapseln, welche der Verpackung der Kaugummis dienen, können direkt in die Sammelbox darunter für das fachgerechte Recycling eingeworfen werden.
Foto: Dortmunder Katzenschutzverein e.V.

Grüner Start ins Studium an der FH Dortmund
Architektur-Erstsemester pflanzen und hegen Bäume
200 Bäume haben die neuen Architektur-Studierenden der Fachhochschule Dortmund gepflanzt. Sie bilden den ersten Teil eines künftigen Stadtwalds in der Nähe zum FH-Campus an der Emil-Figge-Straße, der zu Beginn eines jeden Wintersemesters vergrößert wird. Mit der Aktion „ErstTrees“ will der Fachbereich Architektur den Fokus bereits zum Studienstart auf das Thema Nachhaltigkeit lenken.
„Holz ist unser einziger Baustoff, der nachwächst“, erklärte Prof. Ralf Dietz, Dekan des Fachbereichs Architektur, den Studienanfänger*innen. Der Umgang mit Ressourcen und die Wiederverwertung von Baumaterialien werden immer wichtiger in der Architekten-Ausbildung an der FH Dortmund. Denn allein in Deutschland ist der Bausektor für 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, vor allem durch die Produktion von Baustoffen. Studierende sollen bereits bei der Planung von Gebäuden berücksichtigen, welche nachhaltigen Ressourcen sie nutzen und wie Materialien wiederverwendet werden können.
Für das Projekt „ErstTrees“ hat das Grünflächenamt der Stadt Dortmund eine gut 3500 qm große Fläche in der Nähe der FH Dortmund zwischen Dorstfelder Allee und Emscherpfad zur Verfügung gestellt. Die nächsten zehn Jahre werden die jeweiligen Erstsemester hier gemeinsam Bäume pflanzen und pflegen, betreut von Guido Kollert, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Dortmund, und seinem „TreemTeam“. Die Aktion soll auch die Identifikation mit der FH Dortmund stärken. „Eines Tages kommt ihr vielleicht mit eurer Familien wieder und sagt: ‚Diesen Baum habe ich gepflanzt, hier hat es begonnen‘“, gab Projektinitiator Guido Kollert den Studierenden mit auf den Weg und verteilte die Spaten. Gepflanzt wurden Hainbuchen, Vogelbeeren und Esskastanien.
Inhaltlich wird das Projekt vom Grünflächenamt der Stadt Dortmund unterstützt. „Im Zuge des immer stärker spürbaren Klimawandels ist es ein wichtiges Zeichen junger Menschen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, sagt Landschaftsarchitekt Heiko Just, stellvertretender Amtsleiter des Grünflächenamtes. „Die Baumpflanzaktion beruht zudem nicht nur auf einem wissenschaftlichen Ansatz, sondern schafft durch das eigene Pflanzen eines Baumes durch die Studierenden einen greifbaren nachhaltigen Bezug zu diesem Thema, aber auch zur FH und der Stadt Dortmund.“
Angesichts der Corona-Pandemie war die Aktion für die Studienanfänger*innen eine gute Chance ihre Kommilitonen außerhalb digitaler Videokonferenzen zu treffen – draußen und mit Maske. Um alle Hygieneregeln einzuhalten, wurde die Aktion auf vier Tage mit jeweils etwa 40 Studierenden verteilt. Jedes Jahr beginnen etwa 150 angehende Architekt*innen ihr Studium an der FH Dortmund.
Bildzeile: Architektur-Erstsemester der Fachhochschule Dortmund haben 200 Bäume gepflanzt. Das Projekt „ErstTrees“ verstärkt den Blick auf das Thema Nachhaltigkeit im Studium.

Innenstadt-Ost-LINKE folgen Aufruf der Tierschutzpartei
In diesem Herbst ist es für Eichhörnchen besonders schwierig für den Winter vorzusorgen. Die Tierschutzpartei, die seit dem 1. November auch zur Ratsfraktion der Linken gehört, hatte deshalb dazu aufgerufen den Eichhörnchen zu helfen, indem man Nüsse für sie auslegt.
Diesem Aufruf ist nun DIE LINKE in der Innenstadt-Ost gefolgt. „Gerade in unserem Stadtbezirk mit Ostfriedhof, Westfalenpark und Stadewäldchen tummeln sich zahlreiche der schützenswerten Tiere“, erklärte Jan Siebert, Sprecher der Bezirksgruppe Innenstadt-Ost der Partei DIE LINKE und neugewählter Bezirksvertreter. Die Partei, die sich den Schutz der Armen und finanziell schlechter Gestellten auf die Fahnen geschrieben hat, kümmerte sich kurzerhand auch um die Eichhörnchen. Gemeinsam verteilten die LINKEN Walnüsse und Haselnüsse, um den Tieren zu helfen.
Foto: Die Linke Dortmund

Vorstand der Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte für drei Jahre einstimmig im Amt bestätigt
Für drei weitere Jahre zum Vorsitzenden der Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte (GWWG) gewählt wurde jetzt Dr. Ansgar Fendel, Geschäftsführer der REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund, auf der GWWG-Mitgliederversammlung. Ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt wurden Jürgen Wannhoff, Vizepräsident und Vorstandsmitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, als stellvertretender Vorsitzender, Martin Eul, Vorstandsvorsitzender der Dortmunder Volksbank eG, als Schatzmeister und Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Direktor der Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, als Geschäftsführer.
In den erweiterten Vorstand, dem 41 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur angehören, wurden neu gewählt Carsten Harder, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dortmund, Sandra Pohl, Fachdezernentin Geschichte bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dirk Schaufelberger, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Dortmund, René Scheer, Vorsitzender des Vorstands der Kulturstiftung Dortmund und Nicole Werhausen, Vorstandsvorsitzende der Werhausen AG und stellvertretende Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Dortmund. Für seine langjährigen Verdienste wurde Prof. Dr. Ottfried Dascher, der in diesem Jahr dem Vorstand seit 50 Jahren angehört, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft gewählt.
Die Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte wurde 1951 auf Initiative der IHK zu Dortmund gegründet und fördert die Arbeit des Westfälischen Wirtschaftsarchivs. Sie gibt zwei renommierte wissenschaftliche Buchreihen heraus und veranstaltet regelmäßig Vorträge, Tagungen und Kolloquien. Das Netzwerk umfasst heute über 600 Mitglieder, darunter zahlreiche Unternehmen, Forschungseinrichtungen und interessierte Bürgerinnen und Bürger.
Bildzeile: Der GWWG-Vorstand 2020 v.l. Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Marin Eul und Dr. Ansgar Fendel. Das Foto stammt aus dem Jahr 2019 und wurde somit vor Ausbruch der Pandemie aufgenommen.
Foto: IHK Dortmund

DOGEWO21: Neue Balkone, Farben und Dächer in der Lüdinghauser Straße in Eving
Die DOGEWO21-Mieter*innen der 36 Wohnungen in der Lüdinghauser Straße 28 – 38 im Stadtteil Eving können sich über neue Balkone freuen. Vom Erdgeschoss bis zur zweiten Etage verfügen die sechs Häuser jetzt über 2×3 Meter große Anstellbalkone. Im Zuge der Maßnahme wurden die Fenster im Balkonbereich erneuert und Balkontüren eingebaut.
Außerdem hat DOGEWO21 alle Dächer sowie die Vordächer der Häuser saniert und die Fassaden haben einen neuen Farbanstrich erhalten. Die im Juni begonnenen Arbeiten sind nahezu abgeschlossen.
Aktuell werden die Außenanlagen bis voraussichtlich Ende des Jahres wiederhergestellt, sofern keine witterungsbedingten Verzögerungen entstehen.
Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme liegen bei knapp 640.000 Euro.
Info: Mit über 16.300 Wohnungen zählt DOGEWO21 zu den größten Vermietern in Dortmund. 2020 investiert das Unternehmen insgesamt 34,5 Millionen Euro in Neubauprojekte, Modernisierung und Instandhaltung. DOGEWO21 baut allein in diesem Jahr fast 190 neue Balkone an ihre Häuser in Eving, Huckarde und Dorstfeld an.
Bildzeile: Herbst vor’m neuen Balkon in der Lüdinghauser Straße 28-38.
Foto: DOGEWO21

Sportwelt Dortmund setzt Sanierungsarbeiten um
Erneuerungen im Freibad Volkspark in vollem Gange
Wer kennt ihn nicht? Den Sprungturm im Freibad Volkspark. Ein Wahrzeichen, das unter Denkmalschutz steht und leider schon länger nicht genutzt werden konnte. Doch nun nutzt die Sportwelt Dortmund gGmbH die Wintersaison und lässt den Sprungturm sanieren. „Das Gerüst steht bereits und die Betonarbeiten erfolgen in den nächsten sechs Wochen. Im Frühjahr wird dann ein komplett neues Geländer gebaut“, spricht Geschäftsführer Jörg Husemann über die Planungen und fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir zur kommenden Saison den Sprungturm wieder in Betrieb nehmen und den Gästen so wieder eine Attraktion bieten können.“ Vom 10m-Sprungbrett darf allerdings weiterhin nicht gesprungen werden, da die Beckentiefe nicht mehr ausreichend ist. „Aber auch für dieses Problem arbeiten wir an einer Lösung und haben schon einige kreative Ideen, wie wir die 10m-Plattform nutzen können.“, so Husemann. Auch zusätzliche Arbeiten und Verschönerungen sind in dem
Traditionsbad am Stadion vorgesehen. So soll der Bereich des Planschbeckens sowie die Bodenplatten um das Schwimmbecken einige Neuerungen erfahren und so attraktiver werden.
Arbeiten im Hallenbad Hombruch in den letzten Zügen
Auch die Hallenbäder der Sportwelt Dortmund erleben derzeit zahlreiche Sanierungsmaßnahmen. Nachdem das Hallenbad Brackel vor einigen Wochen bereits in neuem Glanz eröffnen konnte, befinden sich die Arbeiten im Hallenbad Hombruch nun auch in den letzten Zügen. Die Duschen wurden komplett neu gefliest und insbesondere das Dach wurde umfassend saniert. Neue Isolierungsplatten zieren bereits das gesamte Dach und auch eine Solaranlage ist weiterhin geplant.
Die Verzögerungen aufgrund der unbeständigen Witterung hat die Sportwelt Dortmund nicht ungenutzt gelassen. „Eigentlich wollten wir die Arbeiten schon früher beendet haben und das Bad wiedereröffnen. Aufgrund der Verzögerungen konnten wir aber auch im Innenbereich noch einige zusätzliche Maßnahmen durchführen. Unter anderem wurden die Deckenabhängungen und Abwasserleitungen neu gemacht und auch der Eingangsbereich wird deutlich moderner aussehen“, berichtet Husemann. „Ein genauer Eröffnungstermin kann noch nicht genannt werden, aber wir sind zuversichtlich, bald auch wieder Gäste in Hombruch in Empfang nehmen zu können“, fügt Pressesprecherin Sonja Schöber hinzu.
Bildzeile: Sanierungsarbeiten am Sprungturm im Freibad Volkspark.
Foto: Sportwelt Dortmund gGmbH

Auszeichnung für die Gestaltung der Grünflächen des Straßenzuges Londoner
Bogen
Die Ausbildungsabteilung des Grünflächenamtes hat von der Stiftung
„Lebendige Stadt“ eine Auszeichnung für nachhaltige Gestaltung bekommen. Im
Februar 2020 wurden in der Straße Londoner Bogen über 80 Bäume gepflanzt.
Damit einhergehend sind auch die Baumscheiben und Grünflächen saniert und neu bepflanzt worden.
Die gesamte Maßnahme war als großes Projekt angelegt, das von den
Auszubildenden des Grünflächenamtes mit ihren Ausbildern und
Praxisanleitern gemeinsam von der Planung bis zur Pflanzung in Eigenregie
realisiert wurde. Von der Auswahl der Zukunftsbäume bis zur optischen und
nachhaltigen Gestaltung der Grünflächen mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Stauden usw. als Zielvorgabe, wurden alle Schritte des Projektes über die Ausbildung abgewickelt. Selbst die Präsentation während
der Durchführung, mit einem Besuch von Oberbürgermeister Ullrich Sierau und
vielen Anliegern, waren Bestandteil des Projekts.
Nun gab es noch eine verspätete Anerkennung. Die Maßnahme wurde als
Nachhaltigkeitsprojekt bei der Stiftung „Lebendige Stadt“ angemeldet und
mit einer Auszeichnung belohnt. Die damit verbundene Urkunde, die nun einen Ehrenplatz bei den Auszubildenden bekommt, wurde im passenden Umfeld
„Londoner Bogen“ vor Ort von der Amtsleitung des Grünflächenamtes Ulrich Finger an den verantwortlichen Ausbildungsleiter Sebastian Prozybot und dem stellvertretenden Bezirksleiter Marcus Wedemann übergeben.
Auch die Anlieger des „Londoner Bogens“ sind mit der Gestaltung sehr
zufrieden. Nach einer Entwicklungsphase zeigte sich bereits im Frühsommer ein wunderschönes, farbenfrohes Bild der Grünflächen, die auch der Biodiversität voll und ganz gerecht werden.
Bildzeile: Ausbildungsleiter Sebastian Prozybot (links) und der
stellvertretende Bezirksleiter Marcus Wedemann (rechts).
Foto: Stadt Dortmund

Neue Ehrung: Ausbildungssiegel für besonders aktive Betriebe
Drei Handwerksbetriebe gehören zu den ersten im Kammerbezirk
Dortmund
Besondere Ausbildungsleistungen von Mitgliedsunternehmen aus dem Kammerbezirk Dortmund sollen mit einer neuen Auszeichnung stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden: Dem Ausbildungssiegel der Handwerkskammer (HWK) Dortmund.
„Die Ausbildung eines jungen Menschen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die viel Zeit und Energie innerhalb eines Unternehmens bündelt“, sagt Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund. „Aber die Investition lohnt sich. Denn der Erfolg von morgen hängt maßgeblich davon ab, ob heute ausreichend Fachkräfte qualifiziert werden. Mit dem Ausbildungssiegel möchten wir den Betrieben danken, die sich bei der Ausbildung junger Nachwuchshandwerker besonders engagiert haben und damit maßgeblich zur Fachkräftesicherung beitragen. Wir brauchen solche Vorbilder!“
BACKSTAGE HAIRDESIGN by Annika Diephuis
2008 gründete Annika Grau (Nachname ihres Ehemannes) als eine der jüngsten Friseurmeisterinnen Dortmunds ihren Betrieb. Von Beginn an hat sich die Inhaberin um die Gewinnung von Auszubildenden bemüht: So nahm sie 2009 beispielsweise an der ProSieben-TV-Sendung „Deine Chance – 3 Bewerber, 1 Job“ teil. Laura Hadasch, die damals den Ausbildungsplatz ergattern konnte, ist heute immer noch im Unternehmen von Annika Grau beschäftigt. Derzeit absolvieren eine Dame (3. Jahr) sowie zwei junge Herren aus Syrien (1. Jahr) ihre Friseurausbildung im Salon. Annika Grau: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, für qualifizierten Nachwuchs zu sorgen und so dem Fachkräftemangel entgegen-zuwirken. Die Ausbildung junger Menschen trägt auch dazu bei, dass wir selbst up-to-date bleiben und nicht zuletzt auch durch die innovativen Ideen der Azubis zur Weiterentwicklung des Berufes beitragen. Es bereitet mir Freude, junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben zu unterstützen und das weiterzugeben, was mich selbst erfolgreich gemacht hat. Jungen Menschen eine berufliche Perspektive bieten zu können, macht mich glücklich. Da ich selbst jung die Meisterschule besucht habe und mich selbstständig gemacht habe, bin ich den jungen Menschen gerne ein Vorbild dafür, dass es sich lohnt, Ziele zu haben und diese zu verfolgen.“
Tischlerei freiformat Stefan Winnemöller und Jonas Scholz GbR Stefan Winnemöller und Jonas Scholz bilden das Team der Tischlerei freiformat mit Sitz in Dortmund. Die beiden Tischlermeister haben sich auf den individualisierten Möbelbau spezialisiert und fertigen zum Beispiel Garderoben und Dachschrägenschränke an. Seit 2013 bilden sie im Tischlerhandwerk aus, vier Azubis lernen aktuell in der Tischlerei.
Stefan Winnemöller: „Wir bilden gerne aus, weil es uns wichtig ist, jungen Leuten eine gute Ausbildung zu bieten und ihnen etwas beizubringen. Heute ist es selten geworden, dass sie sich für eine Karriere im Handwerk entscheiden, was sich auch im Fachkräftemangel widerspiegelt. Mit einer guten Ausbildung bestärkt man sie in ihrer Berufswahl. Es ist ein schönes Gefühl, das eigene Wissen und Können an sie weiterzugeben und dann zu sehen, dass sie die Freude an der Arbeit mit uns teilen. Wenn unsere Azubis zufrieden sind, sind wir es auch. Unsere Azubis bauen im Betrieb von Anfang an mit. Gerne übernehmen wir die jungen Leute nach ihrer Ausbildung, weil wir wissen, was sie danach alles können.“
Sanitätshaus Kraft – Emil Kraft & Sohn GmbH & Co. KG Seit fast 108 Jahren existiert das durch den Orthopädie- und Chirurgietechnikermeister Emil Julius Kraft gegründete Sanitätshaus Kraft in Dortmund. 1973 übernahm Orthopädiemechanikermeister Jochen Kraft die Führung, Klaus Kraft 1975 die kaufmännische Leitung. Seit 1989 bildet das Unternehmen in der Orthopädietechnik, seit 1992 Orthopädieschuhmacher aus. Auch eine Ausbildung zum Fachverkäufer im Sanitätsfachhandel und Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/f/d) ist möglich. Derzeit beschäftigt das Sanitätshaus 11 Azubis. Peter Kraft (Assistent der Geschäftsführung): „Es ist uns ein besonderes Anliegen, jungen Menschen eine Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Wir investieren in die Qualifikation unseres eigenen Nachwuchses, bringen damit auch Ideen und Impulse einer neuen Generation ins Unternehmen. Für uns ist die Ausbildung im eigenen Unternehmen die beste Art, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu erhalten, die die speziellen Anforderungen des Betriebes heute und in Zukunft kennen und erfüllen. Gerade in den handwerklichen Bereichen bleiben Auszubildende über Jahrzehnte, einige sogar ihr gesamtes Berufsleben im Unternehmen. Falls sich doch mal jemand anderweitig umschauen möchte, ist die Rückkehrquote immens hoch.“
Das Ausbildungssiegel der Handwerkskammer Dortmund kann verliehen werden, wenn sich das Handwerksunternehmen vorab mit einem maximal dreiseitigen Motivationsschreiben beworben hat, in dem die Besonderheiten des Ausbildungsbetriebs herausgestellt werden. Alternativ kann auch ein Handyvideo eingereicht werden, in dem der Betrieb kurz vorgestellt wird (maximal 2 Minuten) sowie ein kurzer Steckbrief, der das Gewerk sowie die Anzahl der Mitarbeiter, Auszubildende und Ausbilder enthält.
Weitere Infos zum Ausbildungssiegel www.hwk-do.de/ausbildungssiegel
Bildzeile: Sanitätshaus Kraft v.l.: Auszubildende zur Orthopädietechnikmechanikerin Tamika Igel, Orthopädietechnikmeister Andreas König, Peter Kraft (Assistent der Geschäftsführung) und HWK-Ausbildungsberater Jörg Hamann.
Foto: HWK Dortmund/Andreas Buck

Kommunales Integrationszentrum und Unverpacktladen Frau Lose verteilen nachhaltige Tüten an Kita-Kids
Das Dortmunder kommunale Integrationszentrum vertreten durch Bianca Rammert und der Unverpacktladen Frau Lose verteilte nachhaltige Tüten an die Kinder der Kindertagesstätte Bornstraße mit Mal- und Schreibuntensilien, Spielsachen und Snacks in Schraubgläsern wie Sultaninen und Nüsse – fair, bio und lose.
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist im gesamten Bildungsbereich von besonderer Bedeutung, um junge Menschen zu befähigen, die Zukunft zu gestalten. Daher möchte das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Dortmund Erzieher*innen und Lehrer*innen in diesem wichtigen Themenfeld unterstützen und arbeitet kooperativ mit verschiedenen Einrichtungen zusammen.
Die KiTa Bornstraße freut sich über die Möglichkeit gemeinsam mit Frau Lose weitere Wege der Nachhalitgkeit kennenzulernen und den Kindern nahezubringen. Julia Mohr vom Team Frau Lose erzählte über das Einkaufen ohne Verpackung und tauschte mit den Kindern Wissen über Plastik und Umweltverschmutzung aus. Besuche von Kindergruppen im Unverpacktladen sind geplant sobald es coronabedingt möglich ist.
Foto: Frau Lose Dortmund

DOGEWO21 schafft Parkraum durch Bau begrünter Garagen mit E-Anschluss in Benninghofen
Da Parkraum in der Siedlung rund um die Albinger Straße knapp ist, hat DOGEWO21 sich zum Neubau von 32 Garagen entschlossen. Das Wohnungsunternehmen hat den bestehenden Garagenhof in der Albinger Str. 1 um sechs weitere auf 34 Garagen erweitert. Zusätzlich wurde an der Albinger Str. 7 ein neuer Garagenhof mit 26 Garagen gebaut. In diesen 26 Garagen wurden zukunftsweisend die Anschlüsse für E-Ladestationen vorbereitet. Dazu zählen vorinstallierte Kabel sowie ein angegliederter Technikraum, in dem die Stromzähler installiert werden können. Bis zuzehn Fahrzeuge können zeitgleich geladen werden. Garagenmieter, die sich ein E-Auto anschaffen möchten, können sich z.B. an DEW21 wenden, um die notwendige weitere Infrastruktur wie Wallbox und Zähler von einer Fachfirma installieren zu lassen.
Auf den fast 600 qm Dachfläche der 32 neuen Garagen wurde Saatgut ausgebracht, so dass dort künftig niedrigwüchsige Steingartenpflanzen wie Mauerpfeffer und Fette Henne wachsen. Durch die Begrünung der Garagendächer sorgt DOGEWO21 für eine ökologische Ausgleichsfläche sowie einen geregelten Regenwasserablauf und somit auch für eine Entlastung des Abwassernetzes.
Inzwischen sind alle Garagen vermietet. Die Investition für die Garagen beträgt 400.000 Euro.
Bildzeile: Ein Fachbetrieb bringt das Saatgut für die Dachbegrünung aus.
Foto: DOGEWO21

Gebäudereiniger-Innung Dortmund
ehrt besten Auszubildenden
Prüfungsbester der Winter- und Sommer-Gesellenprüfung im Gebäudereiniger-Handwerk kommt aus Kamen. Robin Susen will jetzt seinen Meister machen und den elterlichen Betrieb übernehmen.
Nicht ohne Stolz konnte jetzt der 22-jährige Robin Susen aus Kamen die Auszeichnung als bester Auszubildender der Winter- und Sommergesellenprüfung im Gebäudereiniger-Handwerk entgegennehmen. In den Räumen der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen an der Langen Reihe in Dortmund Körne gratulierten Obermeister Kai-Gerhard Kullik und Geschäftsführer Volker Walters herzlich zum Erfolg nach der erfolgreichen dreijährigen Lehrzeit. Mit der Gesamtnote 2,2 schaffte es der frischgebackene Geselle an die Spitze von insgesamt 66 Auszubildenden im Gebäudereiniger-Handwerk in Dortmund. Von der Innung gab es für diesen Erfolg ein Präsent und einen Bildungsgutschein als Zuschuss zum Besuch eines Meisterkurses beim Bildungskreis Handwerk e.V.
Auf dem Weg zum Meister
„Ich wollte ursprünglich gar keine Ausbildung in unserem Familienbetrieb machen, sondern das Tischlerhandwerk erlernen“, erinnert sich der stolze Absolvent. „Das habe ich zunächst ausprobiert, mich dann aber doch für den Beruf des Gebäudereinigers entschieden.“ Vater Dirk Susen, Gebäudereinigermeister und Inhaber der Glas- u. Gebäudereinigung Dirk Susen, freut sich ganz besonders über den Erfolg seines Sohnes. Denn der Betrieb besteht bereits seit 1899 und mit seinem Sohn, der nun auch im kommenden Jahr den Meisterlehrgang besuchen wird, ist die Existenz in der fünften Generation gesichert. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet regelmäßig junge Menschen zum Gebäudereiniger aus.
Gebäudereiniger-Innung ist starker Verbund
Die Gebäudereiniger-Innung Dortmund ist ein starker Verbund der Handwerksunternehmen der Region. Sie vertritt die Gebäudereiniger-Betriebe in wichtigen regionalen und überregionalen Gremien und verleiht ihrer Stimme gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch Gewicht. Den Mitgliedsbetrieben bietet die Innung als Dienstleister einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Sie kümmert sich um Aus- und Weiterbildung, aber auch um juristische Unterstützung, günstige Versicherungsleistungen und aktuelle Informationen zur Betriebsführung.
Bildzeile: Ehrung für den Prüfungsbesten: (v.l.) Obermeister Kai-Gerhard Kullik, Vater Dirk Susen, Prüfungsbester Robin Susen und Geschäftsführer Volker Walters bei der Übergabe der Ehrenurkunde.
Foto: Gebäudereiniger-Innung Dortmund

Firmenjubiläum in Lünen: Wienholt & Horstmann ist
seit 75 Jahren erfolgreich im Elektrotechnik-Handwerk
Obermeister und Geschäftsführer der Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen gratulieren Unternehmensleitung und Beschäftigten sehr herzlich. Erfolgreicher Familienbetrieb erhält Ehrenurkunde des Handwerks zum Jubiläum.
Einen großen Grund zur Freude – wenn auch Corona-bedingt ohne große Feier – hatten jetzt Geschäftsführung und Beschäftigte der Firma Wienholt & Horstmann GmbH & Co. KG in Lünen: Das Unternehmen des Elektrotechnik-Handwerks wurde 75 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums waren Obermeister Volker Conradi und Geschäftsführer Joachim Susewind von der Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen zum Firmensitz an der Moltkestraße gekommen und überreichten die Ehrenkunde der Handwerkskammer Dortmund an Geschäftsführerin Nina Horstmann und ihren Vater Geschäftsführer Reiner Horstmann. „Ihr Betrieb hat sich in einem Dreivierteljahrhundert zu einem Markennamen für hervorragende handwerkliche Leistungen entwickelt. Sie und alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beispielhaft für unser Gewerk“, so Obermeister Volker Conradi. „Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg und zum Jubiläum.“
Familienunternehmen aus Überzeugung
Das Unternehmen Wienholt & Horstmann kann auf vier Generationen als Familienbetrieb zurückblicken. Urgroßvater Bernhard Wienholt hatte 1945 den Betrieb „Elektro Wienholt” gegründet. Schwiegersohn Franz Horstmann stieg als Meister in den Betrieb ein, heiratete die Tochter des Unternehmers und übernahm die Firma 1964. Unter seiner Leitung wuchs das Unternehmen rasch und zog zum heutigen Firmensitz an der Moltkestraße mit mehr als 3.000 Quadratmetern um. Sohn Reiner Horstmann trat ab 1977 in die Fußstapfen seines Vaters, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung als Starkstromelektriker und machte seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur an der FH in Hagen. 1986 übernahm er die Geschäftsführung an der Moltkestraße. Nina Horstmann, seine Tochter, wurde dann in vierter Generation ins Elektro-Handwerk „hineingeboren“. Die 40-jährige Elektrotechnikmeisterin ist seit 2016 weitere Geschäftsführerin der Wienholt & Horstmann GmbH & Co. KG. Das Elektrotechnik-Unternehmen beschäftigt derzeit 53 Fachkräfte, darunter zwei Diplom-Ingenieure und fünf Elektromeister. „Wir wollen das weiterzuführen, was mein Vater, Großvater und Urgroßvater aufgebaut haben”, erklärt Nina Horstmann anlässlich des Jubiläums. „Wir setzen auf hohe Qualität, besten Service und langjährig erfahrene Mitarbeiter. Das ist die Philosophie unseres Hauses und an der wird sich nichts ändern.“
Ausbildung als zentrales Anliegen
Zu dieser Philosophie gehört traditionell auch die Wertschätzung der Ausbildung zum Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, im eigenen Betrieb. Derzeit beschäftigt die Firma insgesamt neun Auszubildende. „Wir wollen, dass unsere Auszubildenden ein möglichst breites Spektrum des Berufs kennenlernen, um ihnen die besten Voraussetzungen für die Gesellenprüfung mit auf den Weg geben zu können“, so Geschäftsführer Reiner Horstmann. „Wir können zwar nicht jeden, aber doch manchen neuen Gesellen übernehmen und investieren so nicht nur in die Zukunft des Handwerks, sondern auch in die Zukunft unseres Betriebs.“
Fachbetrieb für modernste Gebäudetechnik
Heute gehören zu den Aufgabenfeldern des Unternehmens neben der klassischen Elektroinstallation für Privatkunden und Gewerbe vor allem innovative Bereiche wie Klimatechnik, Elektromobilität und Telekommunikation. Für Großprojekte in Industrie und Verwaltung realisiert Wienholt & Horstmann Aufgaben von der Baustromversorgung über die Licht-Installation bis zur komplexen Energie- und TV-Technik. Neuste Arbeitsgebiete für private Bauherren sind intelligente Smart-Home-Steuerungen sowie Haus- und Gebäudesystemtechnik mit der internationalen KNX-Technologie. Dabei versteht sich das Unternehmen nicht nur als technischer Dienstleister sondern auch als Beratungs- und Planungsexperte für komplexe Aufgabenstellungen.
Bildzeile: Gratulation zum Jubiläum: (v.l.) Innungsgeschäftsführer Joachim Susewind, Geschäftsführer Reiner Horstmann mit Tochter und Geschäftsführerin Nina Horstmann sowie Obermeister Volker Conradi.
Foto: Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen

Ungewohnte Klänge schallen durch die Flure und in Zimmer der AWO Seniorenwohnstätte Eving
Seniorinnen und Senioren freuen sich über Gospel-Konzert
Eving. So ein Konzert gab es in der Seniorenwohnstätte der Arbeiterwohlfahrt am Süggelweg noch nie, von daher war es auch irgendwie als ein Experiment zu sehen. Umso schöner, dass die Reaktionen der Bewohnerinnen und Bewohner absolut positiv ausfielen. Denn Gospel ist normalerweise nicht die klassische Musik dieser Generationen; im Haus wird sonst zu deutschen Schlagern der 50er, 60er sowie 70er Jahre getanzt und gefeiert.
Monika Dürger, die sich seit vielen Jahren in der Obdachlosenhilfe und insbesondere im ObdachlosenKaffee St. Reinoldi engagiert, brachte den Kontakt zur Band zustande. Sie begleitet Ini, eine junge Frau aus Nigeria, ehrenamtlich. Als Dankeschön für die positive Willkommenskultur und die Unterstützung, die sie erhalten hat, wollte Ini gern mit ihrer Gospel-Gruppe an ihrem Geburtstag ein Konzert geben. So stand sie also vergangenen Samstag mit einem zweiten Sänger, einem Keyboarder, einem Gitarristen und einem Schlagzeuger im Innenhof der Seniorenwohnstätte.
Aus Corona-Gründen hatte man sich für den Innenhof entschieden. Künstler*innen müssen nach wie vor einen Mindestabstand zu den Bewohnerinnen und Bewohnern halten. Der Sinnesgarten, in dem sonst Konzerte mit Abstand stattfinden konnten, fiel weg, da er für Regenwetter ungeeignet sei und ohne große Veranstaltungstechnik akustisch nicht optimal gewesen wäre. Der Innenhof war somit ideal, da er zentral gelegen ist und durch seine Bauart als „Verstärker“ für das ganze Haus fungiert. „Es war toll – man ging durch die Flure und hörte überall die Musik, das ging bis in die Zimmer“, so Marius Westhues vom Sozialen Dienst. Denn wichtig ist bei solchen Veranstaltungen, dass es neben den Bewohnerinnen und Bewohnern, die selbstständig dazukommen können, auch viele gibt, die ihre Zimmer nicht verlassen können oder wollen und so auch erreicht werden können.
Auch Monika Dürger freute sich über die positive Resonanz der Seniorinnen und Senioren. Experiment geglückt, kann man sagen, und das trotz des schlechten Wetters. Zum Schluss gab es noch selbstgebackenen Geburtstagskuchen, der an das Publikum verteilt wurde. Ein Wiedersehen können sich beide Seiten gut vorstellen. Ein großes Dankeschön im Namen aller Mitarbeitenden und Wohnenden der Seniorenwohnstätte geht an die Musikerinnen und Musiker sowie Monika Dürger, die diesen wunderbaren Nachmittag ermöglicht hat.
Foto: AWO Dortmund

Caritas Kita St. Lucia hat noch Plätze frei
Die neue Kindertagesstätte St. Lucia an der Bayrischen Straße in Obereving wird voraussichtlich Anfang 2021 an den Start gehen. Die Einrichtung bietet Platz für 148 Kinder, im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung. Verteilen werden sich die Kinder auf acht Gruppen. Davon werden auch mehrere Gruppen speziell für die Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren ausgestattet sein. Es sind noch einige Plätze frei! Die Anmeldung erfolgt über das Kita-Portal der Stadt Dortmund: www.kita-portal.dortmund.de
Informationen zur neuen Kita: Pia Hagenkötter-Seek (Leiterin), Tel.: 0152 21844795, pia.hagenkoetter-seek@caritas-dortmund.de.
Foto: Caritasverband Dortmund

Dortmunder Wirtschaft unterstützt lokale Kultur
Neun Dortmunder Wirtschaftsverbände haben ihre Mitglieder gemeinschaftlich ins Schalthaus auf Phoenix West eingeladen. Ca. 280 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung, die unter strengsten Hygienebedingungen stattgefunden hat. „Es war uns wichtig, die geplante Veranstaltung im Rahmen des RuhrHOCHdeutsch-Programms durchzuführen und den regionalen Kulturbetrieben zu zeigen, dass wir auf deren Veranstaltungs- und Hygienekonzepte auch in Zeiten der Pandemie vertrauen“, sagte Dirk Rutenhofer, Vorsitzender des Cityrings. HÖMMA! SO ISSET! ist der bezeichnende Titel des Programms von Kai Magnus Sting, dem es gelang, seine Zuschauer immer wieder zum Lachen zu bringen.
„Es muss uns trotz der Pandemielage gelingen, keine Branche zu verlieren. Insbesondere Kulturbetriebe benötigen unsere Unterstützung in dieser Zeit, erläutert Ernst-Peter Brasse, Geschäftsführer der Unternehmensverbände. „Wir müssen unter Wahrung des Abstandes alle enger zusammenrücken!“
Bildzeile: v.l. Elke Niermann, Dirk Rutenhofer, Gabriele Kroll, Dr. Sebastian Theiß, Veronika Riepe, Gunther Denk, Ingo Tiemann, Ernst-Peter Brasse.
Foto: Unternehmensverbände für Dortmund und Umgebung

Dezentrale Vereidigungsfeier von Polizistinnen und Polizisten aus Dortmund und Hagen
Mitte Oktober wurden insgesamt 498 Kommissaranwärterinnen und -anwärter sowie vier Regierungsinspektoranwärterinnen -anwärter aus Dortmund und Hagen aufgeteilt in zwei Veranstaltungen vereidigt. Die Veranstaltung fand unter strengsten Hygiene- und Abstandsregelungen sowie einer Maskenpflicht im Schalthaus 101 auf Phönix West statt. Für sie alle begann im Einstellungsjahr 2019 der Lebensabschnitt bei der Polizei. Aktuell befinden sie sich im zweiten von insgesamt drei Ausbildungsjahren.
Polizeipräsident Gregor Lange begrüßte in der ersten Veranstaltung die Studierenden und geladenen Gäste, darunter der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. In der zweiten Veranstaltung übernahm der Hagener Polizeipräsident Wolfgang Sprogies die Begrüßung.
„Heute ist ein ganz besonderer Moment für Sie und für uns alle. Ich freue mich sehr, dass wir in der jetzigen Zeit eine solche Veranstaltung durchführen können und ich persönlich dabei sein kann. Kein Tag wird in der Polizei wie der andere sein! In der heutigen Zeit, in welcher neben den alltäglichen Themen wie Straßenkriminalität, Wohnungseinbrüchen und Versammlungslagen auch Clankriminalität, Extremismus und Terror die Schlagzeilen prägen, wird Ihnen viel abverlangt. Mit den Erwartungen an die Polizistinnen und Polizisten gehen auch besondere Pflichten einher. Das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bedeutet auch den Kampf gegen Extremismus aufzunehmen, auch in unseren eigenen Reihen“, so Polizeipräsident Gregor Lange.
Innenminister Herbert Reul hatte in der persönlichen Ansprache an die angehenden Polizistinnen und Polizisten ein klare Botschaft: „Ich brauche jeden einzelnen von Ihnen in der Polizei. Der Eid auf die Verfassung ist nicht nur ein Auftrag, sondern muss eine Einstellung eines jeden Polizisten sein. Dafür müssen Sie jeden Tag einstehen. In guten wie in schlechten Zeiten!“
Der Hagener Polizeipräsident Wolfgang Sprogies ergänzte: „Die heutige Veranstaltung war wieder mit einigen Gänsehautmomenten für mich verbunden – genau wie bei den Vereidigungsfeiern in den vergangenen Jahren. Es ist immer wieder ein besonderer Augenblick, wenn so viele junge, angehende Polizistinnen und Polizisten zusammenkommen, um den Eid auf unsere Verfassung abzulegen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es rund 2.500 junge Menschen in der Kölner Lanxess Arena sind oder die über 500 Kommissaranwärterinnen und -anwärter, die sich heute in der Schalthalle 101 auf Phoenix West versammelt haben.“
Der anschließende traditionelle „Mützenwurf“ wurde aufgrund der Hygienevorschriften in ein „Hochhalten“ der Mütze umgewandelt.
Foto: Polizei Dortmund

Biologischer Weinbau an der Emscher fördert die Artenvielfalt in Dortmund
Biodiversitätsinitiative der Emschergenossenschaft
Dortmund. Die Emschergenossenschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders nachhaltig und ökologisch zu arbeiten. Dabei möchte sie auch in Sachen Landwirtschaft mit gutem Beispiel vorangehen. Ein Beispiel sind hier ihre beiden biologisch bewirtschafteten Weinberge am Phoenix See in Dortmund-Hörde und im Umweltkulturpark in Dortmund-Barop. Durch den ökologischen Weinanbau wird unter anderem auch die Artenvielfalt gefördert.
„Das richtige Rezept beim biologischen Weinanbau sind neue innovative und vor allem robuste Rebsorten. Diese weisen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten auf und ermöglichen somit eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln“, sagt Dr. Mario Sommerhäuser, Gewässerökologe und -biologe bei der Emschergenossenschaft, „Wir können praktisch vollständig darauf verzichten – somit entstehen weniger Schadstoffenträge und Fauna sowie Flora können sich besser entfalten.“ Die eingesetzten Sorten zeigen sich darüber hinaus toleranter gegenüber höheren Temperaturen als viele andere herkömmliche Weinsorten und sind damit auch gegenüber dem Klimawandel gut gewappnet.
Aber auch das richtige „Boden- und Begrünungsmanagement“ ist im biologischen Weinanbau wichtig. Denn im Gegensatz zu den herkömmlichen Maßnahmen in der konventionellen Landwirtschaft wird im Ökolandbau der Boden kaum bis gar nicht maschinell bearbeitet. Der Boden ist dadurch gesünder, lebendiger und humusreicher, was sich entsprechend belebend auf die Pflanzen am Standort auswirkt. Zusätzlich wird die Bodenfruchtbarkeit und der Bodenwasserhaushalt durch eine Begrünungseinsaat mit vielen verschiedenen krautigen Pflanzenarten mit Blühaspekt unterstützt.
„Diese Begrünungseinsaat dient gleichzeitig als Nahrungsangebot für das Bodenleben, als Erosions- und Verdichtungsschutz, zum Humusaufbau und begünstigt die für die Pflanzen lebensnotwendige Fixierung von Stickstoff im Boden“, sagt Mario Sommerhäuser, „durch das große Blüten- und Pollenangebot insektenfreundlicher Begrünungspflanzen bieten die Rebhänge vielfältigen Lebensraum, wobei sich insbesondere auch für den biologischen Weinanbau wichtige Nützlinge, wie Marienkäfer, Spinnen, Ohrwürmer etc. vermehrt ansiedeln.“ Folglich wird durch diese Form des ökologischen Weinanbaus, deren Grundsätze die Emschergenossenschaft verfolgt, die Artenvielfalt erheblich gefördert.
Soziale Komponente
Die Rebhänge im Neuen Emschertal bringen aber nicht nur ordentliche Weiß- und Rotweine hervor: Da der gesamte Erlös aus dem Verkauf des Weins direkt an den Verein „Sail Together“ gespendet wird, ist der Verzehr des Phoenix Weins nicht nur im Sinne der Natur, sondern auch des gemeinnützigen Zweckes.
Neben dem, was die Emschergenossenschaft heute bereits zu Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt im Rahmen des bekannten „Emscher-Umbaus“ und besonderen Projekten wie den Weinhängen in Dortmund leistet, setzt der Wasserverband in den kommenden Jahren im Rahmen seiner Biodiversitätsinitiative ein weiteres ökologisches Schwerpunktprogramm um: „Dazu gehören nicht nur die Langzeitchancen durch die Renaturierungsprojekte, sondern auch gezielte lokale Sofort-Maßnahmen auf Flächen der Emschergenossenschaft wie Boden- und Pflanzarbeiten (Blühwiese, Sandhaufen, Obstbaum) sowie das Anbringen von Nistkästen (Fledermaus, Vögel, Insekten)“, erklärt Sommerhäuser. Letztendlich wird kontinuierlich das Potenzial aller Flächen für weitere Maßnahmen geprüft. Diese beinhalten auch alle geeigneten Anlagenstandorte der Emschergenossenschaft (Kläranlagen, Pumpwerke, etc.).
Kurz zusammengefasst: Durch den Verzicht auf schädliche Pflanzenschutzmittel, einer geringen Bodenbelastung und einer intensiven Förderung der lokalen Artenvielfalt passen die gewonnenen Erkenntnisse aus den ökologisch bewirtschafteten Weinhängen in Dortmund perfekt zu den Zielen der Biodiversitätsinitiative der Emschergenossenschaft. Sie dienen zukünftig als Grundlage für weitere Projekte zur Vermehrung der Artenvielfalt in unserer Region.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das effizient Aufgaben für das Gemeinwohl mit modernen Managementmethoden nachhaltig erbringt und als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz. Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von rund 30 Jahren prognostizierte 5,38 Milliarden Euro investiert werden.
Bildzeile: Weinverköstigung am 2. Weinberg der Emschergenossenschaft in DO-Barop (v.l.n.r.): Prof. Dr. Uli Paetzel (Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft), Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Winzerin Tina Krachten, Dr. Mario Sommerhäuser (Gewässerökologe und -biologe bei der Emschergenossenschaft) und Helmut Herter. Helmut Herter stammt aus einer Winzerfamilie aus der Pfalz und hat lange Jahre als Ingenieur bei der Emschergenossenschaft gearbeitet. Unter anderem hat er die neue Emscher am Phoenix See gebaut. Nach seiner aktiven Zeit bei der Emschergenossenschaft kümmerte er sich federführend um die Pflege des Weinbergs am Phoenix See.
Foto: Kirsten Neumann/EGLV

Resolution der tarifpolitischen Konferenz der IG Metall Ruhrgebiet Mitte
Die erste tarifpolitische Konferenz der IG Metall Ruhrgebiet Mitte fand, in Vorbereitung auf die Tarifrunden der Metall-, Elektro-, sowie der Stahlindustrie, mit Interessenvertreter*innen aus 26 Betrieben statt.
Ulrike Hölter, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ruhrgebiet Mitte eröffnete die Konferenz: „Die Tarifpolitik ist das Herzstück unserer Gewerkschaftsarbeit. Gute Tarifverträge sind der beste Grund Mitglied in der IG Metall zu sein!“
Die Corona-Pandemie hat den Alltag und das Arbeitsleben weiter fest im Griff. Viele Betriebe stehen vor einer schwierigen Zeit. Die Bewältigung der Krise wird noch einige Zeit andauern. Zudem sind die Herausforderungen, die durch Klimawandel, Mobilitätswende und Digitalisierung die Transformation in der Industrie vorantreiben, nicht vom Tisch.
Standortschließungen, Personalabbau und Kündigungen sind keine Lösungen. Die Beschäftigten dürfen nicht zu den Verlierern der Krise werden!
Volker Strehl, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Ruhrgebiet Mitte: „Um Entlassungen zu vermeiden ist Kurzarbeit ein sinnvolles Mittel. Um den vor uns stehenden Strukturwandel bewältigen zu können, werden aber weitere Instrumente zur Beschäftigungssicherung notwendig sein. Dazu gehört auch der Vorschlag einer 4-Tage-Woche mit einem Teilentgeltausgleich.“
Mit dem Vorschlag zu einer 4-Tage-Woche sorgt die IG Metall für eine gerechtere Verteilung des Arbeitsvolumens und so könnten Beschäftigung und Arbeitsplätze in den Betrieben erhalten werden. Dies ist die Alternative zum Abbau von Industriearbeitsplätzen in Deutschland. Deshalb sollte Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung, als ein Gestaltungsvorschlag für die Arbeitswelt unter Berücksichtigung der Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten, ein wesentliches Thema in den Tarifverhandlungen sein.
„Auch Ausbildung und die Übernahme der Ausgebildeten muss in der Tarifrunde behandelt werden. Der Industriestandort Deutschland benötigt gut ausgebildete Fachkräfte. Anstatt Ausbildungsplätze und Ausbildungskapazitäten zu reduzieren, bedarf es einer Ausbildungsstrategie, die den jungen Menschen in diesem Lande eine Zukunft bietet und die Voraussetzungen für eine gelungene Transformation in der Industrie schafft,“ sagte Ulrike Hölter.
Nicht zuletzt benötigen die Menschen Einkommen und sichere Beschäftigung! Kaufkraft stärkt die Binnennachfrage und hilft uns aus der Krise. Deshalb müssen Einkommenserhöhungen Bestandteil der kommenden Tarifrunden sein.
Ulrike Hölter machte deutlich: “Tarifverträge werden durch die Mitglieder der IG Metall erstritten. Deshalb gehört ein Bonus für die Mitglieder in den Tarifvertrag!“
Foto: IG Metall Ruhrgebiet Mitte

Seit September trägt im St.-Johannes-Hospital ein Demenzcoach zur sicheren und guten Versorgung im Krankenhaus bei.
Silvia Goldammer ist langjährig erfahrene Pflegefachkraft. Eine Weiterbildung hat sie für den Umgang mit Menschen mit dementieller Veränderung in besonderer Weise qualifiziert. Zu ihren Aufgaben gehören außerdem das Gespräch mit Angehörigen sowie die Beratung des Klinikpersonals. „Die Zahl der älteren Patienten nimmt zu. Nahezu jeder fünfte über 65 leidet an Demenz. Dieser Herausforderung müssen wir uns alle gemeinsam stellen“, betont die 44-Jährige. Nicht zu verstehen, was passiert, erzeugt ein Gefühl von Hilflosigkeit, das zu starker Unruhe und Abwehrverhalten führen kann. Menschen, die bei der Pflege oder Visite kommen und gehen, wirken verstörend. Langsam sprechen, kurze Sätze, keine Wie-Fragen, sich Zeit nehmen – Silvia Goldammer hat gelernt, Menschen mit Demenz richtig zu begegnen. Regelmäßige Besuche und Aktivierung durch Spiele sind Teil ihres Jobs. Alte Kinderreime, Bewegungsangebote und die Förderung von Entspannung durch Aromatherapie tragen dazu bei, dass sie zur Ruhe kommen. Aber: Was heute wirkt, kann morgen schon nicht mehr funktionieren. „Gefragt ist bei Demenz-Erkrankten nicht nur Sensibilität, sondern auch Kreativität“, so Silvia Goldammer. „Wichtig ist, ihnen auf der Gefühlsebene zu begegnen und einen Anknüpfungspunkt zu finden, wie zum Beispiel in der Biographiearbeit mit Bildern oder Erinnerungskoffer.“ Nicht immer ist allen Beteiligten sofort klar, dass der Patient mit dem Magengeschwür oder dem Leistenbruch auch unter dementiellen Veränderungen leidet. „Das merkt man manchmal erst, wenn er Zeichen von Orientierungslosigkeit zeigt oder an der Gesundung nicht mitarbeitet“, erzählt Silvia Goldammer. Deshalb lernt ein Demenzcoach während der Ausbildung auch, die kognitiven Einschränkungen zu identifizieren, um geeignete individuelle Begleitmaßnahmen so früh wie möglich einleiten zu können und damit Folgeprobleme zu vermeiden. Denn auf keinen Fall soll sich der Zustand des Patienten durch den Umgebungswechsel verschlechtern. Um alle Berufsgruppen im Krankenhaus zu sensibilisieren, sollen Konzepte und Standards entwickelt werden, die das Thema Demenz zu einer komplexen Gemeinschaftsaufgabe im St.-Johannes-Hospital machen. „Unser Anliegen ist es, dass sich die Patienten bei uns nicht hilflos, sondern sicher und gut umsorgt fühlen“, fasst Silvia Goldammer das Leitziel zusammen.
Die Inanspruchnahme des Demenzcoachs ist kostenlos und freiwillig.
Bildzeile: Silvia Goldammer (r.) und Kollegin im Gespräch.
Foto: JoHo Dortmund
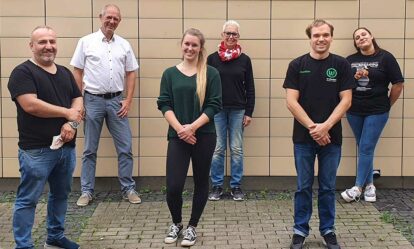
SV Westfalen wählt neuen Vorstand
Die Mitglieder des SV Westfalen Dortmund haben bei ihrer Mitgliederversammlung Ende September einen neuen Vorstand gewählt. Dies wurde notwendig, weil Uwe Weckelmann sich nach zehn Jahren im Amt nicht wieder zur Wahl gestellt hat. Uwe hat schon bei Antritt des Posten als 1. Vorsitzender klargestellt, dass er diese Position maximal zehn Jahre wahrnehmen würde. Uwe bleibt dem Verein allerdings als Abteilungsleiter Kommunikation weiterhin erhalten.
Auf die Position des 1. Vorsitzenden ist Ümit Acar nachgerückt, er war bisher 2. Vorsitzender.
Als 2. Vorsitzender wurde Sebastian Greiffer gewählt. Damit wird der Vorstand stark verjüngt.
Marianne Kleff wird bis zum Frühjahr kommenden Jahres das Amt der Geschäftsführerin weiterführen. Ihre Hauptaufgabe wird die Einarbeitung des neu gegründeten Geschäftsführungsteams sein.
Der SV Westfalen Dortmund setzt mit der Neubesetzung des Vorstandes seinen eingeschlagenen Weg fort. Ein Ziel des Vereins ist es, den Verein so aufzustellen, dass es egal ist, wer im Augenblick den Vorsitz hat. Dies ist ein gesetzliches Konstrukt, dem Rechnung getragen werden muss. „In einem modernen Verein darf und soll sich jedes Mitglied eigenverantwortlich in die Vereinsarbeit einbringen“, erklärt Uwe Weckelmann auf der Mitgliederversammlung. Dafür sei es notwendig stabile Strukturen in den Abteilungen aufzubauen. Die Abteilungen geben dem Verein, durch Ihre weitgehende Selbständigkeit, die Basis. Dem geschäftsführenden Vorstand bleibt dadurch die Zeit, die er benötigt, um sich mit der Weiterentwicklung des Vereins und dem Vorantreiben begonnener Projekte zu widmen.
Bildzeile: v.l. Ümit Acar (1. Vorsitzender), Uwe Weckelmann (Leiter Kommunikation), Franziska Bruns (Jugend), Marianne Kleff (Geschäftsführerin), Sebastian Greiffer (2. Vorsitzender), Dicle Acar (Jugend).
Foto: SV Westfalen Dortmund

Aktion „Run & Roll“ an der Robert Koch-Realschule Dortmund
Interessierte Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule besuchen seit dem 50-jährigen Jubiläum der Robert-Koch-Realschule im Schuljahr 2018/2019 regelmäßig
ehrenamtlich die Seniorinnen und Senioren des Minna-Sattler-Seniorenzentrums. Gemeinsam wird mit den Bewohnern des Seniorenheims beim Frauen- und Männerstammtisch „geklönt“.
Im Rahmen dieser Kooperation beteiligten sich Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a an der Aktion “Run & Roll“ des Vereins „Den Kindern zu liebe/Dayemi Gemeinschaft e.V.“
19 Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule und 15 Seniorinnen und Senioren des Minna-Sattler Seniorenheims trafen sich Ende September zu dieser Aktion.
Gemeinsam joggten oder gingen sie im Rollstuhl 1,5 oder 3 km um den Teich des Rombergparks.
Die Fotos und Videos dieser Aktion werden an den Verein weitergereicht und werden
wegen Corona zueinem virtuellem Lauf zusammengestellt.
Die Schülerinnen und Schüler sowie die Seniorinnen und Senioren hatten viel Spaß.
Beide Gruppen fanden das Zusammensein von „alt und jung“ als ein tolles Erlebnis
und wünschen planen bereits weitere gemeinsame Aktionen im Quartier.
Foto: Robert Koch-Realschule Dortmund

„Die Farben des Sommers“ sind gefunden: Preisverleihung im Kulturrucksack-Fotowettbewerb
Die „Farben des Sommers“ waren das Thema in einem Fotowettbewerb des Landesprogramms „Kulturrucksack“. Dortmunder Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren haben in den vergangenen Monaten ihre Motive dazu gefunden und abgelichtet; die besten Arbeiten wurden im Oktober im Künstlerhaus prämiert.
Insgesamt gab es je drei Preise für das beste Foto und für die beste Idee, wobei ein erster Preis doppelt vergeben wurde.
In der Kategorie „Bestes Foto“ gingen die Preise an Karla Gizbili und Shiqing Sun (1. Platz), Roman Schellberg (2. Platz) und Heidi Franziska Leci (3. Platz).
In der Kategorie „Beste Idee“ gewannen Leonard Wojatzek (1. Platz), André Wetterhahn (2. Platz) und Shiqing Sun (3. Platz).
Alle Teilnehmer*innen erhielten außerdem Magnete mit acht verschiedenen Motiven aller eingereichten Fotos mit dem Auftrag, magnetische Flächen im öffentlichen Raum zu finden und ein Foto dann in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #kulturrucksackdortmund zu posten.
Bildzeile: Die glücklichen Gewinner*innen des Fotowettbewerbs.
Foto: Etta Gerdes

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dortmund ins Sprecherinnengremium der LAG NRW gewählt
Die Dortmunder Gleichstellungsbeauftragte Maresa Feldmann wurde in Hamm auf der Konferenz der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsbeauftragter (LAG NRW) einstimmig in das achtköpfige Sprecherinnengremium gewählt. Damit wird Maresa Feldmann für die nächsten zwei Jahre zusammen mit den anderen amtierenden LAG-Sprecherinnen aus den Städten Düsseldorf, Kleve, Beckum, Niederkassel, Witten, Goch und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Belange der nordrhein-westfälischen Kolleginnen nach außen vertreten.
Die Sprecherinnen der LAG NRW vertreten die Interessen der Gleichstellungsbeauftragten nach außen und setzen die auf den Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse um. Sie halten Kontakt zu den kommunalen Spitzenverbänden, Parteien, Frauengruppen, Gewerkschaften, Kirchen und Gleichstellungsbeauftragten anderer Institutionen. Sie geben öffentliche Stellungnahmen ab, geben Pressemitteilungen heraus und sorgen für einen kontinuierlichen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW und der LAG NRW.
Foto: Stadt Dortmund

Neue Direktionsleiterin beim Polizeipräsidium Dortmund – Polizeipräsident begrüßt Ines Verhaaren
Die Leitende Regierungsdirektorin Ines Verhaaren hat im August dieses Jahres die Direktion Zentrale Aufgaben (ZA) im Polizeipräsidium Dortmund übernommen. Die 38-jährige Juristin tritt damit die Nachfolge von Alexandra Dorndorf an.
Ines Verhaaren wechselte vom Polizeipräsidium Hagen, wo sie ebenfalls die Direktion ZA leitete und zudem stellvertretende Behördenleiterin war, in ihre Heimat-stadt. Über die Bezirksregierung Arnsberg fand sie den Weg zur Polizei. Anschließend leitete sie ein Teildezernat im Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP).
In ihrem Verantwortungsbereich als neue Leiterin ZA des Polizeipräsidiums Dortmund liegen nun so wichtige Bereiche wie das Versammlungsrecht, das Waffenrecht, Einsatztraining und Personal sowie Technik und Haushaltsmittel.
„Als Dortmunder Bürgerin kenne ich die großen Herausforderungen, mit denen sich die Polizei in meiner Heimatstadt jeden Tag auseinandersetzen muss. Ob es nun der konsequente Kampf gegen den Rechtsextremismus, die Bekämpfung krimineller Strukturen oder die vielen Versammlungslagen sind, ich bin stolz darauf, meinen Beitrag dazu leisten zu können, das Leben der Bürgerinnen und Bürger in unserer schönen Stadt noch ein wenig sicherer zu machen“, so die Leiterin ZA Ines Verhaaren.
Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange: „Ich freue mich, dass wir mit Ines Verhaaren eine erfahrene Juristin für die Leitung der Direktion ZA gewinnen konnten, die schon an verantwortlicher Stelle für die Polizei NRW im Einsatz war.“
Bildzeile: Unter Beachtung der pandemiebedingten Abstandsregeln begrüsste Polizeipräsident Gregor Lange die neue Leiterin der Direktion ZA Ines Verhaaren.
Foto: Polizei Dortmund

Dortmund und Kumasi (Ghana) unterzeichnen Memorandum of Understandig (MoU)
Oberbürgermeister Ullrich Sierau und sein Amtskollege aus Kumasi, Osei Assibey Antwi, haben im Oktober 2020 ein Abkommen über eine Projektpartnerschaft unterzeichnet. Sie ist auf zwei Jahre ausgelegt und fokussiert sich hauptsächlich auf eine Zusammenarbeit im Bereich Klimaanpassung.
Was haben Dortmund und die ghanaische Großstadt Kumasi gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Dabei gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Kumasi ist die Hauptstadt der Ashanti Region in Ghana. Sie wird auch auf Grund ihrer bunten und vielfältigen Pflanzenwelt als Garten-Stadt bezeichnet. Kumasi ist eine Studentenstadt, mehrere Universitäten sind hier ansässig, darunter auch die renommierte Kwame Nkrumah University of Science and Technology, die auch die Partneruniversität der TU Dortmund ist. Kumasi ist nach der Hauptstadt Accra die wichtigste Stadt in Ghana, hier befindet sich auch einer der größten Märkte Westafrikas.
Dortmund ist eine der grünsten Großstädte in Deutschland und mit ihren sieben Hochschulen und den zahlreichen Forschungseinrichtungen eine absolute Wissenschaftsstadt. Dortmund ist ein regionales Oberzentrum und als Teil des Ruhrgebietes eines der größten Wirtschaftsräume Europas.
Beide Städte verbindet zudem das Engagement, sich durch ihre Stadtplanung an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Große Sommerhitze, lange Dürreperioden, Starkregen… Phänomene, die durch den Klimawandel in beiden Städten immer öfter auftreten und denen man durch vorausschauendes Planen und innovative Ansätzen entgegenwirken möchte. Beide Städte sollen resilienter und grüner werden. Außerdem arbeiten beide Städte derzeit an einem stadtweiten Klimaanpassungskonzept.
Seit 2011 stehen Dortmund und Kumasi in Kontakt, schon sehr früh hatten beide Städte die Wichtigkeit einer vorausschauenden, resilienten Stadt- und Umweltplanung erkannt. Mit der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding will man sich nun einem verstärkten Austausch verpflichten. Zum Beispiel ermöglicht die zeitgleiche Erarbeitung eines Masterplans einen peer-to-peer – Prozess, der neue Impulse für die jeweiligen Masterpläne und die stadtweiten Klimaanpassungskonzepte setzen soll.
Über die Zusammenarbeit im Bereich Klimaanpassung hinaus soll jedoch auch der kulturelle Austausch gefördert und v.a. auch junge Menschen miteinander in Kontakt gebracht werden. Zudem wünschen sich die Kolleg*innen aus Ghana auch einen Erfahrungsaustausch hinsichtlich des Strukturwandels und darüber wie sich die Stadt Dortmund im Bereich der Gründungsförderung einsetzt. Profitieren könnte dieser Austausch auch durch die Partnerschaft des Landes NRW mit Ghana und einem von der Landesregierung geförderten Projekt der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, die sich für eine Stärkung des Ökosystems für Gründer in Kumasi und Region einsetzt und dabei das Ruhrgebiet als Inspiration sieht.
Durch den Sitz des ghanaischen Honorarkonsulats in Dortmund (Honorarkonsul Klaus Wegener, Auslandsgesellschaft e.V.) bekommt die Beziehung zwischen beiden Städten nochmal eine besondere Verbindung.
Foto: Stadt Dortmund

Firmenjubiläum in Eving: Elektro Liedtke kann auf 75 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückschauen
Obermeister und Geschäftsführer der Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen gratulieren Unternehmen aus Dortmund-Eving sehr herzlich. Geschäftsführer und Inha-ber Alija Sulkoski erhält Ehrenurkunde des Handwerks zum Jubiläum
Ein ganz besonderes Jubiläum konnten jetzt Geschäftsführung und Beschäftigte der Firma Elektro Liedtke e.K. in Dortmund-Eving feiern: Das Unternehmen des Elektrotech-nik-Handwerks wurde 75 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums waren Obermeister Volker Conradi und Geschäftsführer Joachim Susewind von der Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen zum Firmensitz an der Minister-Stein-Allee gekommen und über-reichten die Ehrenkunde der Handwerkskammer Dortmund an Geschäftsführer und In-haber Alija Sulkoski. „Es ist mir eine besondere Freude, einem Betrieb zu gratulieren, der es geschafft hat, durch die Qualität seiner handwerklichen Arbeit ein Dreivierteljahr-hundert täglich neu seine Kunden zu begeistern“, so Obermeister Volker Conradi. „Sie sind ein gutes Beispiel für die Langlebigkeit und Stabilität unseres Handwerks.“
Innovationen prägen Unternehmensgeschichte
Die Firma Elektro Liedtke war direkt nach dem Krieg 1945 durch den Elektrotechniker-meister Wilhelm Liedtke gegründet worden. Kernbereich des Unternehmens war zu-nächst die klassische Elektroinstallation, die jedoch mit den Jahren um weitere, innova-tive Geschäftsfelder ergänzt wurde. 1970 übernahmen nach 25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit Schwiegersohn Reiner Stückemann und seine Ehefrau Heidi Stückemann geb. Liedtke den Betrieb und führten ihn bis 2004 weiter. Mit dem heutigen Inhaber und Ge-schäftsführer von Elektro Liedtke, Alija Sulkoski, erfuhr der Betrieb dann ab 2004 noch-mals einen Innovationsschub. Der heute 49-jährige Elektrotechnikermeister aus Make-donien hatte ab 1989 seine Ausbildung im Betrieb absolviert und 2003 die Meisterprü-fung in Dortmund abgelegt. Als jahrelanger Kenner des Betriebs und der Branche führte er Elektro Liedtke erfolgreich in den Wachstumsmarkt digitaler Technologien des Elektro-technik-Handwerks.
Fachbetrieb für modernste Gebäudetechnik
Heute gehören zu den Aufgabenfeldern des Unternehmens die hochqualitative Installa-tion von Elektro- und Beleuchtungsanlagen sowie von Netzwerken für private Bauher-ren, Industrieobjekte und Verwaltungsgebäude. Weitere Schwerpunkte sind darüber hinaus Smart-Home-Steuerungen sowie Haus- und Gebäudesystemtechnik mit der in-ternational standardisierten KNX-Technologie und Anlagen im Bereich der Photovoltaik. Auf dem eigenen Betriebsgelände in Dortmund-Eving können sich Kunden in einer Aus-stellung über neue und innovative Produkte renommierter Hersteller der Elektro-Branche informieren.
Ausbildung ist selbstverständlich
Als zukunftsorientierter Elektrodienstleister war es Inhabern von Elektro Liedtke während der gesamten 75 Jahre der Unternehmensgeschichte stets ein großes Anliegen, eigene Fachkräfte auszubilden. „Das wird auch in Zukunft so sein“, erklärte Geschäftsführer Alija Sulkoski anlässlich des Unternehmensjubiläums. „Wir sehen Ausbildung als Schlüssel für die künftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens. Dabei legen wir Wert auf ei-ne hohe kulturelle Vielfalt und haben darum bereits zwei ehemalige Geflüchtete erfolg-reich bei uns ausgebildet.“ Zur Belegschaft von Elektro Liedtke gehören aktuell ein Elekt-romeister, acht Elektromonteure, vier Auszubildende und eine Bürokraft.
Bildzeile: Gratulation zum Jubiläum: (v.l.) Innungsgeschäftsführer Joachim Susewind, Ehefrau Meka Sulkoska, Geschäftsführer und Inhaber Alija Sulkoski und Obermeister Vol-ker Conradi.
Foto: Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen

Kinder zähmen Elterntaxis: Aktionstag „zu Fuß zur Schule“ an der
Liebig-Grundschule
Keine Elterntaxis in der Harnackstraße! Dieses Ziel hatte sich die
Liebig-Grundschule für ihren Aktionstag „Zu Fuß zur Schule“ am 1. Oktober
gesetzt. Wie das gelingen kann und dass man den Elterntaxi-Verkehr vor der
Schule „zähmen“ kann, haben die Liebig-Kinder am Aktionstag mit Fahrrädern,
Rollern, Straßenmarkierungen und selbst gemalten Plakaten eindrucksvoll
gezeigt.
Eine Woche lang hatten sich Kinder mit Unterstützung von Eltern und Lehrer*innen auf diesen Tag vorbereitet: Sie haben Plakate gestaltet, Bilder gemalt und ein Schulweg-Tagebuch geführt. So kamen die Kinder
untereinander ins Gespräch, sammelten Ideen für einen autofreien Schulweg
und gaben ihre Anregungen zuhause an die Eltern weiter.
Gelbe Ballons statt zugeparkter Straße
Was Kinder auf diese Weise bewegen können, zeigte sich am Aktionstag: Die
häufig zugeparkte und von Elterntaxis verstopfte Harnackstraße blieb an
diesem Morgen fast autofrei. Fahrräder, Roller, bunte Plakate, grell bunte
Straßenmarkierungen und gelbe Luftballons prägten das Bild vor dem
Schulgebäude. Jedes Schulkind, welches an diesem Tag autofrei zur Schule kamen, erhielt einen gelben Luftballon als sichtbare Anerkennung. Das
Ergebnis war weithin zu sehen: Von den 200 zu verteilenden Ballons blieben gerade mal vier übrig…
An diesen Erfolg und die positiven Erfahrungen mit dem autofreien
Schulwegtag soll mit dem Programm „So läuft das“ angeknüpft werden, für das die Liebig-Grundschule mit sieben weiteren Schulen und Kitas im Rahmen des
Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt ausgewählt wurde, um
klimafreundliches Verkehrsverhalten an Grundschulen zu fördern. Auf der Grundlage einer Elternumfrage sowie einer anschließenden Schulweganalyse
wird in einer ersten Projektphase ein Schulwegplan entwickelt. Nach den
Herbstferien werden die Kinder im Rahmen des Sachunterrichts zu
„Verkehrszähmern“ ausgebildet.
Klimafreundliche Mobilität an Grundschulen
Um den Autoverkehr an Grundschulen zu reduzieren, wurden im Rahmen des
Projektes Emissionsfreie Innenstadt acht Grundschulen ausgewählt, die an
dem in Dortmund entwickelten und erprobten Programm „So läuft das“teilnehmen.
Kern sind Beratungen zu Schulwegplan, Hol- und Bringzonen sowie Bausteinen
wie Walking-Bus und „Verkehrszähmer“. Darüber hinaus kann in
Beschilderungen oder Markierungen investiert werden, um die
Verkehrssicherheit im Schulumfeld zu erhöhen. Fehlende
Radabstellmöglichkeiten im näheren Umfeld werden im Zuge der Maßnahme
Fahrradparken des Projektes Emissionsfreie Innenstadt aufgestellt.
Das Mobilitätsmanagement an Grundschulen ist Bestandteil des
Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt. Die Europäische Union und das
Land Nordrhein-Westfalen unterstützen das Förderprojekt Emissionsfreie
Innenstadt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Bildzeile: Mit Markierungen und Plakaten haben Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen
der Liebig-Grundschule auf ihren Aktionstag „Zu Fuß zur Schule“ aufmerksam
gemacht.

SPD-Ratsfraktion zu Besuch im mondo mio! Kindermuseum e.V.
Die SPD-Ratsfraktion ist einer Einladung in das Kindermuseum mondo mio! gefolgt, um dort ein informatives Gespräch mit der Leiterin der Einrichtung, Frau Lahme-Schlenger, über die Arbeit des Kindermuseums zu führen. Im Anschluss an das Gespräch ergab sich die Möglichkeit, das einzigartige und vielfach ausgezeichnete Angebot für Kinder zu besichtigen.
Brigitte Thiel, kulturpoliitsche Sprecherin und Friedhelm Sohn, Vorsitzender des Ausschusses Kinder, Jugend und Familie waren sich einig: “Das Museum ist ein wichtiger außerschulischer Lernort, bei dem kindgerecht die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und interkulturelle Begegnungen vermittelt werden. Hier steht Mitmachen und Entdecken im Vordergrund. Wir freuen uns darüber, dass diese wichtige pädagogische Arbeit verbunden mit hochmotivertem Engagenment aller Beteiligten so gut angenommen wird”.
Leider entspricht das Gebäude im Westfalenparkt energetisch nicht mehr dem Stand der Technik und der Träger, ein gemeinnütziger Verein, hat mit hohen Energiekosten zu kämpfen. Erste Pläne für einen Neubau und die konzeptionelle Weiterentwicklung des Museums werden derzeit erarbeitet.
“Neben der pädagogischen Arbeit erfolgen im Kindermuseum auch Fortbildungen für Mitarbeiter*innen aus allen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit. Auf diesem Weg gelangen die Themen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und die Betreuung im offenen Ganztagesbetrieb. Die SPD-Fraktion wird die Arbeit des mondo mio! weiter im Fokus behalten und mit den Akteuren im Gespräch bleiben. Wir sind sicher, dass auch die neue Ratsfraktion die Weiterentwicklung positiv begleiten wird”, zeigen sich Brigitte Thiel und Friedhelm Sohn überzeugt.
Bildzeile: v.l. Brigitte Thiel, kulturpolitische Sprecherin SPD-Ratsfraktion, Monika Lahme-Schlenger, Leiterin des Kindermuseums mondomio! e.V., Friedhelm Sohn, SPD Ratsfraktion, Vorsitzender des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie.
Foto: SPD-Ratsfraktion Dortmund

Spende für die Seniorenwohnstätte der Arbeiterwohlfahrt in Eving
Förderverein überreicht Radios für Seniorinnen und Senioren
Eving. Über insgesamt acht Internetradios dürfen sich die Bewohnerinnen und Bewohner der AWO Seniorenwohnstätte freuen. Möglich macht dies eine großzügige Spende des zum Hause gehörenden Fördervereins. Die Radios sollen in den Hausgemeinschaften der Einrichtung aufgestellt werden und per WLAN und Bluetooth für gute Musik und damit gute Stimmung sorgen. Sie ersetzen die mittlerweile in die Jahre gekommenen Geräte, deren Klang nicht an moderne Radios herankommt.
Ohne die zahlreichen Spenden und das Engagement des Fördervereins wären viele Projekte sicher nicht realisierbar gewesen. Viele Anschaffungen für die Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht durch das Pflegebudget finanziert werden können, wurden durch unseren Förderverein finanziert wie z. B. der Sinnesgarten, der Snoezelenraum, der Springbrunnen am Eingangsbereich, Laptops für die Betreuung und die finanziellen Unterstützungen der Bewohnerurlaube. „Dafür bedanke ich mich ganz herzlich im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner bei unserem Förderverein und freue mich auf neue Projekte, die schon in Planung sind“, so Einrichtungsleitung Sevgi Basanci.
Bildzeile: Einrichtungsleitung Sevgi Basanci (Mitte) und Haustechniker Dominik Augustin (2. v. r.) freuen sich über die Spende des Fördervereins, hier vertreten durch Hans-Jürgen Unterkötter, Monika Anders, Luisa Mota-Vogel und Heidi Nürnberger.
Foto: AWO Dortmund

Das Leben nach der Schule fest im Griff
Neuntklässler der Marie-Reinders Realschule nehmen an Lebensplanungsseminar teil
Was stelle ich mir für meine Zukunft vor? Und was kostet das Leben? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt des zweitägigen Lebensplanungsseminars, das die Jahrgangsstufe neun der Marie-Reinders Realschule absolvierte. In kleinen Gruppen erstellten die 90 Jungen und Mädchen Collagen und eine Übersicht, welche finanziellen Posten für Miete, Lebensmittel, Versicherungen und Hobbys im Alltag anfallen. In einem virtuellen Lohnbüro erhielten die Teilnehmer im Anschluss einen Gehaltscheck, mit dem sie ihren erarbeiteten Kostenplan entsprechend decken mussten. Im Anschluss erhielten die Neuntklässler unter anderem wichtige Tipps zu Einsparungspotenzialen.
„Mit dem Projekt haben wir unsere Schüler für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisiert. Mit viel Spaß und in lockerer Atmosphäre haben sie so ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig es ist, dieses bewusst auszugeben und entsprechend einzuteilen. Zudem gewähren die beiden Tage einen realistischen Blick in die Zukunft und die Berufswahl“, Marie-Reinders-Schulleiter Jörg Skubinn.
Neben den klassischen Lehrinhalten ist es der Lehreinrichtung wichtig, die Jungen und Mädchen mit Projekten zur Berufsorientierung so lebensnah wie möglich auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten. Deshalb gehören zum Lebensplanungsseminar, das aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen vom 8. auf den 9. Jahrgang verlegt wurde, üblicherweise auch dreitägige Praktika. Dabei schnuppern die Mädchen in gewerblich-technische Berufe rein, während die Jungen soziale Berufe wie zum Beispiel in Kindergärten, Krankenhäusern oder Seniorenheimen kennenlernen.
„Die Praktika müssen in diesem Jahr coronabedingt leider entfallen. Aber die Jahrgangsstufe 9 wird im Februar 2021 ein dreiwöchiges Betriebspraktikum absolvieren. Darüber hinaus finden zahlreiche weitere Berufsorientierungsinformationstage statt“, so Skubinn.
Auch im Alltag legt die Hörder Realschule viel Wert darauf, nicht nur Wissen rund um den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Fähigkeiten wie Eigenständigkeit, Sozialkompetenz sowie Verantwortungsbewusstsein werden aktiv gefördert. Ein Angebot ist beispielsweise die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach. Im Rahmen der beliebten Qualifizierungsmaßnahme zeichnete die Marie-Reinders-Realschule erst kürzlich erneut 15 Jugendliche als Nachwuchs-Fußballtrainer aus.
Bildzeile: Was stelle ich mir für meine Zukunft vor? Und was kostet das Leben? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt des zweitägigen Lebensplanungsseminars, das die Jahrgangsstufe neun der Marie-Reinders Realschule absolvierte.
Foto: Stephan Schütze

Zusammen ein starkes und sauberes Stück Nordstadt – Schülervertretung dankt dem Reinigungsteam
Die Schülervertretung der Anne-Frank-Gesamtschule hat sich ganz herzlich bei dem Team der Reinigungskräfte bedankt. Sie würdigten die Mitarbeiterinnen als einen wichtigen Teil ihrer Schulgemeinschaft. Ihrer harter körperlicher Arbeit ist es zu verdanken, dass die Schule zu einem Lebensraum wird, in dem sich die Schüler wohlfühlen können. Gerade in Zeiten von Corona zeigt sich, dass ohne ihre Arbeit kein Schulbetrieb stattfinden könnte.
Foto: Anne Frank-Gesamtschule Dortmund

Verleihung der Ehrennadel der Stadt Dortmund an Prof. Dr. Detlef Müller-Böling
Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat heute im Rahmen einer Feierstunde im Dortmunder Rathaus Prof. Detlef Müller-Böling die Ehrennadel der Stadt Dortmund verliehen.
Rektor der Universität Dortmund von 1990 bis 1994 Detlef Müller-Böling wurde 1948 in Berlin geboren. Von 1981 bis 2008 war er Lehrstuhlinhaber für Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung an der Universität Dortmund.
In den Jahren 1990 bis 1994 war er Rektor der Universität Dortmund. Bereits zu seinem Amtsantritt hatte Prof. Müller-Böling den Strukturwandel Dortmunds im Blick. Er formulierte bereits damals das Ziel, durch die Arbeit der Universität Dortmunds Profil als „Wissenschaftsstadt“ zu schärfen und auszubauen.
Während seiner Amtszeit als Rektor der Universität Dortmund hat Prof. Müller-Böling u. a. durch die Internationalisierung der Uni, die Initiierung des Campusfestes sowie durch die Einführung der Universitätsmedaillen Akzente gesetzt und zur positiven Außenwirkung und Identitätsbildung der Dortmunder Hochschule beigetragen.
Hochschulreformer Darüber hinaus hat sich Prof. Müller-Böling von Anfang an zu einer wettbewerbsorientierten Steuerung der Universität bekannt. Durch die Einführung eines „Dortmunder Schlüssels“ hat er ein neues vorbildliches Modell der leistungsbezogenen Mittelverteilung etabliert. In seiner Amtszeit hat er außerdem die Einrichtung des Lehrstuhls für Gründungsforschung an der Dortmunder Universität unterstützt.
Offenheit, Herzlichkeit und Transparenz bei der Amtsführung waren die Markenzeichen Müller-Bölings, dem medial der Ruf als Hochschulreformer zuerkannt wurde. Seine Bodenhaftung hat der leidenschaftliche Segler auch als Rektor nie verloren. Regelmäßig stand er noch als Dozent im Hörsaal und legte Wert auf den unmittelbaren Kontakt mit den Studentinnen und Studenten.
Aufbau der Denkfabrik „CHE“ Nach Ende seiner Amtszeit als Rektor der Universität Dortmund baute er mit der Bertelsmann-Stiftung das gemeinnützige und unabhängige Centrum für Hochschulentwicklung (CHE gGmbH) in Gütersloh auf. Dieses arbeitet als „Denkfabrik“ an modernen Konzepten zur Hochschulreform. Es zielt darauf ab, mehr Autonomie, Vielfalt und Gesellschaftsbezug an deutschen Hochschulen zu erreichen und die Hochschulen insgesamt wettbewerbs- und leistungsorientierter auszurichten. Das CHE erstellt jedes Jahr ein oft zitiertes Hochschul-Ranking, welches als fundiertes Instrumentarium für Qualitätsprüfungen dient.
Fokus auf den Masterplan Wissenschaft der Stadt Dortmund Seinen Fokus auf Dortmund legte Prof. Müller-Böling erneut bei der Mitgestaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung des Masterplans Wissenschaft der Stadt Dortmund. Dieser verfolgt das Ziel, Dortmund noch stärker als Wissenschaftsstandort zu positionieren.
Von Mai 2011 bis Januar 2013 wurde in einem von Wissenschaft, Wirtschaft, Stadt und Stadtgesellschaft getragenen Prozess der Masterplan Wissenschaft der Stadt Dortmund erarbeitet. Dieser Prozess wurde von Prof. Dr. Müller-Böling als Moderator begleitet. Er gab Impulse, strukturierte und bündelte die Arbeit der mehr als 120 Teilnehmer*innen an dem Planungsprozess.
2013 wurde Prof. Dr. Müller-Böling offizieller Beauftragter der Stadt Dortmund für den Masterplan. Als Ideengeber und Moderator engagierte sich Prof. Müller-Böling ehrenamtlich und übernahm im Schulterschluss mit der Wissenschaftsreferentin und einer entsprechenden Arbeitsgruppe auch das Controlling bei der Umsetzung. Genau 100 konkrete Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern wurden erarbeitet, die sowohl zur Standortentwicklung und Vernetzung, als auch zur Steigerung der Forschungsleistung beitragen sollten. Die sechs Handlungsfelder umfassten die Stärkung und Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Kompetenzfelder ebenso wie eine moderne Campusentwicklung und die Verbesserung seiner Erreichbarkeit. Besondere Schwerpunkte lagen neben dem beidseitigen Wissenstransfer von Wissenschaft zur Wirtschaft (und umgekehrt) auch auf den gegenseitigen Einflussfaktoren von Stadtgesellschaft und Wissenschaft. Des Weiteren wurde der Fokus auf Rahmenbedingungen gelegt, welche einen attraktiven Hochschulstandort ausmachen, als auch auf eine effektive Marketingstrategie. Mehr als drei Viertel der Maßnahmen konnten bis dato tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden.
Positive Bewertung durch externe Gutachter Im Jahr 2018 wurde der Masterplan Wissenschaft einer Evaluation externer Gutachter unterzogen. Die Evaluation fiel insgesamt sehr positiv aus. Der Masterplanprozess wurde als einzigartig und vorbildhaft bewertet. Die Entwicklungsperspektiven der Stadt wurden mit dem Masterplan fruchtbringend weiterentwickelt und verfestigt. Gleichzeitig haben sich die Forschungsbedingungen und -ergebnisse der Dortmunder Wissenschaftler*innen durch die Zusammenarbeit deutlich verbessert. Eine Vielzahl der anvisierten Maßnahmen griff und konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden, nur noch ein kleiner Teil ist in Arbeit.
Der Masterplan Wissenschaft findet sein Laufzeitende am 31.12.2020 und wird vom „Masterplan Wissenschaft 2.0“ abgelöst, der zurzeit im Auftrag des Rates der Stadt Dortmund dialogorientiert in vier Themengruppen erarbeitet wird. Prof. Dr. Detlef Müller-Böling hat den Staffelstab an Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Waldmann, Professor für Chemische Biologie an der TU Dortmund und Direktor des Max-Planck-Instituts für molekulare Physiologie, übergeben, der die Arbeit mit ebenso großem Engagement weiterführt. Das Ziel ist, Dortmund als Wissenschaftsstadt weiter zu profilieren, die wissenschaftlichen Exzellenz und Vernetzung weiter auszubauen, die Wissenswirtschaft zu stärken und neue Formate und Diskussionsforen im Sinne einer „experimentellen Stadt“ zu entwickeln.
Ideale Besetzung Wie Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Gather, ehemalige Rektorin der TU Dortmund und Weggefährtin von Prof. Müller-Böling, in ihrer Laudatio beschreibt, war Prof. Müller-Böling durch seine Persönlichkeit als Kopf und Multiplikator die ideale Besetzung für den Masterplanprozess. Er verstand es, alle Mitwirkenden für das gemeinsame Ziel zu begeistern und ein Instrumentarium zu schaffen, welches international hohe Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten hat. Durch die Verknüpfung von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Zivilgesellschaft im Rahmen des Masterplanprozesses hat Prof. Müller-Böling die Zukunftsfähigkeit der Stadt aktiv mitgestaltet und die Sichtbarkeit Dortmunds als Wissenschaftsstandort nachhaltig geprägt.
Schon früh hat sich Prof. Müller-Böling dem Ziel verschrieben, Dortmund als Wissenschaftsstadt attraktiver zu gestalten, so auch mit der Gründung des Vereins windo e.V. im Jahr 1992. Der Verein bietet ein Netzwerk der universitären und außeruniversitären Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen in Dortmund mit dem Zweck der Förderung eines familienfreundlichen Bildungsstandortes.
Prof. Müller-Böling trug maßgeblich zu einem positiven Imagewandel der Stadt Dortmund bei und sorgt bis heute durch ehrenamtliches Engagement dafür, dass Dortmund als international anerkannter Wissenschaftsstandort wahrgenommen wird. Die Ehrennadel wird ihm für sein ehrenamtliches Engagement in diesem Zusammenhang verliehen.
Bildzeile: v.l. Christine Müller-Böling, Detlef Müller-Böling, OB Ullrich Sierau.
Foto: Katharina Kavermann/Stadt Dortmund

Nobby Dickel weiht Stufen-Hopper für Löwenzahn ein
Als der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn in das Hinterhaus an der Dresdener Straße zog, war klar, dass die Räume auf Dauer auch barrierefrei erreichbar sein müssen. Magnus Linnhoff fand mit dem ScalaMobil eine effiziente Lösung und überreicht dieses gemeinsam mit Stadionsprecher Nobby Dickel im Namen des Kraft Unternehmensverbundes.
Barrierefreies Bauen ist schon seit vielen Jahren eine Frage der Ehre für viele Bauherren. Aber es gibt auch Altbauten, bei denen es gar nicht so einfach ist, nachträglich für barrierefreie Erreichbarkeit zu sorgen. Die möglichen Lösungen sind oft verbunden mit hohem Aufwand und nicht unerheblichen Kosten. Ein Problem für Mieter im Bestand. Ein Beispiel hierfür ist der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn, der im November im Hinterhaus an der Dresdener Straße 15 ein neues Domizil fand, das allerdings einen Haken hat(te): es gibt keine ebenerdige Erreichbarkeit der Räumlichkeiten. Die Kosten für eine Rampe hätten das Budget des spendenfinanzierten Vereins gesprengt. Und auch motorbetriebene Außenfahrstühle sind zu teuer und zu aufwendig.
Zufällig erfuhr Magnus Linnhoff, Gesamtvertriebsleiter des Kraft von dem Problem und fand eine äußerst effiziente Lösung: den Treppensteiger „ScalaMobil“ für Rollstuhlfahrer, mit dem die Rollis unproblematisch über alle vorhandenen Treppen transportiert werden können. Er versprach, das System im Löwenzahn-Hinterhaus zu installieren – kostenlos. Das ist eine große Freude für das Team des Ambulanten Kinderhospizdienstes – die zwar häufig im Einsatz sind bei den Familien zuhause, jetzt aber auch zum barrierefreien Besuch der Räume einladen können.
„Für uns ist dies eine fantastische Erweiterung der Möglichkeiten vor Ort,“ freute sich Dietlinde Eberts, Koordinatorin von Löwenzahn. Julian Kraft, Leiter der Kraft Reha- und Orthopädie-Technik, weihte mit dem 17-jährigen Filip Ridjic das ScalaMobil gleich ein und führte die Technik vor. Mit von der Partie war BVB-Stadionsprecher Nobby Dickel, der dem Kraft Unternehmensverbund seit über 30 Jahren verbunden ist. Er war einer der ersten Patienten im Medizinischen Leistungs- und Rehabilitationszentrum Orthomed, welches seit 1989 neben der Kraft Reha- und Orthopädie-Technik den Verbund komplettiert.
„Ganz große Klasse,“ ist das Fazit von Löwenzahn-Koordinatorin Eberts, „das neue Gerät ist Platz sparend und vor allem müssen wir nun keine Rampe bauen.“ Das Gerät ist leicht zu bedienen und der besondere Clou daran ist: Man kann es äußerst flexibel einsetzen. „Wir können das ScalaMobil ins Auto packen und bei verschiedenen Aktivitäten vor Ort mit den Familien einsetzen. Das bietet behinderten Menschen die Möglichkeit, am kulturellen und gesellschaftlichen Leben Anteil zu nehmen, auch wo es keine barrierefreien Zugänge gibt.“
Den Dortmundern sind die einzelnen Bereiche des Unternehmensverbundes Kraft ein Begriff. Das alle drei unter einem Dach arbeiten und somit eine sektorenübergreifende Versorgung und Behandlung aus einer Hand ermöglichen, ist jedoch noch relativ unbekannt.
Die Orthopädietechnik und Sanitätshäuser Kraft, Kraft Reha- und Medizintechnik und das Medizinische Leistungs- und Rehabilitationszentrum Orthomed sorgen für Bewegung, wo es sonst Einschränkungen gibt.
Die Einweihung des ScalaMobils ist der Beginn einer weiterreichenden Kooperation zwischen Ambulantem Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn und dem Kraft Unternehmensverbund.
Bildzeile: Einweihung des ScalaMobils bei Löwenzahn, das der Unternehmensverband Kraft stiftete. Mit dabei war Julian Kraft, Magnus Linnhoff, Violete Ridjic und ihr 17-jähriger Sohn Filip sowie BVB-Stadionsprecher Nobby Dickel.
Foto: Forum Dunkelbunt e.V.

St.-Johannes-Hospital Dortmund implantiert weltweit erstmalig nach Zulassung neue Herzklappe
Studie zu ACURATE neo2 wurde bereits im JoHo geleitet
Chefarzt Prof. Dr. Helge Möllmann war bereits Studienleiter der weltweit ersten Studie, die die neue Aortenklappe in der Zulassungsstudie untersucht hat. Wirksamkeit und Sicherheit sind abschließend bewiesen, so dass nun erste Patienten im JoHo mit großem Erfolg versorgt wurden.
Renate B., 82 Jahre, litt unter Atemnot schon bei leichter Belastung und einmal war die Patientin sogar schon ohne Vorwarnung kurz ohnmächtig geworden. Dies schränkte natürlich die Lebensqualität deutlich ein und hielt sie von Aktivitäten fern. Sie entschied sich auf Anraten von Professor Helge Möllmann, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I, für den Einsatz der neuen Aortenklappe, die minimal-invasiv durch Kathetertechnik eingesetzt werden kann. Das neue System war passgenau für sie geeignet: Acurate Neo2 heißt die Herzklappenprothese, die nun die Funktion der kaputten eigenen Herzklappe übernimmt. „Ich bin sehr überrascht, wie komplikationslos und schnell die Behandlung im JoHo funktioniert hat. Die OP habe ich machen lassen, weil ich meine Familie liebe und ich noch lange Zeit für sie da sein möchte. Ich blicke jetzt hoffnungsvoll in die Zukunft“, lacht sie wenige Tage nach dem Eingriff.
Doch wie funktioniert solch ein Einsatz? Prof. Möllmann erklärt die Erkrankung und das Therapieverfahren so: „Mit zunehmendem Alter kann es zu einer Verkalkung der Segel der Herzklappe führen, was das Öffnen und Schließen der Klappe beeinträchtigt. Die sogenannte Aortenklappenstenose ist die häufigste Herzklappenerkrankung. Dabei handelt es sich um eine krankhafte Verengung der Herzklappe am Übergang vom Herzen zur großen Hauptschlagader, die zu einer schweren Herzschwäche führen kann. Das TAVI-Verfahren, bei dem über einen Spezialkatheter eine neue Aortenklappe über die Oberschenkelarterie bis zum Herz vorgebracht und dort implantiert wird, hat sich inzwischen als schonendere Therapieoption etabliert,“ so Möllmann.
Die Vorteile liegen auf der Hand, denn die kurze Dauer des Eingriffs, das Fehlen einer Vollnarkose und die im Vergleich zu einer Operation am offenen Herzen deutlich niedrigere Belastung für den Patienten bedeutet, dass diese häufig schon wenige Tage nach der Implantation das Krankenhaus wieder verlassen können. So wird Renate B. nach wenigen Tagen bereits wieder zuhause ihren gewohnten Dingen nachgehen können.
Kathetergeführte Herzklappen-Eingriffe werden im Herzteam des St.-Johannes-Hospitals über 750 Mal pro Jahr vorgenommen. Was ist so neu an diesem System Acurate neo2? „Dieses TAVI-System hat unter anderem ein neues Dichtungssystem, das sich auch komplexen anatomischen Bedingungen anpassen kann und damit noch deutlich komplikationsloser ist“, weiß Prof. Möllmann.
Bildzeile: Renate B. freut sich über die neue Lebensqualität dank Einsatzes der Herzklappe. Mit im Bild ist der Chefarzt der Kardiologie im JoHo Prof. Dr. Helge Möllmann.
Foto: JoHo Dortmund

Aufsichtsrat von DSW21 bestätigt Guntram Pehlke als Vorstandsvorsitzenden
Chef der Dortmunder Stadtwerke AG bleibt weitere fünf Jahre im Amt
In seiner Sitzung Ende September hat der Aufsichtsrat der Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) Guntram Pehlke mit breiter Mehrheit für weitere fünf Jahre zum Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzenden der Aktiengesellschaft sowie zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Stadtwerke Holding GmbH wiederbestellt. Pehlkes fünfte Amtszeit beginnt am 1. Juli 2021. Dem Unternehmensverbund gehört er seit Juli 2006 an und übernahm am 1. Oktober 2006 den Vorsitz im DSW21-Vorstand. Zuvor war Pehlke ab 2000 Kämmerer der Stadt Dortmund.
OB Sierau setzt sich für Steuerungsfunktion des Rates ein
Als Vorsitzender des DSW21-Aufsichtsrates machte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau deutlich, dass die einschlägigen Bestimmungen des Aktiengesetzes und des Mitbestimmungsgesetzes die Regelungen der Gemeindeordnung NRW überlagern (Bundesrecht bricht Landesrecht). Danach wird der Vorstand von DSW21 durch den Aufsichtsrat bestellt. In seiner Rolle als Vorsitzender des Rates setzt Sierau sich dennoch für die Steuerungsfunktion der politischen Vertretung ein. Auch Guntram Pehlke erklärt, ihm sei es „sehr wichtig, dass der Rat der Stadt Dortmund zu meiner Bestellung votiert. Gewünscht hätte ich mir ein solches Votum schon vor der Aufsichtsratssitzung“. Aufgrund der zeitlichen Abläufe wird das Thema nun in der nächsten Ratssitzung am 8. Oktober 2020 behandelt.
Stadtwerke-Konzern seit 2006 konsequent strategisch neu ausgerichtet
Pehlke, der im Sommer seinen 60. Geburtstag feierte, hat den Stadtwerke-Konzern in den zurückliegenden 14 Jahren strategisch neu ausgerichtet. In seine Amtszeit fallen u.a. die Restrukturierung des Tochterunternehmens DEW21, die Konsolidierung städtischer Töchter wie der Wohnungsgesellschaft DOGEWO21, die Etablierung von DOKOM21 als innovativem und leistungsstarkem Treiber der Digitalisierung sowie die erfolgreiche Realisierung einiger Leuchtturm-Projekte der Stadtentwicklung (Phoenix-See, Stadtkrone-Ost, Hohenbuschei).
Auch die wirtschaftlich positive Entwicklung am Dortmund Airport21 hat Pehlke als dessen Aufsichtsratsvorsitzender eng begleitet. Der Flughafen konnte sein operatives Defizit im Jahr 2019 bei einem Rekord von 2,72 Millionen Fluggästen auf 0,4 Mio. € reduzieren und wäre ohne die negativen Effekte der Corona-Pandemie 2020 erstmals in die Gewinnzone geflogen.
Darüber hinaus hat Guntram Pehlke die Dortmunder Stadtwerke mit den Beteiligungen an DEW21, RWE, Steag und neuerdings auch Eon als Player in der Energiebranche breit aufgestellt. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Hubert Jung (Verkehr), Jörg Jacoby (Finanzen) und Harald Kraus (Personal) manövriert er DSW21 seit Jahresbeginn sehr umsichtig und erfolgreich durch die Corona-Krise.
Foto: DSW21/Christian Bohnenkamp

Fachtagung im Dietrich-Keuning-Haus: Unterbringung und Zwang – Muss das denn sein?
Die Unterbringung und Behandlung von seelisch kranken Menschen gegen ihren Willen war das zentrale Thema einer Fachtagung der Überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Betreuungswesen NRW (ÜGA NRW) in Kooperation mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Dortmund im Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund.
Mit diesem sensiblen und oftmals auch kontrovers diskutierten Thema beschäftigten sich Berufsbetreuer, Mitarbeiter*innen aus den Betreuungsbehörden und Amtsgerichten sowie Vertreter*innen der Betroffenenverbände bzw. Psychiatrie-Erfahrenen.
Unterbringung und Behandlung nach dem Betreuungsrecht ohne Zustimmung bedeuten einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Menschen. Um diesen schon sehr schwerwiegenden Eingriff auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, ist es erforderlich, die Zusammenarbeit der an der Unterbringung beteiligten Personen zu optimieren und die Sichtweise der Betroffenen zu kennen bzw. deren Wünsche zu berücksichtigen.
Neben dem Unterbringungsgeschehen wurde der Frage nachgegangen, inwieweit Zwangsmaßnahmen und Unterbringungen generell vermieden werden können. Dabei wurden ebenso rechtliche und medizinische Aspekte sowie interessante Ansätze aus dem Bereich der Betreuung demenziell erkrankter Menschen vorgestellt.
Die Relevanz des Themas spiegelte sich ebenfalls bei der Anmeldung wider. Trotz der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln war die Veranstaltung mit 90 Teilnehmer*innen aus ganz NRW bereits nach drei Tagen ausgebucht.
Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite: www.ueag-nrw.org



