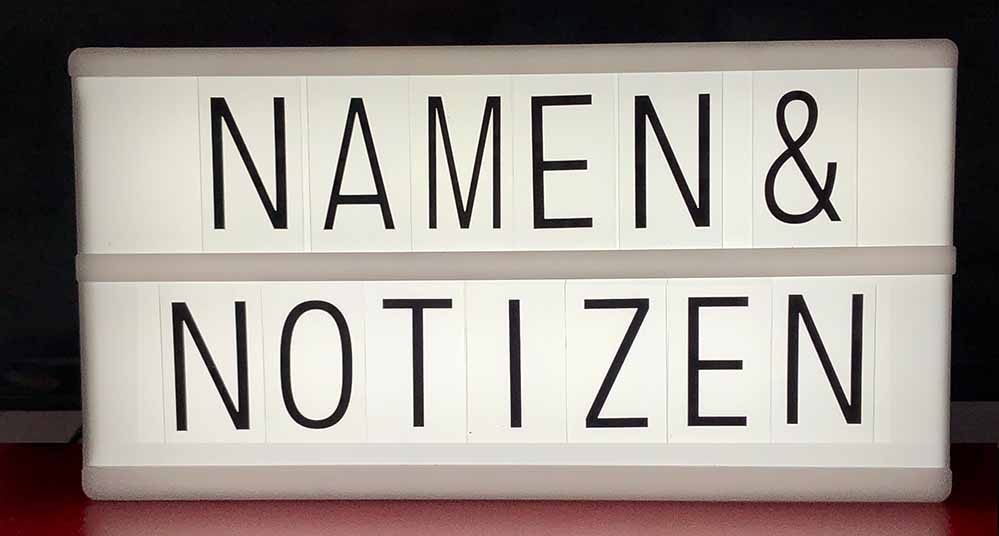 Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“
Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“
Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Protest- und Fotoaktion zum Internationalen Frauentag.
Mehr Geld und Tarifbindung bei der AWO
Im Rahmen der laufenden Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft ver.di und den Arbeitgebern der AWO in Nordrhein-Westfalen führten die Beschäftigten des AWO Minna-Sattler-Seniorenzentrums in Dortmund am Montag (8.3.) eine Protest- und Fotoaktion durch.
Am internationalen Frauentag setzen sie sich für eine Aufwertung der sozialen Berufe bei der AWO ein, die noch immer mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden.
In der laufenden Tarifrunde fordert ver.di einen Mindestbetrag von 75 Euro, um die unteren Entgeltgruppen gezielt zu stärken.
„Auch bei der AWO zeigt die Pandemie deutlich, das Soziale Arbeit, Erziehung und Pflege für unsere Gesellschaft überlebenswichtig und oft weiblich sind. Diese Arbeit verdient es aufgewertet zu werden. Gleichzeitig arbeiten überwiegend Frauen in Teilzeit, oft ungewollt. Der Druck durch psychische Überlastung und Personalmangel ist groß. Wir brauchen deshalb dringend einen starken Tarifabschluss, der die Lücke zum TVöD schließt. Nur so kann die AWO als Arbeitgeber wettbewerbsfähig bleiben. Ein TVöD-light reicht uns nicht!“, erklärt Marc Kappler, Gewerkschaftssekretär ver.di Westfalen.
Bei der AWO in NRW sind rund 60.000 Menschen beschäftigt. Nur ca. 35.000 von ihnen fallen unter den Tarifvertrag AWO NRW. „Wenn in einem Unternehmen unterschiedliche Tarifverträge gelten, spaltet das die Belegschaften. Das sorgt für Unmut. Die Pandemie beweist, welchen Beitrag Tarifvertragsparteien zur Bewältigung der Krise leisten. Außerdem gibt es viele Betriebe der AWO in NRW, die gar nicht tarifgebunden sind. Wir fordern die Arbeitgeber deshalb auf, sich gemeinsam für die flächendeckende Tarifbindung einzusetzen – so wie es die AWO zu ihrem 100-jährigen Jubiläum verkündet hat. In NRW haben wir den AWO-Tarifvertrag“, mahnte Susanne Hille, ver.di Verhandlungsführerin für den AWO Tarifvertrag.
Die zweite Verhandlungsrunde findet am 17. März 2021 als digitaler Termin statt.
Foto: ver.di

Osterferien: Bau eines Solarkatamarans und CoBiKe 4.0-Workcamp im KITZ.do
Dortmund/NRW 05.03.2021: KITZ.do, das Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 14 Jahren wieder das beliebte, viertägige Workcamp CoBiKe 4.0, diesmal unter dem Motto „Wir haben nur diese eine Stadt“ an. Das Workcamp zur Berufsorientierung steht ganz im Zeichen zukünftiger Stadtentwicklung: Vom Kleinstökosystem bis zu globalen Klimaphänomenen untersuchen und erforschen die Teilnehmer draußen in der Natur und in der Stadt die Zusammenhänge zwischen Boden, Gewässer und Klima. Welche Zusammenhänge wirken dabei auf das Stadtklima und wie wirkt sich Stadtklima auf das globale Klima aus? Dabei lassen sich eine Vielzahl von spannenden Berufsbildern entdecken, vom Klimamanager über Laborberufe bis hin zum Garten- und Landschaftbauer. Das Workcamp findet statt vom 29. März-1. April, täglich in der Zeit von 10:00-14:00 Uhr. Die Teilnahme ist dank der Förderung durch die Wilo Foundation kostenlos, eine Anmeldung unter www.kitzdo.de ist erforderlich und verbindlich.
Im Workshop Bau eines Solarkatamarans erbauen handwerklich begeisterte Kinder zwischen 9 bis 13 Jahren aus zwei gleichgroßen PET-Flaschen und einem Solarmodul – von DEW21 kostenlos zur Verfügung gestellt – ihren eigenen Solar betriebenen Katamaran. Der eintägige Workshop findet jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr am 6., 7., 8. und 9. April statt, eine Anmeldung unter www.kitzdo.de ist erforderlich, die Teilnahme kostenlos.
Als drittes Angebot begrüßt KITZ.do in der zweiten Ferienwoche wieder die Kinder der CLIMB-Lernferien. Vom 6.-9. April forschen, experimentieren und werken sie altersgerecht zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen.
Ausführliche Informationen zu den Angeboten und Anmeldungen unter www.kitzdo.de oder telefonisch 0231 476 469 30 sowie unter info@kitzdo.de.
V.i.S.d.P.: Sylke Herberholt, Kommunikation KITZ.do, herberholt@kitzdo.de, 0231 476 469 30
Bildzeile: Im Workshop Bau eines Solarkatamarans erbauen handwerklich begeisterte Kinder ihren eigenen Solar betriebenen Katamaran.
Foto: DEW21

Gemeinschaftliches Gärtnern in den ‚Lütgegärten‘
In Lütgendortmund entstehen auf einem 2.500 Quadratmeter großen parkähnlichen Gelände am Wohn- und Pflegezentrum St. Barbara die „Lütgegärten“. Hier soll sich ein Projekt von Gemeinschaftsgärten im Stadtteil entwickeln, das Quartiersmanager Benedikt Gillich von der Caritas Dortmund betreut. Aktuell sucht er Familien und Gruppen mit Lust auf einen Garten in der Stadt.
Der Maulbeerbaum ist schon gepflanzt, die weißen und schwarzen Johannisbeeren auch. Benedikt Gillich steht im Beeren-Kreisel, einem von zehn Orten auf dem großen Areal, die im Rahmen des Projektes „Lütgegärten“ gestaltet werden. „Eigentlich hätten hier schon Familien mitarbeiten sollen“, erklärt er. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie sei das aber noch nicht möglich. So pflanzen derzeit die Mitarbeiter der Caritas-Dienstleistungsbetriebe die ersten neuen Bäume und Sträucher, weil die Natur nicht auf ein Ende von Kontaktbeschränkungen wartet.
Zugang zur Natur
Warten möchte auch Benedikt Gillich nicht und wirbt bereits jetzt im Stadtteil Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Projekt, das modern auch als „Urban Gardening“ bezeichnet wird. Menschen, die nicht über einen eigenen Garten verfügen, sollen Natur im Stadtraum erfahren können. „Der Zugang zur Natur gehört zu einer gleichberechtigten Teilhabe am Alltag dazu“, erläutert der studierte Raumplaner. Gefördert wird das Projekt des Quartiersmanagements „Wir im Quartier“ und der Caritas Altenhilfe Dortmund GmbH aus Mitteln des Fonds für innovative Projekte des Erzbistums Paderborn und durch die Sparkasse Dortmund.
Neben dem Beeren-Kreisel befindet sich eine Wiesenfläche. „Diese werden wir als Ackerfläche nutzen“, kündigt Gillich an. Daran anschließend sollen Bienenvölker ihr Zuhause finden. Geplant sind außerdem ein Bauerngarten, Gemüse- und Hochbeete, ein Teich sowie eine Belebung der vorhandenen Streuobstwiese, des Grillplatzes und der Unterstände.
Bildung und Kultur
Natur, Begegnung, Bildung und Kultur soll das Projekt bieten. Dazu möchte der Quartiersmanager verschiedene Gruppen aus dem Stadtteil zusammenführen. Schulklassen könnten den Garten als außerschulischen Lernort nutzen, Familien eigenes Gemüse und Kräuter anbauen, Jugendgruppen, wie etwa Pfadfinder oder Messdiener, könnten Patenschaften für bestimmte Bereiche oder Bäume übernehmen. Auch Flüchtlinge aus den Unterkünften am Grevendicks Feld will Benedikt Gillich auf eine Mitarbeit in den „Lütgegärten“ ansprechen. Neben dem Gärtnern könnte es Konzerte und Kleinkunst geben. „Interreligiös, interkulturell und generationsübergreifend“, solle das Projekt sein. Geplant ist auch ein interreligiöser „Ort der Ruhe“, der zum Verweilen und zur Meditation einlädt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums St. Barbara sowie die Mieterinnen und Mieter der 80 Wohneinheiten auf dem Gelände werde die Entwicklung des Gartens viel Abwechslung bieten und sie könnten sich nach ihren Möglichkeiten beteiligen.
Eigentlich wollte Benedikt Gillich das Projekt in diesem Jahr mit einem Fest am Osterfeuer eröffnen. Das scheint angesichts der aktuellen Situation allerdings kaum möglich. „Vielleicht wird es ein Pfingstfeuer“, hofft er. Interessierte, die bei den „Lütgegärten“ als Familie oder Gruppe mitmachen möchten können sich melden bei:
Benedikt Gillich
Quartiersmanager
Tel. 01525 3405428
E-Mail: benedikt.gillich@caritas-dortmund
Bildzeile: Im Beeren-Kreisel der „Lütgegärten“ am Wohn- und Pflegezentrum St. Barbara sind schon die ersten Büsche gepflanzt. Quartiersmanager Benedikt Gillich sucht aktuell Familien und Gruppen, die sich an dem Projekt beteiligen möchten.
Foto: Michael Bodin / Erzbistum Paderborn

„Handwerk als Motor für Wohlstand und Innovation“
Stv. NRW-Ministerpräsident Dr. Joachim Stamp schickte
Videobotschaft zur digitalen Meisterfeier der HWK Dortmund
„Wenn uns die vergangenen Monate etwas beigebracht haben, dann, flexibel und einfallsreich zu sein. Und darum feiern wir heute die erste, komplett digitale Meisterfeier in der Geschichte der Handwerkskammer (HWK) Dortmund und gratulieren auf ungewöhnliche aber nicht minder herzliche Art. Denn leider lässt die aktuelle Situation im Moment nichts Anderes zu.“ Mit diesen Worten stimmte Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund, die 325 Jung-meister*innen aus ganz Deutschland sowie zahlreiche Teilnehmer im Live-Stream auf ein besonderes Event ein, das es in dieser Form noch nicht gab.
Um der üblichen Großveranstaltung im Dortmunder Konzerthaus in nichts nachzustehen, wurde den Zuschauern ein gut gefülltes Programm geboten mit starken Worten, Bildern und Videos sowie Live-Musik, direkt aus dem Streaming-Studio im Bildungszentrum Hansemann. Im Fokus standen dabei immer die Hauptpersonen des Tages – die Meister*innen.
In einer Videobotschaft betonte der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Joachim Stamp: „Im Namen der Landesregierung gratuliere ich allen Meisterinnen und Meistern ganz herzlich. Sie stehen dafür, dass man auch in diesen schwierigen Zeiten etwas bewegen und voranbringen kann. Sie bringen genau den Schwung und den Optimismus mit, den wir brauchen, um gut durch diese Pandemie zu kommen und einen Neustart zu schaffen in der Zeit danach. Die Landesregierung wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass das Handwerk als Motor für Wohlstand und Innovation die besten Bedingungen für Wachstum und Weiterentwicklung in Nordrhein-Westfalen hat.“
Im Interview mit Moderatorin Sabine Ziemke sprachen HWK-Präsident Berthold Schröder und HWK-Hauptgeschäftsführer Carsten Harder unter anderem über die intensive Suche nach Fach- und Nachwuchskräften. „Im Kammerbezirk hatten wir Ende 2020 ein Defizit von 12,3 Prozent (-496 Ausbildungs-verhältnisse) bei den neu abgeschlossenen Lehrverträgen“, so Schröder. Gründe dafür seien beispielsweise weiterwachsendes Interesse an akademischer Bildung, demografische Entwicklungen und, natürlich, die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Schröder: „Viele persönliche Wege, auf denen man Jugendliche erreicht, wie in Schulen, durch Praktika oder auf Berufsorientierungsmessen, sind momentan nicht oder kaum zugänglich. Dabei ist die Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe ungebrochen. Wir müssen umdenken und neue, digitale Möglichkeiten der Begegnung schaffen. Wenn wir heute nicht ausbilden, wird sich dieser Mangel weiter verschärfen und dann fehlen uns nicht nur dringend benötigte Experten, sondern auch diejenigen, die Betriebe übernehmen oder neu gründen.“
Bei der Digitalisierung werde der Veränderungsdruck für die Betriebe weiter zunehmen, so der HWK-Präsident. Hier komme es in den nächsten Jahren darauf an, die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation von Seiten der HWK Dortmund bestmöglich zu unterstützen. „Neben zahlreichen Beratungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten ist aber auch ein flächendeckender Breitbandausbau von Nöten, damit die Betriebe das volle Potential der Digitalisierung nutzen können“, sagte er. Corona habe zudem gezeigt, dass vor allem die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung einen Schub benötige.
In der aktuellen Pandemie-Situation habe das Handwerk trotzt aller Hürden als stabilisierendes Element in der Krise fungiert und unter Beweis gestellt, dass Arbeitsplätze weitestgehend krisensicher seien, hob HWK-Hauptgeschäftsführer Carsten Harder hervor. „Nicht zuletzt wegen seiner stabilen Konjunktur vor der Pandemie konnte das Handwerk in vielen Bereichen auf volle Auftragsbücher und Reserven zurückgreifen. Viele Handwerker arbeiteten durch, auch wenn andere Handwerksbranchen stark unter den Corona-Einschränkungen gelitten haben wie die Friseure, Kosmetiker, der Kfz-Verkauf oder das Lebensmittelhandwerk.“ Da das Handwerk zum größten Teil aus kleinen und mittleren Betrieben bestehe, sei der innerbetriebliche Zusammenhalt zudem sehr stark.
Für die Bestmeister*innen, die normalerweise live auf der Bühne geehrt werden, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: Die 4 Bestmeisterinnen und 14 Bestmeister des Prüfungsjahrgangs 2020 wurden vorab mit Foto- und Videokamera besucht. Die Videos wurden beim Live-Stream gezeigt.
Carsten Gerrit Renker, Dachdeckermeister aus Wuppertal, wurde als bester Bestmeister mit einem Scheck der Dortmunder Volksbank geehrt, überreicht vom Vorstandsvorsitzenden Martin Eul. Im Namen des Soroptimist Clubs Dortmund überreichte Präsidentin Dr. Monika Goldmann einen Scheck an Orthopädietechnikermeisterin Cora Weimer aus Fernwald. Beides wurde in Filmen gezeigt, die vor der Meisterfeier gedreht worden waren.
Bildzeile: Moderatorin Sabine Ziemke, HWK-Präsident Berthold Schröder und HWK-Hauptgeschäftsführer Carsten Harder.
Foto: Andreas Buck/ HWK Dortmund
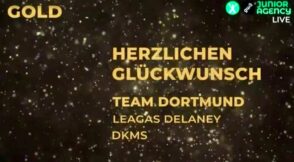
GWA Junior Agency Award: WAM Die Medienakademie Dortmund und Leagas Delaney holen GOLD mit Arbeit für die DKMS
Großer Jubel in Dortmund und Hamburg: mit einer Arbeit für die DKMS gewannen das Studententeam der WAM Medienakademie Dortmund und ihre betreuende Agentur Leagas Delaney Gold beim GWA Junior Agency Award, Deutschlands anspruchsvollstem Hochschulwettbewerb für Marketingkommunikation.
Studierende aus den Bereichen Marketing und Design verschiedener Hochschulen erarbeiten seit 2002 gemeinsam mit Werbeagenturen jeweils ein Semester lang Kommunikationslösungen und Kampagnen für reale Kunden und Herausforderungen.
Die Agenturen begleiten und coachen den Prozess.
Die Arbeit der Dortmunder Studierenden basierte auf einem Briefing von Leagas Delaney für die gemeinnützige Organisation DKMS. Die Agentur hatte erst kürzlich die DKMS im Rahmen einer deutschlandweiten Kampagne kommunikativ neu positioniert – als „Club, der jeden Tag das Leben feiert“. Die Aufgabe an das Team: gebt dem Club eine digitale Heimat, mit inspirierendem Content für junge Menschen, vor allem für die wichtige Zielgruppe junger Männer. Und helft mit, dass sie sich mit dem Thema Blutkrebs beschäftigen und sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.
Die zehn Studierenden der WAM entwarfen unter Leitung von Christiane Jasper, Mitglied der WAM Akademieleitung, ein umfangreiches Konzept, das junge Menschen über eine digitale Contentplattform an das Thema Stammzellspende heranführt. Unter dem Motto „Wir feiern dich!“ holt die Plattform Jugendliche zunächst in ihrer Lebenswelt ab und stellt positive Aspekte des Lebens in den Mittelpunkt. Erst im zweiten Schritt soll die Relevanz des Themas deutlich gemacht und die User für eine Registrierung als potenzielle Stammzellspender gewonnen werden.
Zudem entwickelten sie unter Leitung von Inez Koestel, Direktorin der WAM, ein Designkonzept namens „one line“, das das bestehende DKMS Corporate Design weiterführt und ganz neue Möglichkeiten zur Personalisierung eröffnet.
In einer rein digitalen Präsentation präsentierten Emma Möllenbrock und Tim Alexander Schreiber in einem aufwendig gestalteten Pitchfilm ihre Ideen, die die Jury sowohl inhaltlich als auch von der Art der Darstellung absolut überzeugten.
So lobte die Jury die Studenten besonders dafür, dass sie ein so schweres, ernstes Thema sehr leicht und spielerisch umgesetzt hatten. Zudem trugen die exakte Analyse der Zielgruppe und die passgenauen Ideen und gewählten Kanäle zum Sieg der Dortmunder in diesem Wettbewerb bei.
Tim Alexander Schreiber, Teamlead im Studententeam: „Die Aufgabe, neben den täglichen Vorlesungen und Präsentationen eine Kampagne für den GWA zu entwickeln, war für uns eine besondere Herausforderung und wir sind stolz, dass wir diese so gut meistern konnten.“
Johannes Appel, Senior Art Director bei Leagas Delaney: „Wir sind absolut begeistert von der Zusammenarbeit und dem Ergebnis. Und vielleicht lassen sich einige der Ideen ja auch gemeinsam umsetzen – wir unterstützen das gerne.“
Insgesamt vier Hochschulteams hatten sich der Jury aus Agenturmanagern, Marketing-Experten aus Unternehmen, Professoren und Journalisten gestellt. Neben der Hochschule Dortmund bewarben sich Teams aus Darmstadt (mit Leo Burnett), Düsseldorf (mit TBWA) und Mannheim (mit Philipp & Keuntje) um die begehrte Auszeichnung. Neben dem Jurypreis konnte sich die Hochschule Darmstadt den Publikumspreis sichern.

Neue Einsatzleitwagen für die Feuerwehr
Fünf neue Einsatzleitwagen (ELW) unterstützen den Bereich Führung und Lenkung der Feuerwehr Dortmund bei ihrem täglichen Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung in unserem Stadtgebiet. Oberbürgermeister Thomas Westphal hat heute gemeinsam mit Rechtsdezernent Norbert Dahmen und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner die neuen Fahrzeuge direkt von den Herstellern in Empfang genommen. Die neuen ELW werden ab sofort im gesamten Stadtgebiet durch die übergeordneten Führungsdienste zentral von der Hauptfeuerwache an der Steinstraße in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst eingesetzt.
Gute Wartung zögerte Neuanschaffung heraus
Vier der neuen ELW ersetzen die Vorgängerfahrzeuge aus dem Jahr 2003. Die ursprüngliche Ersatzbeschaffung der Führungsfahrzeuge war eigentlich für das Jahr 2013 geplant. Durch die gute Wartung und Pflege der Fahrzeuge konnte die Wiederbeschaffung jedoch hinausgezögert werden. Die Kosten für die Beschaffung der fünf neuen Fahrzeuge belaufen sich auf insgesamt 1,1 Millionen Euro. Die Neubeschaffung wurde bereits im Jahre 2016 durch die Einrichtung eines Arbeitskreises angestoßen. Im Jahre 2018 wurde dann ein europaweit offenes Vergabeverfahren eingeleitet, bei dem die Unternehmen BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH und Mercedes Benz den Zuschlag erhalten haben.
Umweltschonender und smart verbunden
Die neue Fahrzeuggeneration verfügt über aktuelle Fahrassistentensysteme, mit den die Fahrzeuge die Führungskräfte sicher und schnell an den Einsatzort bringen und somit der Bevölkerung schnellstmöglich helfen können. Effektiv sind die Fahrzeuge auch in Bezug auf die Motorengeneration, die neben der erforderlichen Leistung auch die aktuellen EURO 6 Auflagen erfüllt und somit wesentlich umweltschonender als die bisherigen Fahrzeuge eingesetzt werden können. Die Funkausstattung umfasst sowohl den Digitalfunk als auch den Bereich Analogfunk und mit der Vorrüstung zur Einbindung eines Tablets können in Zukunft auch Einsatzinformationen digital und zeitnah bereitgestellt und verarbeitet werden. Zudem können Lagebesprechungen durch geeignete Medientechnik und Anbindung von externen Signalquellen, wie beispielsweise Drohnenbildern, effizient abgehalten werden.
Führungsfahrzeug für Großschadenslagen
Der fünfte neue Einsatzleitwagen ist zusätzlich für größere und komplexe Einsatzstellen beschafft worden. Hierbei handelt es sich um ein Fahrzeug auf einem 12 Tonnen LKW-Fahrgestell mit einen Kofferaufbau, der in zwei Bereiche aufgeteilt ist. Einer dieser Bereiche dient als abgesetzter Funkarbeitsraum mit drei Arbeitsplätzen, der andere dient als Führungs- und Besprechungsraum mit acht Arbeitsplätzen. Das Fahrzeug wird durch Personal der Einsatzleitstelle besetzt und steht rund um die Uhr der Einsatzleitung zur Verfügung. Das Fahrzeug schließt die Lücke zwischen den kleinen mobilen Einsatzleitwagen auf Sprinter-Basis und dem bereits seit 2005 im Dienst befindlichen Einsatzleitwagen 3 auf Sattelzug-Basis. Dieser wird nach einer bereits erfolgten Generalüberholung im letzten Jahr zukünftig durch den Fernmeldezug der Freiwilligen Feuerwehr besetzt und für Großschadenslagen, geplante Einsatzereignisse sowie zeitlich ausgedehnte Einsatzlagen bereitstehen.
Bildzeile: Oberbürgermeister Thomas Westphal hat gemeinsam mit Rechtsdezernent Norbert Dahmen und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner die fünf neuen Fahrzeuge in Empfang genommen.
Foto: Stadt Dortmund

Vonovia: Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in Schüren
In der Nähe des Phoenix-Sees entsteht in Dortmund-Schüren neuer Wohnraum: Vonovia baut an der Meinbergstraße 38 und 38a zwei Mehrfamilienhäuser mit fünf beziehungsweise sechs Wohnungen sowie insgesamt elf Stellplätzen. Die Baukosten betragen rund drei Mio. Euro.
Klimaschonende und barrierearme Wohnungen
Die barrierefreien 2- bis 4,5 Zimmer-Wohnungen sind zwischen 54 und 132 Quadratmeter groß und verfügen über Balkon oder Terrasse. Darüber hinaus sind sie mit Fußbodenheizung sowie elektrischen Rollläden ausgestattet und können über Aufzüge erreicht werden. Mehr als die Hälfte aller Wohnungen verfügen neben den barrierefreien Duschen ebenfalls noch über eine Badewanne. Die Gebäude sind zudem mit E-Ladesäulen vorgerüstet. Beim Bau legt Vonovia besonderen Wert auf Nachhaltigkeit: Die Gebäude werden mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe versehen, die ohne fossile Brennstoffe auskommt. Insgesamt werden die Gebäude in die Energieeffizienzklasse A+ eingruppiert.
Neuer Wohnraum ab März 2022
„Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten bis März kommenden Jahres dauern werden“, erläutert Ralf Peterhülseweh, Regionalbereichsleiter von Vonovia in Dortmund. „Mit der Vermarktung werden wir rund sechs Monate vorher beginnen.“ Die Arbeiten an den beiden Mehrfamilienhäusern haben im November 2020 begonnen.
Mietinteressenten können sich melden bei: Dennis Päsler
+49 1525 6880207, Dennis.Paesler@vonovia.de.
Dortmund ist der größte Standort von Vonovia in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen besitzt dort insgesamt etwa 20.000 Wohnungen, rund 260 davon im Stadtteil Schüren.
Bildzeile: Die Planungsansicht zeigt die späteren Fassaden der Neubauten auf der Meinbergstraße.
Visualisierung: Vonovia

Der BVB/21-Tower als Markenleuchtturm am Airport
Einzigartiges Puzzle aus 236 Einzelfolien bildet die Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und der 21-Gruppe ab
Er ragt 14 Meter in die Höhe, ist Tag und Nacht besetzt und durch das rotierende Positionslicht auf dem Dach (15,7 Meter) ein echter Hingucker: der Airport-Tower. Fünf Millionen Autos passieren pro Jahr die viel befahrene Chaussee zwischen Unna und Dortmund, hinzu kommen in normalen Zeiten mehr als zwei Millionen Passagiere, für die der Tower wie ein Leuchtturm für die sichere Fahrt aus oder in den Hafen steht. Diese Landmarke wird im Markenjahr 2021 nun erstmalig vollflächig mit einer gemeinsamen Markenbotschaft von BVB und 21 verschönert. Mindestens bis zum Jahresende bekommen alle BVB-Fans ihren Tower in der 21-schwarz-gelben Ansicht.
Mehr als 150 Quadratmeter Folie mussten bedruckt und aufgebracht werden. Matthias Lick von der Firma Lichtreklame Friedrich & Lick GmbH aus dem Dortmunder Hafen: „Eine ganz besondere Herausforderung. Denn auch der Kragen oben am Tower musste beschriftet werden. Zudem galt es, das Original-Gelb des BVB wetterfest umzusetzen – auch hierfür waren allein vier Andrucke und Materialanpassungen notwendig. Aber wenn es so viele Menschen sehen, muss es auch gut sein.“
Guido Miletic, Leiter Marketing und Sales am Dortmund Airport 21, ergänzt: „Das ist der einzige Tower eines internationalen oder nationalen Airports, der jetzt komplett als Werbefläche genutzt wird, ein echtes Unikum und natürlich Ausdruck der Leidenschaft von Dortmund, immer etwas anders als die anderen zu sein.“
Auf dem Tower sieht man die Rückennummer 21 sowie BVB, Dortmund und DSW21. Dieser Dreiklang bringt Dortmund nach vorne. Die Platzierung am Tower des Flughafens ist Ausdruck der Verbundenheit aller Partner untereinander. Carsten Cramer, Geschäftsführer BVB: „Vom Dortmund Airport starten wir zu den internationalen Wettbewerben, unsere Gegner reisen über den Airport an – hier direkt gemeinsam mit der 21-Gruppe Flagge zu zeigen, ist ein Signal für die Leidenschaft zum Fußball, die die ganze Region prägt.“
Präzisions-Puzzle
Dabei ist die Beklebung des Towers von Nahem betrachtet nicht profan. Der Tower besteht in seiner Außenhülle aus unzähligen Platten mit schmalen Zwischenräumen, sodass die Folie nicht aus einer, sondern wie ein Puzzle aus 236 Einzelfolien besteht. Und selbst das Gerüst der Dortmunder Firma Weise musste aufgrund der Bauform mit dem überkragenden Bereich der Fluglotsen speziell aufgebaut und befestigt werden. Jörg Jacoby, Finanzvorstand von DSW21: „Wir machen´s einfach lautet unser Motto in Richtung der Kunden und Partner. Dass dahinter schon mal komplizierte Abläufe stehen, ist für uns normal. Der Tower zeigt das sehr schön: Von Weitem eine emotionale Werbebotschaft, aus der Nähe Präzisionsarbeit.“
Mehr als sechs Millionen Menschen werden diese Botschaft im Jahr 2021 sehen. Die Metropole Dortmund grüßt am östlichen Einfahrts- und Einflugtor mit Herz und Verstand sowie der starken Verbindung zweier Marken (BVB und 21) für die eine Stadt.
Foto: DSW21

Digitale Wege in der ambulanten Hospizarbeit
Malteser Hospizdienste St. Christophorus in Dortmund haben den ersten digitalen Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter und -begleiterinnen gestartet.
Der neue Vorbereitungskurs für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter und -begleiterinnen mit acht Teilnehmenden ist im Januar angelaufen – erstmals komplett digital. Die Teilnehmenden und das Leitungsteam haben sich auf dieses Experiment eingelassen – mit Erfolg!
Nach nur wenigen virtuellen Treffen ist klar, dass menschliche Nähe auch auf diese Art entstehen kann. Das ist in dieser Zeit der allgemeinen Unsicherheit beruhigend zu wissen. „Der digitale Kurs hatte einen guten Start, auch wenn es kein hundertprozentiger Ersatz für die Präsenzveranstaltungen sein kann“, sagt Karin Budde, Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser, „aber unsere langjährige Erfahrung in der Qualifizierung von Ehrenamtlichen hilft uns auch bei dem Online-Angebot“. Bei Fragen zu den technischen Voraussetzungen haben sich die Malteser im Vorfeld informiert und beraten.
Das große Interesse zeigt, dass trotz oder vielleicht wegen Corona, die Thematik rund um Tod-Sterben-Trauer wichtig ist. Ebenso die Bereitschaft nach der Qualifizierung Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörige zu unterstützen. Und dies, obwohl die Ehrenamtlichen noch gar nicht wissen können, wie die Begleitung unter den gegebenen Umständen konkret aussehen wird.
Die Haupt- und Ehrenamtlichen der Malteser Hospizdienste St. Christophorus sind mit viel Mut, Engagement und Offenheit dabei – digital oder persönlich auf Abstand. Neue Wege werden gegangen, um für Menschen da zu sein, mit einer neuen Form von Nähe und Zuwendung, da es Lebenssituationen gibt, in denen ein zeitlicher Aufschub keine Option ist.
Menschliche Nähe ist auch auf Abstand möglich; es ist eine Frage der Haltung, der Zugewandtheit des Herzens und der Intention. Und genau um diese hospizliche Haltung geht es in der Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen der Malteser Hospizdienste St. Christophorus.
Ein zweiter Vorbereitungskurs ist für dieses Jahr bereits ab dem 9. Juni geplant. Der nächste digitale Informationsabend findet am 22. März statt.
Bildzeile: Karin Budde, Koordinatorin im Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst, hat erste Erfahrung mit einem digitalen Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter und -begleiterinnen gesammelt.
Foto: Malteser Hospizdienste

Neues Rechenzentrum an der Ruhrallee im Herzen von Essen
FAKT AG aus Essen und DOKOM21 aus Dortmund vereinbaren Kooperation
Ein neues Rechenzentrum mit einer Fläche von 700 Quadratmetern entsteht an der Ruhrallee 80 in dem Gebäude der ehemaligen Ruhrgas Hauptverwaltung im Herzen von Essen. Die FAKT AG mit Sitz in Essen und DOKOM21 mit Sitz in Dortmund vereinbarten jetzt eine Kooperation für dieses Rechenzentrumsprojekt, das den Wirtschaftsstandort Essen und das gesamte Ruhrgebiet stärken wird.
„Das neue Rechenzentrum in unserem RUHRTURM² bedeutet nicht nur eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Essen, sondern es wird positive Auswirkungen für Unternehmen im gesamten Ruhrgebiet haben“, erklärt Prof. em. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender und Unternehmensgründer der FAKT AG. „Daher freue ich mich sehr über die jetzt vereinbarte Zusammenarbeit mit DOKOM21, die das Rechenzentrum in Essen als regionaler Telekommunikationsdienstleister technisch aufbauen und betreiben wird.“
Die FAKT AG stellt die Rechenzentrumsfläche und die Gebäudeinfrastruktur zur Verfügung. In der Vergangenheit wurde in den Räumen bereits ein Rechenzentrum betrieben. Die FAKT AG wird den Standort in den nächsten Monaten umfangreich modernisieren.
Ein weiteres Rechenzentrum-Projekt der FAKT AG in Kooperation mit DOKOM21 folgt in Kürze.
Wachsende Nachfrage nach Rechenzentrums-Dienstleistungen
„Die Nachfrage nach Rechenzentrums-Dienstleistungen ist nach wie vor hoch und steigt weiter: Aufgrund des rasant zunehmenden Datenwachstums und der immer komplexer werdenden IT-Infrastruktur entscheiden sich viele Unternehmen für die sichere Auslagerung ihrer Systeme in unsere Rechenzentren“, berichtet DOKOM21-Geschäftsführer Jörg Figura. „Die Kombination der Kompetenzen der FAKT AG auf dem Gebiet der Projektentwicklung für kommunale Infrastruktur und der Erfahrungen von DOKOM21 im Aufbau und Betrieb von Rechenzentren bietet ideale Synergien.“
Hochverfügbarkeit von 99,9 Prozent sichergestellt
Das Rechenzentrum an der Ruhrallee wird über redundante Glasfaseranbindungen in Multicarrierstrategie angeschlossen. Dadurch ist eine Hochverfügbarkeit von 99,9 Prozent sichergestellt. Das Rechenzentrum wird mit einem hochmodernen Sicherheits- und Brandschutzsystem, redundanter Stromversorgung, energieeffizienter Kühlung und einer leistungsstarken Anbindung an die großen Internetbackbones wie DE-CIX (Frankfurt), E-CIX (Düsseldorf) und Ruhr-CIX (Dortmund, Herne, Gelsenkirchen) ausgestattet sein. Sämtliche Dienste des Internetknotens Ruhr-CIX, der letztes Jahr von drei Ruhrgebietscarriern in Zusammenarbeit mit dem DE-CIX gegründet wurde, werden auch in dem Essener Rechenzentrum verfügbar sein. Dieses beinhaltet vor allem den Zugang in die großen Clouds wie Microsoft Azure, Amazon Web Service und Google Cloud Platform. „Die leistungsfähige Infrastruktur des nach den Anforderungen des Leistungskataloges des TÜV Rheinland der Kategorie 3 modernisierten Rechenzentrums wird den Unternehmen Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit garantieren“, sagt Jörg Figura.
DOKOM21 ist der größte Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet
Mit insgesamt 4.600 Quadratmetern Fläche ist DOKOM21 der größte Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet. Renommierte Unternehmen wie Leifheit, WILO, GFOS oder VOLKSWOHL BUND Versicherungen profitieren von den Rechenzentrums-Dienstleistungen. DOKOM21 bietet Unternehmen Platz für die komplette oder teilweise Auslagerung der eigenen Serversysteme und für die Einrichtung von parallel betriebenen Notfall-Rechenzentren. Dabei stehen den Unternehmen individuelle Flächenkonzepte zur Verfügung.
Individuelle Beratung für interessierte Unternehmen
Weitere Informationen über Rechenzentrums-Dienstleistungen von DOKOM21 und eine individuelle Beratung erhalten interessierte Unternehmen bereits jetzt unter Tel. 0231 930 94 02 oder per E-Mail an geschaeftskunden@dokom21.de.
www.dokom21.de/rechenzentrum
Bildzeile: Über die Kooperation von FAKT AG und DOKOM21 für ein neues Rechenzentrum mit einer Fläche von 700 Quadratmetern an der Ruhrallee 80 im Herzen von Essen freuen sich Prof. em. Hubert Schulte-Kemper (2.v.l.), Vorstandsvorsitzender und Unternehmensgründer der FAKT AG, Jörg Figura (2.v.r.), Geschäftsführer von DOKOM21, Norbert Boddenberg (re.), Vorstand der FAKT AG, und Thomas Schnürer (li.), Projektleiter Rechenzentrum Essen von DOKOM21.
Foto: Roland Kentrup
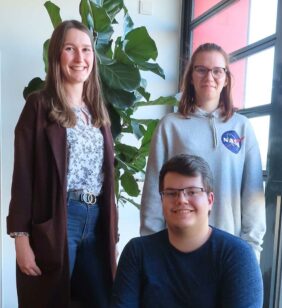
Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der AWO gewählt
Neu gewählte Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bei der AWO Unterbezirk Dortmund ist Magdalena Kaiser, die eine PiA-Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Ihr zur Seite gestellt sind als ihre Stellvertreterin Jaquelin Rösgen, Auszubildende zur Erzieherin, sowie als ordentliches Mitglied Luca Gast, der sich zum Fachinformatiker – Systemintegration ausbilden lässt.
Die JAV vertritt bei der AWO zurzeit 86 junge Menschen, Jugendliche unter 18 Jahren und die zur Berufsausbildung Beschäftigten unter 25 Jahren. Sie berät Jugendliche und Auszubildende in Fragen zu Arbeit und Ausbildung und achtet darauf, dass Gesetze und Tarifverträge im Betrieb eingehalten werden. Sie setzt sich ein für die Übernahme nach der Ausbildung und kümmert sich um die Gleichstellung von Frauen und Migrant*innen im Unternehmen. Darüber hinaus möchte die JAV eine hohe Ausbildungsqualität und die stetige Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte erreichen, aber auch ausreichend Ausbildungsplätze bei der AWO.
Betriebsrat und Geschäftsführung freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.
Bildzeile: v.l. Jaquelin Rösgen, Luca Gast, Magdalena Kaiser.
Foto: AWO-Unterbezirk Dortmund

Optimismus siegt auch in Krisenzeiten!
Erfolgreiches Planspiel Börse 2020 für Dortmunder Teilnehmer
Das Planspiel Börse der Sparkassen findet traditionell im vierten Quartal des Jahres statt. Auch Corona konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender nicht ausbremsen. Zum dritten Mal in Folge stellt die Sparkasse Dortmund einen Bundessieger.
Der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und auch der zweite Lockdown konnten dem Optimismus an der Börse nicht die Luft nach oben nehmen. Dies spiegelt sich auch in der Wertpapierauswahl der Siegerteams wider. Diese setzten auf Werte wie „Tesla“, „TUI“, „Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA“ oder „Wacker Chemie“, und verliehen so ihrer Hoffnung auf baldige Normalisierung Ausdruck. Eine Rechnung, die zumindest an der Börse aufging.
In Dortmund beteiligten sich am Planspiel Börse 322 Schülerinnen und Schüler in 116 Teams und 42 Studierende in 34 Teams. Die jeweils fünf besten Schülerteams sowie die jeweils drei besten Studierendenteams erhielten von der Sparkasse ihre Urkunden und Preisgelder zugeschickt.
Bundesweiter Sieger des Planspiels Börse 2020 in der Depotgesamtwertung der Studierenden ist Murat Umunc, der an der TU Dortmund studiert. Er erreichte mit seiner Anlagestrategie einen Depotwert von 148.525,91 Euro bei einem Startkapital von 100.000 Euro.
Und auch innerhalb des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe und in der Wertung der Sparkasse Dortmund hat er die ersten Plätze erreicht. Damit beläuft sich sein Preisgeld auf insgesamt 2.750 Euro. Den Sieg schaffte er mit Wertpapieren von TUI, thyssenkrupp und Royal Dutch Shell. Schon zum dritten Mal stellt die Sparkasse Dortmund damit den Bundessieger in dieser Wertung.
Die Siegerteams im Schülerwettbewerb profitierten ebenso vom Optimismus an der Börse. In der Depotgesamtwertung steigerte das Team „SmartGirls“ des Immanuel-Kant-Gymnasiums sein Startkapital von 50.000 Euro auf 58.045,70 Euro. Ihren Depotzuwachs erzielte die Spielgruppe hauptsächlich mit den Wertpapieren von Tesla, Vodafone und Wacker Chemie.
In der Nachhaltigkeitsbewertung werden speziell die Erträge mit nachhaltig eingestuften Wertpapieren ausgewertet. Hier erwirtschaftete das Team „Bullenreiter“ des Bert-Brecht-Gymnasiums mit den Wertpapieren von Tesla und Allianz den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 4.405,85 Euro.
Den Sieg in der Nachhaltigkeitsbewertung der Studierenden konnte das Team „Ist mir egal“ der FH Dortmund mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 34.252,17 Euro für sich verbuchen. Es gelangte damit auf den dritten Platz in der Wertung des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe und kann sich insgesamt über ein Preisgeld von 1.050 Euro freuen.
Sebastian Junker, Bereichsleiter Wertpapiere, ist von den Ergebnissen der Siegerteams begeistert: „Wir waren hocherfreut, dass trotz oder wegen Corona so viele Teilnehmende in dieser Spielrunde am Planspiel Börse mitgemacht haben. Dies zeigt, dass das Interesse an gut aufbereiteten Finanzthemen groß und die Vermittlung finanzieller Bildung wichtig ist.“
Die Sparkasse Dortmund veranstaltet seit vielen Jahren das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung. Beim Planspiel Börse handelt es sich um ein onlinebasiertes Lernspiel. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt.
Bildzeile: Murat Umunc (l.) erhält von Sebastian Junker, Bereichsleiter Wertpapiere, die Urkunde für den Sieg im bundesweiten Studierendenwettbewerb des Planspiels Börse 2020. Aufgrund der aktuellen Situation gab es keine offizielle Siegerehrung.
Foto: Sparkasse Dortmund

Mitglieder des Lippeverbandes wählen neuen Aufsichtsrat
Verbandsrat bestimmt Landrat Bodo Klimpel zum neuen Vorsitzenden
Lippe-Gebiet. Die fünfjährige Amtsperiode der bisherigen Mitglieder des Rates des Lippeverbandes endete in diesem Jahr. Im Rahmen der Verbandsversammlung des Lippeverbandes wählten die Delegierten am Mittwoch, 3. März, den neuen Rat, der vergleichbar ist mit dem Aufsichtsrat eines Konzerns. Die Versammlung fand Corona-bedingt online statt.
Für die Städte und Gemeinden sitzt unter anderem Marc Herter, Oberbürgermeister der Stadt Hamm, im Verbandsrat. In seiner ersten konstituierenden Sitzung am Mittwochnachmittag wählte der neue Rat auch einen neuen Vorsitzenden: Bodo Klimpel, Landrat des Kreises Recklinghausen, nimmt dieses Amt erneut wahr. Bereits in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Haltern am See hatte Bodo Klimpel das Amt inne: „Für das Vertrauen und die Möglichkeit, in einer zweiten Amtszeit als Vorsitzender die Arbeit des Lippeverbandes weiter intensiv zum Wohle der Region mitzugestalten, bedanke ich mich herzlich.“
Die neuen Ratsmitglieder verteilen sich auf die Städte und Gemeinden, die Kreise, den Bergbau, die gewerblichen Unternehmen sowie auf die Arbeitnehmervertreter.
Bildzeile: In seiner ersten konstituierenden Sitzung wählte der neue Rat einen neuen Vorsitzenden: Bodo Klimpel (r.), Landrat des Kreises Recklinghausen, nimmt dieses Amt erneut wahr. Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Uli Paetzel (l.) gratuliert.
Foto: Klaus Baumers / EGLV
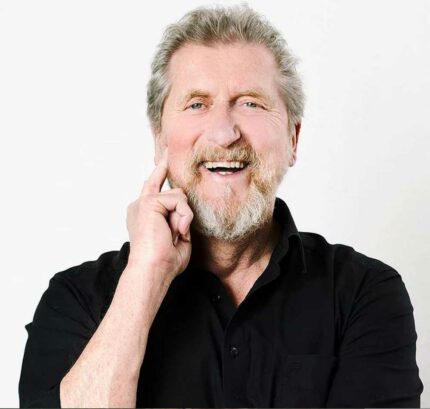
Horst Hanke-Lindemann stellt sich als Botschafter an die Seite des neuen Ambulanten Erwachsenen Hospizdienstes Dunkelbunt
Der neue Ambulante Erwachsenen Hospizdienst Dunkelbunt bekommt prominente Unterstützung: Horst Hanke-Lindemann, den Dortmundern als vielseitiger Theater- und Festivalorganisator bekannt, wird Botschafter des ersten überkonfessionellen Erwachsenen Hospizdienstes in Dortmund.
Horst Hanke-Lindemann ist in Dortmund das Gesicht der Freien Kulturszene und hat viele bekannten Kulturorten und Festivals ins Leben gerufen. Im Lockdown 2020 begeisterte er das Publikum, weil es ihm gelang, innerhalb kürzester Zeit das Kabarett-Festival „RuhrHOCHdeutsch“ coronasicher in das Schalthaus zu verlegen – und damit einen einzigartigen Auftrittsort in schwierigen Zeiten zu ermöglichen.
Zum Jahresanfang 2021 übergab Horst Hanke-Lindemann die Geschicke des Theaters Fletch Bizzel in den Hände von Cindy Jänicke und Till Beckmann. Jetzt stellt sich Horst Hanke-Lindemann als Botschafter an die Seite des Ambulanten Erwachsenen Hospizdienstes Dunkelbunt.
Foto: Horst Hanke-Lindemann.

Vonovia: Hohe Modernisierungsrate für mehr Nachhaltigkeit und Wohnwert in Dortmund
Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat seit 2012 rund 60 Prozent seiner knapp 20.000 Wohnungen in Dortmund modernisiert und dabei auch energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Zugleich lag der Fokus darauf, mehr Wohnkomfort und Bezahlbarkeit in Einklang zu bringen. Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Sanierungsquote Im Branchenschnitt nur bei rund einem Prozent im Jahr. „Mit einer konstant hohen Modernisierungsrate – bundesweit wie auch in Dortmund – bekennt sich Vonovia bereits seit mehreren Jahren zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung der Wohnungswirtschaft, auch im Gebäudebestand nachhaltige Beiträge zum Klimaschutz zu leisten. Durch ganzheitliche Modernisierungen, die neben der Heizungsmodernisierung und der energetischen Optimierung oftmals viele weitere Maßnahmen umfassen, profitieren unsere Mieterinnen und Mieter zugleich von mehr Wohnkomfort. Dabei behalten wir weitere Bedürfnisse unserer Mieterinnen und Mieter wie Barrierefreiheit und Bezahlbarkeit im Fokus“, sagt Mario Stamerra, Vonovia Geschäftsführer West.
Für die letzten drei Jahre bedeutet dies: Über 7.800 Wohnungen wurden energetisch optimiert. Dadurch konnte das Klima bereits um mehr als 10.500 Tonnen CO2 entlastet werden. Von der Aufwertung der Wohnungen profitieren die Mieterinnen und Mieter aber nicht nur durch geringere Heizkosten, sondern vielfach auch durch weitere Verbesserungen bei der Wohnqualität und des Wohnumfeldes. Hinzu kommen 153 neu erstellte bzw. durch Dachaufstockungen realisierte Wohnungen nach dem neuesten energetischen Standard. Das Vonovia Investitionsvolumen in Dortmund betrug seit 2018 mehr als 177 Millionen Euro.
Ludger Wilde, Leiter des Dezernats Umwelt, Planen und Wohnen der Stadt Dortmund: „Vonovia bringt in Dortmund mit vielen Modernisierungen nicht nur seine Bestände mit hohem Tempo auf den neuesten Stand, sondern schafft auch neuen Wohnraum für unsere Bürgerinnen und Bürger. Mit bedarfsgerechten Angeboten werden alle Generationen und alle Gruppen der Gesellschaft angesprochen – auch diejenigen, die öffentlich geförderten Wohnraum benötigen. Aus Sicht der Stadt Dortmund sind dies wichtige Beiträge zur lebenswerten Weiterentwicklung der Stadt – wir freuen uns, dass Vonovia diesen Weg geht.“
Klimaschutzgesetz verteuert fossile Heizenergie
Mit den energetischen Modernisierungen bremst Vonovia auch zukünftige Kostensteigerungen für die Bewohner. Denn im Rahmen eines neuen Klimaschutzgesetzes will die Bundesregierung unter anderem durch einen CO2-Preis Impulse zur Klimaentlastung geben. Heizöl und Erdgas sind dadurch seit dem 1. Januar 2021 spürbar teurer, und in den nächsten Jahren folgen weitere Preissteigerungen durch eine schrittweise Anhebung des CO2-Preises. Die Heizkostenabrechnung kann dadurch ohne Energiesparmaßnahmen schon bald mehrere hundert Euro im Jahr höher ausfallen. In einer energetisch optimierten Wohnung wird der Kostenanstieg gebremst oder sogar ganz gestoppt.
Mieterinnen und Mieter im Mittelpunkt
Vonovia Regionalbereichsleiter Ralf Peterhülseweh betont, dass die Modernisierungen sozialverträglich bleiben: „Eine Modernisierung bedeutet für viele Mieterinnen und Mieter auch eine Mietanpassung. Vonovia hat sich dazu verpflichtet, die Modernisierungsumlage auf höchstens zwei Euro pro Quadratmeter zu begrenzen, zudem wird diese ja durch die Heizkosteneinsparungen zumindest teilweise ausgeglichen. Wer die Anpassung aufgrund persönlicher oder finanzieller Härten nicht aufbringen kann, muss bei Vonovia aber nicht gleich ausziehen. Unser eigenes Härtefallmanagement kümmert sich um gemeinsame Lösungen. Für Mieterinnen und Mieter über 70 Jahre gibt es zudem eine Wohngarantie.“
Beispiel Westerfilde
Ein gelungenes Beispiel für eine ganzheitliche, sozialverträgliche Modernisierung befindet sich in Westerfilde. Hier wohnt knapp jeder Siebte in einer Vonovia Wohnung, das Wohnungsunternehmen besitzt hier rund 1.000 Wohneinheiten. Nach einer umfassenden Quartiersentwicklung, die neben Gebäudemodernisierungen und einer Wohnumfeldaufwertung auch Verbesserungen bei der Sicherheit, Nachbarschaftsförderung und Sozialprojekte umfasste, können nun 110 Wohnungen preisgebunden angeboten werden. Das entspricht rund 30 Prozent der Wohnungen im Quartier. Die preisgebundene Miete liegt bei 5,60 Euro pro Quadratmeter. Vonovia arbeitet in diesem Quartier eng mit dem Quartiersmanagement Westerfilde & Bodelschwingh zusammen, das im Auftrag der Dortmunder Stadterneuerung ebenfalls viele nachhaltige Impulse für gute Nachbarschaft und das Wohnumfeld im Quartier gibt.
Mit den so genannten Mieterwunschprojekten bietet Vonovia seinen Mieterinnen und Mietern in Dortmund zudem seit einiger Zeit mehr Einfluss auf die Gestaltung von Wohnung und Umfeld. Begonnen hat es 2014 mit der Möglichkeit, die Modernisierung des Badezimmers zu initiieren, 2016 folgte die Küche auf Mieterwunsch und seit 2017 können Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen mit zusätzlichen Sicherheitslösungen ausstatten lassen. Seit 2020 bietet Vonovia nun auch individuelle Haus- und Mietergärten.
Bildzeile: In Westerfilde hat Vonovia seinen Wohnungsbestand modernisiert. Neben der energetischen Sanierung profitieren die Mieterinnen und Mieter sowohl von mehr Wohnkomfort als auch von Verbesserungen im Wohnumfeld.
Foto: Vonovia / Bierwald

Abschied nach 37 Jahren am Museum für Kunst und Kulturgeschichte: Dr. Gisela Framke geht in Ruhestand
Nach fast 37 Jahren am Museum für Kunst und Kulturgeschichte, darunter 33 Jahre als stellvertretende Direktorin, geht Dr. Gisela Framke in den verdienten Ruhestand. Kulturdezernent Jörg Stüdemann bedankt sich bei der 66-Jährigen am Freitag für ihren langjährigen und herausragenden Einsatz. „Sie waren nicht nur eine profilierte Kuratorin vieler Ausstellungen, die im Gedächtnis bleiben werden, sondern auch eine Wegbereiterin gleich drei neuer Museen und über viele Jahre faktisch die Leiterin des MKK“, so Stüdemann.
Gisela Framke studierte Geschichte und Romanistik in Köln. Im Anschluss an ihre Promotion absolvierte sie ein Volontariat am Museum für Hamburgische Geschichte. Von dort aus bewarb sie sich 1984 am Museum für Kunst und Kulturgeschichte und wurde vom damaligen Museumsleiter Dr. Gerhard Langemeyer eingestellt.
Schon vier Jahre später wurde die junge wissenschaftlicher Mitarbeiterin zur Stellvertreterin des neuen Direktors Wolfgang E. Weick und blieb es bis heute. Während der zwei Jahre währenden Vakanz nach Weicks Ausscheiden leitete sie das MKK 2014 bis 2016 kommissarisch.
Die Schwerpunkte ihrer Arbeit am MKK lagen in der neueren Stadt- und Alltagsgeschichte, in der Geschichte des Museums und der Industriekultur. Ein besonderes Faible entwickelte sie für die hochwertige Textilien- und Spitzensammlung.
Gleich drei neue Töchter-Museen brachte Gisela Framke mit auf den Weg: Sie war die „Mutter“ des Deutschen Kochbuchmuseums, das 1988 im Westfalenpark eröffnete, und sie begleitete intensiv die Eröffnung des Hoesch-Museums 2005 und des Brauerei-Museums im Jahr darauf.
Zu den von ihr verantworteten Ausstellungsprojekten am MKK gehören „Künstler ziehen an!“ (1998), „Acht Stunden sind kein Tag!“ (1992), „Mythos Bernsteinzimmer“ (2002), „Evet! Ja, ich will“ (2008), „Das neue Dortmund“ (2002)“, „Spitze“ (1995). Letzter Höhepunkt war die Jugendstil-Ausstellung „Im Rausch der Schönheit“, eine der erfolgreichsten Ausstellungen der vergangenen Jahre.
„Für uns am MKK geht mit dem Abschied von Gisela Framke eine Ära zu Ende. Das neue, junge Team des Museums nimmt ihre Aufforderung gerne an, die Chance zu nutzen und einen Neustart am Museum zu starten“, sagt Dr. Jens Stöcker, Direktor des MKK.
Bildzeile: MKK-Direktor Dr. Jens Stöcker verabschiedet seine Stellvertreterin Dr. Gisela Framke in den Ruhestand.
Foto: Joana Maibach, MKK

Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe liegt öffentlich aus
Noch bis zum 12. April 2021 können Einzelpersonen und Vereine Einsprüche gegen den Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe – im Rahmen der öffentlichen Auslegung einreichen. Die Planunterlagen befinden sich auf den Internetseiten des Stadtplanungsamtes: www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/stadtplanungs_und_bauordnungsamt/stadtplanung/bauleitplanung/bebauungsplanung/aktuelle_offenlagen/index.jsp
Die Naturschutzverbände hatten sich im bisherigen Verfahren mehrfach ablehnend zur Planung geäußert. Informationen unter: www.bund-dortmund.de
Der Rat der Stadt hatte sich Anfang Februar mehrheitlich für die Planung ausgesprochen, trotz einstimmiger Ablehnung durch die Bezirksvertretung Hombruch.
Die Naturschutzverbände unterstützen die Bürgerinitiative, die bereits eine Klage gegen den Bebauungsplan angekündigt hat. Mit dem Satzungsbeschluss wird Ende des Jahres gerechnet.
Foto: BUND Dortmund

Straßenzüge in Dortmund zum Leuchten
Aktion „In Verbindung bleiben“: DOKOM21
überrascht Anwohner mit 2.000 LED Heliumballons
DOKOM21 hat in einer Nacht Ende Februar ganze Straßenzüge in der Dortmunder Innenstadt, in Hörde und in Eving zum Leuchten gebracht. Der regionale Telekommunikationsdienstleister überraschte die Anwohnerinnen und Anwohner mit 2.000 LED
Heliumballons, die die nächtliche Umgebung in ein neues Licht tauchten.
Jeder, der wollte, konnte sich einen Leuchtballon als Geschenk mit nach
Hause nehmen.
Homeschooling und Homeoffice: Optimal in Verbindung bleiben
Mit dieser außergewöhnlichen Marketingaktion sorgte DOKOM21 bei vielen
Menschen in den frühen Morgenstunden für Staunen und freudige Gesichter.
Zugleich warb das Dortmunder Telekommunikationsunternehmen dafür, gerade
in der aktuellen Situation optimal in Verbindung zu bleiben. „Menschen
miteinander zu verbinden, war schon immer unser Ziel und ist es jetzt in Zeiten
von Homeschooling, Homeoffice und Videocalls mehr denn je“, erklärt Daniela Morkel, Marketingmitarbeiterin von DOKOM21. Als regionaler Telekommunikationsanbieter bietet DOKOM21 leistungsstarke
Internetverbindungen und attraktive Tarife. „Davon können die Menschen gerade
in der aktuellen Situation besonders profitieren: Mit DOKOM21 können die Dortmunderinnen und Dortmunder mit ihren Familien, Freunden, Kollegen,
Mitschülern und Geschäftspartnern jederzeit optimal in Kontakt bleiben. Sowohl
das Arbeiten und Lernen von zuhause als auch gemütliches Streaming und
Online-Shopping sind mit dem zukunftsfähigen DOKOM21 Glasfasernetz
jederzeit problemlos möglich. Mit unseren vielfältigen Internettarifen haben wir
dabei für jedes Bedürfnis das passende Angebot“, sagt Daniela Morkel.
Im Rahmen der Leuchtballon-Aktion gewährt DOKOM21 Neukundinnen und
Neukunden zusätzlich einen Extrarabatt. Vollkommen gratis waren die
leuchtenden Ballons, die sich viele Kinder und Erwachsene als Geschenk mit
nach Hause nahmen.
www.dokom21.de/in-verbindung
Bildzeile: Gerade jetzt in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice optimal in Verbindung
bleiben, dafür wirbt Daniela Morkel, Marketingmitarbeiterin von DOKOM21, mit
einer außergewöhnlichen Leuchtballon-Aktion.
Foto: Roland Kentrup

Kranzniederlegung am „Friedrich Ebert Denkmal“
Anlässlich des 96. Todestages von Friedrich Ebert, legten der SPD-Stadtbezirksvorsitzende
Uli Dettmann und die Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann, am Denkmal im Süggelweg einen Kranz nieder. Pandemiebedingt war in diesem Jahr nur ein kleiner Kreis bei der Kranzniederlegung zugegen. Die Veranstaltung fand unter strenger Einhaltung der Coronaschutzverordnung statt.
Am 28.02.1925 verstarb der Sozialdemokrat Ebert, der erste demokratisch gewählte Präsident Deutschlands, im Alter von nur 54 Jahren. Das Denkmal ist aber nicht nur der Erinnerung Eberts gewidmet, sondern auch dem Zentrumspolitiker Matthias Erzberger und dem Liberalen Walter Rathenau. Beide wurden 1921 bzw. 1922 von rechtsterroristischen Attentätern der Organisation Consul ermordet.
Das Denkmal hat eine bewegte Geschichte. Es wurde 1926 errichtet durch Evinger Sozialdemokraten und den Reichsturnerbund, sein ursprünglicher Standort war im Grävingholz. Um der Zerstörung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, wurde es zwischen 1936 und 1938 gesichert und im Süggelwald vergraben.
In ihrer eindrucksvollen Gedenkrede würdigte Sabine Poschmann nicht nur das Wirken Eberts, sondern auch die Ereignisse in der noch jungen Weimarer Republik.
Ebert, Erzberger und Rathenau waren mittelbar bzw. unmittelbar Opfer rechtsnationaler Gewalt. Ihr Wirken in der noch jungen Republik war Ziel von Verleumdungen, Hass und Gewalt.
Sabine Poschmann erinnerte an die gemeinsame Verpflichtung, unsere Demokratie als höchstes Gut vor allen Angriffen zu verteidigen.
Zuvor würdigte der Stadtbezirksvorsitzende Uli Dettmann die mutigen Evinger Männer und Frauen die dieses 1926 erstmals errichtete Denkmal in der Zeit des Nationalsozialismus geschützt, und uns somit als Ort der Mahnung und Erinnerung erhalten haben.
Foto: SPD Stadtbezirk Eving

Handwerk sorgt für saubere Luft
in Büros und Unterricht
Für 30.000 Euro Luftreinigungsgeräte geordert / Sorge um die Gesundheit von Beschäftigten und Lehrgangsteilnehmern macht Investitionen nötig
Hygienemaßnahmen, Masken, Abstand: In der Verwaltung und den berufsbildenden Lehrgängen des Bildungskreises Handwerk e.V. (BKH) in Dortmund-Körne wurden die Regeln zum Schutz von Beschäftigten und Teilnehmenden bisher schon strikt befolgt. Jetzt hat der Verein zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen (KH) die Initiative für noch mehr Gesundheitsschutz ergriffen. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 30.000 Euro wurden für Büros und Seminarräume von KH und BKH 25 Luftreinigungsgeräte angeschafft. „Wir haben Geräte geordert, die in der Lage sind, die Luft in den Büros und Schulungsräumen innerhalb kürzester Zeit von Bakterien und Viren zu befreien“, erklärt Geschäftsführer Volker Walters. „Durch diese Maßnahmen wollen wir den größtmöglichen Schutz für unsere Beschäftigten und die Teilnehmenden unserer Weiterbildungsmaßnahmen erreichen” Insgesamt 14 Räume des BKH und 11 der Kreishandwerkerschaft wurden mit der innovativen Technik ausgestattet.
Technik reinigt Luft und Oberflächen
Beratend zur Seite stand bei der Anschaffung der Luftreinigungsgeräte die Gebäudereiniger-Innung Dortmund. Obermeister Kai-Gerhard Kullik, der selbst Inhaber eines Unternehmens zu Luftkanalreinigung ist, brachte seine Expertise als Gebäudereinigungsmeister ein und organisierte die Anschaffung der Airsteril-Geräte. „Wir haben vier unterschiedliche Typen von Luftreinigern im Einsatz – je nach Raumgröße für bis zu 80 Quadratmeter”, erklärt Kullik die Maßnahme. „Vor der Entscheidung haben wir eigene Tests mit Luftproben auswerten lassen. Nach einer Stunde hatten wir schon 50 Prozent weniger Schimmelpilzsporen und 80 Prozent weniger allergene Keime im Raum.” Die Hardware, die zu den modernsten ihrer Art auf dem Markt gehört, arbeitet mit keimtötender UV-Bestrahlung und Sauerstoff sowie Plasma-Desinfektion. „Auf diese Weise wird nicht nur die Raumluft gereinigt, sondern auch die Oberfläche der Möbel desinfiziert”, erklärt Kullik. Im Moment findet kein Präsenzunterricht beim Bildungskreis Handwerk e.V. statt. Aber mit der neuen Technik ist man jetzt bestens darauf vorbereitet, die Kursteilnehmer unter hygienisch einwandfreien Bedingungen wieder empfangen zu können.
Bildzeile: Kleine Technik mit großer Wirkung: Geschäftsführer Volker Walters (l.) und Obermeister Kai-Gerhard Kullik (r.) präsentieren die neue Technik, die zur Luftreinigung in den Unterrichtsräumen eingesetzt werden soll.
Foto: Bildungskreis Handwerk e.V.

OB Thomas Westphal erinnert an
Geburtstag Günter Samtlebes
Am 7. Juli 2011 verstarb der langjährige Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Dortmund, Günter Samtlebe.
Am 25 Februar 2021 wäre Samtlebe 95 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstages erinnert die Stadt an diese große Persönlichkeit der Kommunalpolitik. Oberbürgermeister Thomas Westphal legte heute ein Blumengebinde an Samtlebes Grabstätte auf dem Hauptfriedhof nieder.
Günter Samtlebe wurde am 25. Februar 1926 in Dortmund-Schüren geboren. Seine Jugend war geprägt von einem kurzen Einsatz als Soldat, der ihm als 17-jährigem kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges nicht erspart blieb. Er absolvierte eine Verwaltungsausbildung, arbeitete als Hüttenarbeiter, wurde später bis zu seinem Ruhestand Direktor der Hoesch Stahl AG im Bereich der allgemeinen Verwaltung.
Schon 1946 trat Günter Samtlebe in die SPD ein, wurde 1956 in den Rat gewählt, dem er bis 1999 über 40 Jahre angehörte. Am 12. Februar 1973 begann seine über 26 Jahre währende Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt. Sie endete nach fünf Wiederwahlen erst am 30. September 1999 mit Einführung der neuen Kommunalverfassung und Direktwahl des Oberbürgermeisters, für die sich auch Samtlebe immer eingesetzt hatte.
In dieser langen Zeit als Oberbürgermeister der Stadt Dortmund gelang es Günter Samtlebe durch seine Persönlichkeit, Tatkraft und Bürgernähe dem Amt besondere Prägung und außergewöhnliches Ansehen zu verschaffen. Er gestaltete die Ära Dortmunds als Stadt des Stahls, der Kohle und des Bieres mit, beförderte die Bedeutung Dortmunds als Stadt der Forschung und der Lehre, als westfälische Handelsmetropole und Zentrum der Hochtechnologie. Als Mann aus dem Stahlbereich war er den Menschen in der Montanindustrie emotional eng verbunden. Doch Günter Samtlebe wusste immer, dass sich diese wirtschaftliche Ausrichtung nicht konservieren ließ und trug nach Gründung der Dortmunder Universität maßgeblich dazu bei, neue Wirtschaftsimpulse auf den Weg zu bringen.
In diesem Zusammenhang wurde er 1980 zum Vater der Dortmund-Konferenz, die viele Jahre weit über die Stadtgrenzen hinaus als mustergültige Lösungsform kommunaler Problemlagen galt.1994 rief er erstmals die City-Runde zusammen. Seine Amtszeit kennzeichnen außerdem so wichtige Zukunftsentscheidungen wie die für den Bau der Stadtbahn, die fußgängerfreundliche Umgestaltung der Innenstadt und den Bau eines neuen Rathauses am Friedensplatz.
Schon sehr früh wurde Günter Samtlebe zum Verfechter der Aussöhnung zwischen den Völkern und damit zum Vordenker des heutigen Europa. Während seiner Amtszeit wurden die Städtepartnerschaften mit Rostow am Don und Buffalo (beide 1977), Netanya (1980), Novi Sad (1981), Zwickau (1988) und Xian (1991) begründet. Daraus erwuchsen zahllose zwischenmenschliche Begegnungen jenseits von Staatsgrenzen aber auch viele Hilfsaktionen, die Samtlebe entweder selbst initiierte oder an denen er maßgeblich beteiligt war.
Die Stadt Dortmund wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Bildzeile: OB Thomas Westphal und Werner Sauerländer, Schwiegersohn von Günter Samtlebe, an Samtlebes Grabstätte auf dem Hauptfriedhof.
Foto: Roland Gorecki

In seiner Februar-Sitzung am 16. Februar 2021 hat der SPD Stadtbezirk Dortmund-Mengede Jens Peick als Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert.
Bereits im Januar hatte sich Jens Peick den Mitgliedern des Stadtbezirks in einer Videokonferenz vorgestellt und dabei auch erste Schwerpunkte seiner Kandidatur vorgestellt. In einer angeregten Diskussionsrunde diskutierte er mit den Mitgliedern seine Vorstellungen von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, aber auch von Steuergerechtigkeit und wie die ökologischen Anforderungen des Klimawandels sozial gestaltet werden können.
Die Abstimmung über die Nominierung erfolgte ohne Gegenstimme und so freut sich der Stadtbezirk nun, nach der offiziellen Kandidatenaufstellung im März, auf einen erfolgreichen Wahlkampf mit und für Jens Peick.
Bildzeile: Der SPD Stadtbezirk Dortmund-Mengede hat Jens Peick als Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert.
Foto: SPD Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Regionalwettbewerb Jugend forscht
Am Puls der Zeit
Ein erster Veranstaltungshöhepunkt im Jahr ist „traditionell“ der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in der DASA, bei der Nachwuchs erste Gehversuche in Sachen Wissenschaft macht.
Keine Überraschung: In diesem Jahr fand der Wettbewerb online statt. Jüngst verwandelten sich also Küchen und Kinderzimmer in Media-Studios, in denen Projektpräsentationen vor der üblichen Jury via digitaler Drähte abliefen. Insgesamt gab es 38 eingereichte Arbeiten im Dortmunder Sprengel, nicht nennenswert weniger als in Zeiten vor Corona.
Nun fand auch die Feierstunde online und mit großem technischen Aufwand statt, um die insgesamt sechs Siegerarbeiten des Regionalwettbewerb zu ehren, die sich allesamt derzeit überaus aktuellen Herausforderungen stellen.
Luft und Erde
Für den Bereich Arbeitswelt hat das Gymnasium Rodenkirchen abgeräumt. Besser atmen ohne Aerosole: Die Schüler haben die Zeichen der Zeit erkannt und ein mobiles Heiz- und Lüftungssystem für eine kontrollierte Frischluftzufuhr im Klassenzimmer erfunden.
Erde wiederum ist das Element, das es dem Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund angetan hatte. Mit einer Untersuchung der Bodenbeschaffenheit in Dortmund-Hohenbuschei für das Fach Biologie entwickelten die Schüler ein spezielles Düngesystem.
Die analoge Welt verlassen haben die beiden Projekte im Segment Mathematik/Informatik. Das Gymnasium Holthausen aus Lünen befasste sich mit einer vereinfachten PC-Oberfläche, um Neulingen den Einstieg in das Arbeiten mit dem Computer zu erleichtern, während die Friedrich-Harkort-Schule aus Schwerte einen datensicheren Sprachassistenten fürs Smartphone entwickelt hat.
Sprachsysteme
Gehörlose sprachfähiger zu machen war das Anliegen des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus Waltrop, die einen Gebärdenhandschuh ins Rennen schickten, der mittels einer App Gesten in Lautsprache umwandelt. Schließlich ergatterte noch ein weiteres technisches Projekt den ersten Preis. Die Gesamtschule Menden ersonnen einen Gefahrenindikator für Mikropartikel, der in der Lage ist Feinstaub zu erkennen und bei zu hoher Belastung seinen Nutzer warnen kann.
Alle Projekte qualifizieren sich nun für den ebenfalls digital ablaufenden Landeswettbewerb.
Foto: DASA

Sechste Ausgabe des Dortmunder Image-Buches erschienen
Von Rekordtieren im Zoo über eine der größten Kletterhallen Europas bis hin zu einer Frauenfußballmannschaft, die sich bis in die 2. Bundesliga gekickt hat – bereits zum sechsten Mal hat sich das Team von „Dortmund überrascht. Dich“ auf den Weg quer durch unsere Stadt gemacht. Und überraschende und spannende Geschichten gefunden. Auf über hundert Seiten gibt es in der neusten Ausgabe des Dortmunder Image-Buches „Eine Stadt. Viele Stärken.“ kurze Reportagen, die zeigen, wie vielfältig, lebendig und spannend unsere Stadt ist. Das Buch ist zunächst online abrufbar – sobald die bekannten Ausgabestellen der Stadt wieder geöffnet sind, ist es auch dort wie gewohnt kostenlos erhältlich.
Dortmund weiß auch in Zeiten großer Herausforderungen zu überraschen
Das Jahr 2020 war vor allem geprägt von der Corona-Pandemie, die uns noch immer im Alltag einschränkt und unsere Geduld erfordert. Aber es gab auch schöne Ereignisse und spannende Projekte, die gemeinsam die Zukunft unserer Stadt festigen. „Als erfolgreiche Gestalterin des Strukturwandels weiß Dortmund auch in Zeiten großer Herausforderungen zu überraschen. Denn es sind der Zusammenhalt und die Vielfalt, die diese Stadt ausmachen“, bekräftigt Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, in seinem Vorwort zum Buch.
Genau diesen Zusammenhalt nennen auch die jungen Dortmunder Gründer*innen, wenn sie über den Erfolg der Start-Up-Szene in unserer Stadt sprechen: „Geheimrezept Solidarität“ heißt die Geschichte, die einen genaueren Blick auf die hiesige Gründer*innen-Szene wirft. Die Reportage „Handgemacht!“ erzählt, warum gerade hier Manufaktur-Produkte auf dem Vormarsch sind. Der ausgezeichnete Naturfotograf Peter Lindel zeigt mit „Meister Lampe im Morgenlicht“ seine schönsten Tierfotografien aus Dortmund. Und unter der Überschrift „Visionäres wagen!“ verrät Prof. Dr. Andrea Musacchio im Interview, dass mitten in unserer Stadt an den zentralen Fragen des Lebens geforscht wird.
Und auch die Stadtverwaltung selbst schreibt spannende Geschichten: Das Urban-Gardening-Projekt „Querbeet“ trägt im wahrsten Sinne des Wortes Früchte und hat den ehemals von Stahlarbeit geprägten Stadtteil Hörde in Teilen in eine grüne Oase verwandelt. Hier wachsen feurige Chillis und knallrote Tomaten direkt neben der Fußgängerzone, werden Auberginen und Kartoffeln in einem ehemaligen Schwimmbecken angebaut. An der Speicherstaße im Hafen soll ein neues, urbanes Viertel entstehen, das gleichsam Arbeit und Kultur vereint. Mit dem Groß-Projekt „Smart Rhino“ schärft Dortmund sein Profil als Metropole: Auf dem ehemaligen Gelände der Hoesch Spundwand und Profil GmbH an der Rheinischen Straße entsteht auf 52 Hektar ein gänzlich neues Stadtquartier, das Angebote für Leben und Lernen, Wohnen und Arbeiten sowie Freizeit, Kultur und Gesundheit schafft.
Image-Kampagne „Dortmund überrascht. Dich“
Mit der Image-Kampagne „Dortmund überrascht. Dich.“ zeigt die Stadt Dortmund bereits seit 2014, dass Dortmund mehr ist als die Geschichte von Kohle, Stahl und Bier oder nur der BVB. Unsere Stadt hat deutlich mehr zu bieten! Denn Dortmund hat Stärken in vielen Bereichen. Das Spektrum reicht von Technologie und Wissenschaft über unser Urbanes Zentrum bis zur Kultur- und Sportlandschaft. Dabei gibt es viel Überraschendes: So ist beispielsweise die TU Dortmund weltweit die einzige Universität mit einem eigenen Teilchenbeschleuniger, in der Innenstadt steht zur Weihnachtszeit der größte Weihnachtsbaum der Welt und der PHOENIX-See ist mit einer Wasserfläche von 24 Hektar größer als die Hamburger Binnenalster. Viele Gäste, die zum ersten Mal nach Dortmund kommen, sind nach wie vor erstaunt, wie „grün“ diese Großstadt ist. Kein Wunder: Der Grünflächen-Anteil beträgt gut 63 Prozent.
Das Dortmund-Buch: Online & Ausgabestellen
Das neue Image-Buch ist ab sofort online abrufbar auf dortmund-überrascht.de/buch. Erhältlich ist es auch an den folgenden Ausgabestellen, sobald diese coronabedingt nicht mehr für den Publikumsverkehr geschlossen sind: Dortmund-Agentur (Friedensplatz 3), Rathaus Dortmund – Bürgerhalle (Friedensplatz 1), DORTMUNDtourismus (Kampstraße 80), Dortmunder U (Leonie-Reygers-Terrasse), Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Hansastr. 3), Kokerei Hansa (Emscherallee 11), Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur Zeche Zollern (Grubenweg 5)
Bildzeile: Ute Piotrowski (l.) und Laura HErfurth (r.).
Foto: Roland Gorecki
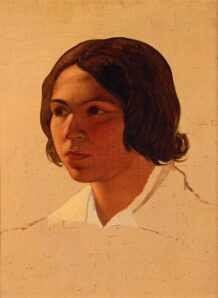
Von fürstlicher Herkunft: Friedrich Overbecks unvollendetes Ölbild ist „Objekt des Monats“ im MKK
Sie ist ebenso unscheinbar wie unvollendet: Die Ölstudie, in der der Maler Friedrich Overbeck (1789 bis 1869) seinen jungen Kollegen Franz von Rohden porträtiert. Seit 1953 befindet sich das Bild im Besitz des Museums für Kunst und Kulturgeschichte. Mit der Geschichte und Herkunft dieses Werks hat sich in den vergangenen Monaten MKK-Volontärin Johanna Heil beschäftigt – und ist dabei auf fürstliche Geschichte(n) gestoßen. Grund genug für das MKK, es zum „Objekt des Monats März“ zu küren.
Der junge Franz von Rohden wurde im Alter von 18 Jahren von seinem Lehrer Friedrich Overbeck auf Leinwand gebannt. Fast scheu blickt er aus dem Bildraum heraus. Lediglich sein Kopf, Hals und Teile seines Hemdkragens sind vollständig ausgearbeitet, der Rest des Gemäldes gibt den Blick auf den unbearbeiteten beigen Malgrund frei. Es gilt als Vorstudie für ein Porträt, das sich heute im Kunstmuseum Basel befindet.
Nicht nur die charaktervolle Darstellung des Malschülers und die sichtbare Malweise Overbecks machen das Bild zu einer Besonderheit im MKK – sondern auch einer seiner Vorbesitzer. Das Museum hat die Arbeit auf einer Auktion des Stuttgarter Kunstkabinetts im November 1953 erworben. Ein Eintrag im Auktionskatalog gibt den ersten Hinweis: Demnach stammt es aus der „Sammlung: Fürst von Liechtenstein, Schloß Vaduz“. Diese Angabe sollte augenscheinlich zur Aufwertung des Werks beitragen. So wurde dessen direkter Vorbesitzer, ein Münchner Buchantiquar und Kunstsammler, nicht im Katalog aufgeführt.
Bei dem genannten Fürsten von Liechtenstein handelte es sich um Fürst Franz Josef II. (1906-1989), der 1938 als erster Fürst Liechtensteins von Wien in das Schloss Vaduz umzog. Der Grund war die Annexion Österreichs durch die Nationalsozialisten. Die vorerst in Wien verbliebene Sammlung des Fürsten folgte, trotz Ausfuhrverbot während des Zweiten Weltkrieges, in die neue Residenz und konnte so vor Zerstörung bewahrt werden.
Die Sammlung war über Generationen des Fürstentums entstanden, bereits im 16. Jahrhundert zog sie die Aufmerksamkeit des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Rudolf II. auf sich. Sie umfasste zum Zeitpunkt des Umzugs nach Vaduz u.a. Arbeiten aus den Epochen Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus, Biedermeier und Romantik.
Wann das „Bildnis Franz von Rohden“ für die fürstliche Sammlung erworben wurde, kann nicht genau festgestellt werden. Bis 1858 legten die Fürsten Liechtensteins den Schwerpunkt ihrer Ankäufe auf Kunstwerke ihrer eigenen Epoche. Demnach könnte die Ölstudie während der Regentschaft Alois II. (1796–1858) von 1836 bis 1858 Einzug in die Sammlung gefunden haben.
Dass es zu einem Verkauf der Ölstudie kam, liegt vermutlich an den finanziellen Einbußen, die das Fürstentum nach Ende des Zweiten Weltkrieges verzeichnen musste. Vor allem um die Verluste von Ländereien in Böhmen und Mähren zu kompensieren, sah sich Franz Josef II. gezwungen, Objekte aus der fürstlichen Sammlung zu verkaufen. Dazu zählte wohl auch das Dortmunder Bild. So gelangte es zwischen Dezember 1950 und 1953 auf den Kunstmarkt, wo es schließlich im November 1953 für das Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund erworben werden konnte.
Die Provenienz des Werkes lässt sich also nicht vollkommen entschlüsseln – trotzdem offenbart die fürstliche Herkunftsgeschichte eines zunächst unscheinbaren Bildes die Wichtigkeit einer der Kernaufgaben eines Museums: intensive Forschung.
Bildzeile: Friedrich Overbeck, Bildnis Franz von Rohden, um 1835, Öl auf Leinwand.
Foto: MKK, Madeleine-Annette Albrecht

Vereidigung von Sachverständigen erstmals digital durchgeführt
HWK Dortmund freut sich über Nachwuchs
Neue Wege hat die Handwerkskammer (HWK) Dortmund beschritten. Da derzeit aufgrund der Corona-Pandemie Präsenzveranstaltungen nur eingeschränkt möglich sind, wurde die Vereidigung neuer Sachverständiger erstmals in einem digitalen Format durchgeführt. Im Rahmen einer Videokonferenz nahm Henrik Himpe, Stv. Hauptgeschäftsführer der HWK Dortmund Sebastian Sudhoff aus Werl für das Tischlerhandwerk sowie Heinz-Rüdiger Beck aus Dortmund für das Elektrotechnikerhandwerk den Eid ab.
„Wir wollten nicht hinnehmen, dass es durch die Corona-Pandemie zu zeitlichen Verzögerungen im Bestellungsverfahren kommt“, sagt Himpe. Die HWK Dortmund freue sich schließlich auch im Bereich des Sachverständigenwesens über jeden geeigneten Nachwuchs, so der Jurist. Nach Durchlaufen des üblichen Bewerbungsverfahrens mit rechtskundlichen Schulungen, Überprüfung der persönlichen Eignung und Nachweis der überdurchschnittlichen Fachkenntnisse kann die Kammer jetzt auf insgesamt 123 öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige in 40 verschiedenen Gewerken verweisen. Diese stehen als ausgewiesene Fachleute Gerichten wie auch Privatpersonen bei der Beurteilung fachlich-technischer Fragen zur Seite. Ein bundesweites Verzeichnis der von den Handwerkskammern öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist zu finden unter www.svd-handwerk.de
Wer Interesse an einer Sachverständigenbestellung hat, kann sich an die HWK Dortmund wenden.
Kontakt
Andrea Frey
Tel.: 02315493-137
E-Mail: andrea.frey@hwk-do.de
Bildzeile: v.l.: Henrik Himpe, Stv. Hauptgeschäftsführer der HWK Dortmund, rechts oben: Sebastian Sudhoff (Werl), Sachverständiger für das Tischlerhandwerk,
rechts unten: Heinz-Rüdiger Beck (Dortmund), Sachverständiger für das Elektrotechnikerhandwerk und kleines Bild rechts unten: HWK-Assessorin Andrea Frey.
Foto: HWK Dortmund

Innung macht Dachdecker-Fachtag
erstmals zu virtueller Tagung
Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen hatte hochkarätige Referenten zu Informationsveranstaltung für Innungsbetriebe im Web geladen
Ausschließlich vor Bildschirm und Beamer fand in diesem Jahr der traditionelle Dachdecker-Fachtag des Dortmunder und Lüner Dachdecker-Handwerks statt. Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich zum 12. Branchentreff per PC und Webcam angemeldet. Insgesamt vier Stunden fachlicher Austausch mit geballtem Wissen rund um das Dachdecker-Handwerk standen auf dem Programm.
Vier Themen im Fokus
Dirk Sindermann, Obermeister der Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen sowie Energieeffizienz-Experte für Förderprogramme des Bundes, referierte vor den Teilnehmenden über Möglichkeiten zur KfW/Bafa-Förderung und zum Steuerbonus. Über die „Sonderkonstruktion Barrierefreie Übergänge auf genutzten Dachflächen“ und deren Anforderungen, Risiken und Lösungen sprach Dachdeckermeister Jürgen Gerbens von der Gesellschaft zur Förderung des westfälischen Dachdeckerhandwerks mbH. Ein weiteres Thema galt der Aufgabenmanagementsoftware „MeisterTask“. Barbara Beyer, Betriebsberaterin und Organisationscoach, beschrieb die Vorteile der Software. Und zum Schluss informierte Jan Redecker, Dachdeckermeister und Technischer Referent des ZVDH, über Neuigkeiten bei Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.
Beste Lösung im Lockdown gefunden
„Das Online-Seminar war sehr informativ und ein voller Erfolg. Sicher ist es schöner, die Kolleginnen und Kollegen persönlich zu treffen, aber dennoch denke ich, dass das digitale Format auch in Zukunft seinen Platz behalten wird“, beurteilte Dirk Sindermann die Veranstaltung und ihre besondere Form. „Wer in unserem Handwerk erfolgreich sein will, muss am Ball bleiben. Das gilt vor allem für das fachliche Know-how, das durch Innovationen einem ständigen Wandel unterliegt. Nur wer bereit ist zu lernen und im kollegialen Austausch Wissen und Erfahrungen zu nutzen, der wird sich selbst, seinen Beruf und seinen Betrieb auf lange Sicht zukunftsfähig machen und halten können“, so der Obermeister.
Dachdecker-Innung ist starker Verbund
Die Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen ist ein starker Verbund aus rund 60 Handwerksunternehmen der Region. Sie vertritt die Dachdecker-Betriebe in wichtigen regionalen und überregionalen Gremien und verleiht ihrer Stimme gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch Gewicht. Den Mitgliedsbetrieben bietet die Innung als Dienstleister einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Sie kümmert sich um Aus- und Weiterbildung, aber auch um juristische Unterstützung, günstige Versicherungsleistungen und aktuelle Informationen zur Betriebsführung.
Bildzeile: Energetische Sanierung war eines der großen Themen des Dachdecker-Fachtags.
Foto:Innung

Viel mehr als eine Kooperationsvereinbarung – Wir helfen Familien
Beratungsstelle Arbeit der AWO Dortmund & Familienkasse NRW Ost
Im Jahr 2018 haben die Beratungsstelle Arbeit der AWO und die Familienkasse NRW Ost das Netzwerk
für Familienleistungen in Dortmund gegründet. Beteiligt sind zahlreiche Akteure, die Familien und Kinder
in der Stadt Dortmund unterstützen. Ziel der Netzwerkarbeit ist es, Leistungen für Familien bekannter
und zugänglicher zu machen, damit diese auch tatsächlich bei den Familien ankommen.
Bei den regelmäßig stattfindenden trägerübergreifenden Veranstaltungen stellen die beteiligten Institutionen
abwechselnd ihre Arbeit und etwaige Besonderheiten vor. Es finden interne Schulungen zu den
Leistungen Kindergeld und Kinderzuschlag statt sowie ein offener Austausch zu Fragestellungen und
Bedarfen der beteiligten Stellen. Die seitens der Familienkasse NRW Ost am Standort Dortmund eingerichtete
Hotline dient als direkter und unbürokratischer Kontakt für die Beteiligten. Sie trägt wesentlich
dazu bei, dass den von den Trägern beratenen Familien schnell und unkompliziert geholfen wird.
Frau Gisela Tripp (Leiterin der Beratungsstelle Arbeit der Arbeiterwohlfahrt Dortmund):
Arbeitslosigkeit und Armut betrifft das gesamte Leben, das der Familien und der Kinder. Es ist ein in
hohem Maße verwaltetes Leben.
Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir bereits seit 2018 eine intensive Zusammenarbeit mit der
Familienkasse Dortmund haben. Wir planen und organisieren gemeinsam Fortbildungen für MitarbeiterInnen
in sozialen Einrichtungen, um uns für unsere Beratungstätigkeit weiter zu qualifizieren und voneinander
zu lernen.
Wir helfen gemeinsam Familien rund um Fragen des Kindergeldes und des Kinderzuschlages und können
durch den direkten persönlichen Kontakt ins „Amt“ viele Fragen unbürokratisch klären.
Ein herausragendes Beispiel für die Öffnung einer Behörde zu den sozialen Problemlagen und sozialpolitischen
Themen in unserer Stadt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Sabine Hellweg (Leiterin der Familienkasse NRW Ost):
Die Gründung des Netzwerkes war und ist für mich wegweisend für ein neu definiertes Miteinander
unter Beteiligung der Familienkasse in Dortmund. Gleichzeitig war es der Türöffner in die
außergewöhnlich ausgeprägte Netzwerklandschaft der Stadt Dortmund mit all ihren Institutionen und
Trägern. Ich bin Frau Gisela Tripp und Frau Andrea Torlach überaus dankbar, die dies ermöglicht
haben. Nach drei Jahren der Zusammenarbeit ist es aus meiner Sicht mehr als angebracht von mit der
Familienkasse zusammenwirkenden Partnern zu sprechen.
Mir ist bewusst, dass es noch sehr viele weitere Ansatzpunkte gibt und stets Entwicklungspotential bestehen
wird. Wir als Familienkasse werden diesen eingeschlagenen Weg weiter beschreiten und uns
an dem Ausbau zu Straßen, Schnellstraßen, Bundesstraßen der beratenden Hilfestellung für Familien
und Kinder intensiv beteiligen.
Eine zeitnahe Zukunftsvision ist die Gründung einer gemeinsamen Anlaufstelle, bei der verschiedene
Institutionen, auch Vertreter der Familienkasse, unter einem Dach anzutreffen sind. So verkürzen sich
die Wege der Familien und der Austausch der Institutionen wird vereinfacht.
Ich freue mich sehr auf weiteres gemeinsames Agieren zum Wohle und Nutzen der Familien.
Bildzeile: links Sabine Hellweg (Leiterin der Familienkasse NRW Ost), rechts Gisela Tripp (Leiterin der Beratungsstelle Arbeit der Arbeiterwohlfahrt Dortmund).
Foto: Arbeitslosenzentrum Dortmund

Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund jetzt in neuer Zusammensetzung
In diesem Jahr erhält der Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund gleich vier neue Mitglieder. In seiner Sitzung am 23. Februar 2021 wurden die Ratsmitglieder Hannah Sassen (Bündnis 90/Die Grünen), Ingrid Reuter (Bündnis 90/Die Grünen) und Veronika Rudolf (SPD) sowie als Sachverständiger für Vermessungsfragen Udo Kunze durch Bürgermeister Norbert Schilff neu in den unabhängigen Ausschuss zur gewissenhaften Ausübung ihrer Tätigkeit verpflichtet. Als Geschäftsführer fungierte erstmals Christian Hecker (Abteilungsleiter im Vermessungs- u. Katasteramt). Dem Ausschuss gehören nach der Gemeindeordnung NRW immer 5 Personen (2 davon Mitglieder*innen des Rates) und ihre Stellvertreter*innen an, die Geschäftsführung übernimmt die Stadt Dortmund. Die Mitglieder*innen des Ausschusses werden vom Rat der Stadt verpflichtet.
Der Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund realisiert schon seit dem Jahr 1949 Bebauungspläne durch das Instrument der Baulandumlegung. Dabei werden Grundstücke so umfassend neu geordnet, dass sie zweckmäßig bebaut und genutzt werden können oder/und Platz entsteht für Verkehrs- und sonstige Infrastrukturflächen. Mit diesem ebenso effektiven wie wirtschaftlichen Grundstückstauschverfahren können unbebaute Gebiete erstmalig erschlossen, aber auch bereits bebaute Gebiete neu geordnet und völlig umstrukturiert werden.
So konnten in den letzten Jahren u.a. die großen Neubaugebiete wie die Brechtener Heide, das Erdbeerfeld in Mengede oder Bergfeld in Hombruch durch Maßnahmen der Bodenordnung realisiert werden. Zur Umsetzung eines Bebauungsplans werden in der Umlegung als amtlichem Grundstückstauschverfahren u.a. die Grundstückswerte vor der Umlegung (ohne Baumöglichkeit) und nach der Umlegung (als Bauland) ermittelt. Diese sogenannte Einwurfs- und Zuteilungswerte werden durch die Geschäftsstelle zusammen mit der Neuaufteilung der Grundstücke im Umlegungsplan zusammengefasst. Zudem führt die Geschäftsstelle die Verhandlungen mit allen Eigentümern, um einen fairen Interessensausgleich herzustellen.
Der Umlegungsausschuss berät und beschließt das Umlegungsverfahren in nichtöffentlicher Sitzung. Hervorzuheben ist das Surrogationsprinzip. Damit ist gemeint, dass sich das Eigentum ungebrochen an einem örtlich veränderten Grundstück fortsetzt.
Für die Beteiligten hat ein Bodenordnungsverfahren zahlreiche Vorteile. Neben der fachlichen Betreuung fallen u.a. keine Grunderwerbssteuer, Notar-, Grundbuch- und Vermessungskosten an. Zur Durchführung bedient sich der Umlegungsausschuss einer Geschäftsstelle, die beim städtischen Vermessung- und Katasteramt angesiedelt ist.
Kontaktmöglicheiten:
Geschäftsstelle des Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund, Märkische Str. 24-26, 44141 Dortmund. Tel.: 0231/50-26412, E-Mail: umlegungsausschuss@stadtdo.de.
Bildzeile: v.l. Udo Kunze, Veronika Rudolf, Ingrid Reuter, Hannah Sassen, Bürgermeister Norbert Schilff.
Foto: Anja Kador / Stadt Dortmund

Trauerreden trainieren in einer lichtdurchfluteten Abschiedshalle
Die Ausbildung für Menschen, die professionell Trauerreden halten wollen, findet jetzt statt in der neuen, großzügigen Trauerhalle mit Dachterrasse im HAUS Am Gottesacker – gegenüber vom Hauptfriedhof. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen der Friedhofsgärtner Dortmund eG und dem Verein Forum Dunkelbunt e.V..
„Es ist ein großes Glück, dass diese Kooperation zustande kommt“, freut sich Beate Schwedler, Vorsitzende des Vereins Forum Dunkelbunt. Der Verein hat – mitten im Corona-Winter-Lockdown – eine Ausbildung geplant für Menschen, die lernen wollen, professionell Trauerreden zu halten. „Wir wollten dieses Training unbedingt als Präsenz-Lehrgang durchführen, brauchten aber coronabedingt mehr Platz, als in unseren Vereinsräumen zur Verfügung steht.“ So kam man auf die Idee, auf eine Trauerhalle auszuweichen – was die Umgebung zudem noch realistischer macht.
Fündig wurde der Verein bei der neusten Trauerhalle, die in Dortmund gebaut wurde, in dem Gebäude der Genossenschaft der Friedhofsgärtner – Bestattungen Weber. In dem Neubau gegenüber dem Hauptfriedhof Dortmund befindet sich im zweiten Stock eine lichtdurchflutete Trauerhalle, grün gelegen unter Platanen, angrenzend an eine luftige Terrasse. Die Halle bietet unter derzeitigen Corona-Auflagen Platz für 18 Trauergäste. Somit ist einerseits gewährleistet, dass der Kurs corona-konform in Präsenz stattfinden kann. Andererseits üben die angehenden Redner*innen, wie Trauerfeiern derzeit ablaufen.
„Beste Bedingungen, um das Flair einer Trauerfeier herzustellen,“ freut sich Schwedler. Jolanthe Nowakowski, Prokuristin der Friedhofsgärtner Dortmund eG, ergänzt: „Wir freuen uns, dem Kurs für professionelle Trauerreden eine passende Umgebung zur Verfügung stellen zu können. Felix Frohn, Bestattermeister der Genossenschaft, nimmt ebenfalls an dieser Ausbildung teil, um künftig unseren Kunden hauseigene Trauerreden anbieten zu können.“
In dem Kurs, der Mitte April 2021 startet, sind aktuell nur noch drei Plätze frei. Weitere Infos sind unter www.forum-dunkelbunt-verein.de erhältlich.
Bildzeile: Die Trauerhalle der Friedhofsgärtner Dortmund eG – Bestattungen Weber bietet den perfekten Rahmen für die Ausbildung für Menschen, die professionell Trauerreden halten wollen.
Foto: Friedhofsgärtner Dortmund eG

Nachhaltigkeit: Höhere Förderung für Gebäudesanierung Neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gestartet
Wer eine energetische Modernisierung seines Hauses oder Wohnung durchführen möchte, bekommt dafür jetzt mehr Geld vom Staat. Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) macht‘s möglich.
Hausbesitzer, Pächter und Mieter von Wohngebäuden können mit einem staatlichen Zuschuss von bis zu 15.000 Euro pro Maßnahme rechnen. Für Nichtwohngebäude gibt es bis zu 200 Euro pro saniertem Quadratmeter. Die Höhe des Zuschusses für die geförderten Einzelmaßnahmen variiert je nach Bereich, also Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik (außer Heizung), Anlagentechnik zur Wärmerzeugung, Heizungstechnik sowie Fachplanung und Baubegleitung.
Finanzielle Unterstützung gibt es auch für die Fachplanung, Baubegleitung, Fördermittelantragsstellung und Projektabwicklung durch qualifizierte Experten. Für den Bereich Nichtwohngebäude beträgt der Fördersatz 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben auf maximal 20.000 Euro. Neu hinzugekommene Einzelmaßnahmen für Bestandsgebäude (Mindestalter fünf Jahre) sind u. a.: Kältetechnik zur Raumkühlung und der Einbau von Beleuchtungssystemen, Gebäudeautomatisierung in Wohngebäuden, Lüftungsanlagen sowie der Ersatz oder Einbau von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung.
Mit der „Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ bietet die Handwerkskammer Dortmund Handwerksbetrieben bei allen Fragen rund um eine energieeffiziente, klimafreundliche und damit langfristig kostengünstige Betriebsweise direkte Unterstützung.
Foto © goodluz/123rf.com

Schönere Aufkleber für „Rolli an Bord“
Die Idee entstand bei Eltern des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Löwenzahn: Sie wünschten sich schönere und weniger dröge Auto-Aufkleber, die symbolisieren, dass man einen Rollstuhl an Bord hat. Jetzt bietet Löwenzahn eine frische Alternative an.
Gestaltet hat die Aufkleber Grafikerin Elke Bussemeier aus Unna. Mit frischem Schwung und einer leichten „Handschrift“ sehen diese Aufkleber weitaus freundlicher aus als die altbekannten Modelle.
Wer möchte, kann sich den Aufkleber kostenlos bestellen beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn, E-Mail: dietlindeeberts@forum-dunkelbunt.de
Bildzeile: Diesen Aufkleber können sich Familien bestellen beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn.

„nordwärts vor Ort“: Firma spendet 1000 FFP2-Masken
Das Koordinierungsprojekt „nordwärts“ mit dem Projektbüro “nordwärts vor ort“ in der Mallinckrodtstraße 2 betreut auch Betriebe der migrantischen Ökonomie. Aus der Arbeit mit einem der Unternehmen erwuchs die Idee, besonders bedürftige Menschen mit den jetzt durch die Corona-Schutzverordnung in bestimmten Fällen vorgeschriebenen FFP2-Masken zu versorgen.
Skenderbeg Qazimi von der QRDO GmbH aus der Dortmunder Nordstadt hat nun 1000 FFP2-Masken gespendet. Empfängerin ist die Winternothilfe am Dortmunder U. „Wir betreiben auf dem Gelände des Dortmunder U ein Großzelt für wohnungslose Menschen und geben dort zweimal täglich eine Mahlzeit heraus. Dabei können wir unser Publikum mit den dringend benötigten Masken versorgen“, sagt Michael Vogt von der Winternothilfe. Der Stuttgarter Unternehmer Qazimi mit Wurzeln im Kosovo gründete vor einem guten Jahr das Unternehmen QRDO GmbH „Im Spähenfelde“ 51 am Borsigplatz. QR steht für ein QR-Code-basiertes Produkt und DO für das Stadtkürzel Dortmund. Die Firma hat das Produkt „LIQES“ entwickelt, das eine vollständige, digitale Bekanntheitssteigerung von lokalen Unternehmen bundesweit fördert. Kund*innen scannen mit dem Smartphone den QR-Code auf einem Aufsteller in denen von ihnen besuchten Geschäften und haben die Möglichkeit, die Instagram- oder Facebook-Seite zu „liken“ oder eine Google-Bewertung abzugeben. Im Gegenzug erhalten sie „LIQES-Punkte“, die gegen Wertgutscheine eingelöst werden können.
Start-Up-Unternehmer Qazimi wurde auf das Büro „nordwärts vor ort“ mit dessen Förderprogramm „Digitale.Wirtschaft.Nordstadt“ aufmerksam. „Ich hatte zuvor nirgendwo eine Arbeit hinsichtlich der ethnischen Ökonomie gesehen. Ich bin ein bundesweit aktiver Vertriebler und schaue mir immer wieder an, welche Projekte Kommunen und Gemeinden anbieten. Ein solches Projekt hatte ichzuvor aber noch nicht gesehen. Als Anerkennung unterstütze ich die Bedürftigsten in dieser Stadt mit meiner Maskenspende.“
Orhan Öcal, Projektmanager bei „nordwärts vor ort“, sieht in Skanderbeg Qazimi einen wertvollen Partner, um die Digitalisierung bei migrantischen Unternehmen im nördlichen Dortmund voranzutreiben. „Wir schauen auf Produkte wie dieses. Wir möchten die Landschaft der Unternehmer und Unternehmerinnen mit einfachen technischen Lösungen motivieren, ihre Produkte elektronisch und damit auch viel besser überregional zu präsentieren und zu vertreiben. Das steigert den Absatz und sichert die Unternehmensbasis.“
Die QRDO GmbH wird auch im künftigen „Unterstützungszentrum ethnische Ökonomie (UZEÖ)“ eine aktive Rolle einnehmen. Wer sich über das Unterstützungszentrum und das Projekt „Digitale.Wirtschaft.Nordstadt“ informieren möchte, findet folgende Ansprechpartner:
“nordwärts vor ort“, Mallinckrodtstr. 2, 44145 Dortmund Frank Artmeier, frank.artmeier@stadtdo.de, 0231/28 67 39–11, Orhan Öcal, ooecal@stadtdo.de, 0231/28 67 39–16
Bildzeile: Saranda Xhylani (Finanzcontrolling QRDO), Qazimi Skenderbeg (CEO QRDO). Hinten v.l.: Michael Vogt (Team Wärmebus), Orhan Öcal (Projektmanager Digitale Wirtschaft Nordstadt)
Foto: Stadt Dortmund / Torsten Tullius

Imagekampagne war voller Erfolg
für das Gebäudereiniger-Handwerk
Gebäudereiniger-Innung Dortmund warb mit Plakaten, Promi-Mailing und Gewinnspielen in sozialen Medien für das Handwerk und den eigenen Beruf / Große Resonanz von Jugendlichen zeigt Attraktivität des Ausbildungsberufs
„Unser schönstes Ergebnis: Strahlende Gesichter”, „Sichere Arbeitsplätze für 700.000 Menschen“ oder „Krankenhauskeime brauchen einen starken Gegner!”: Mit diesen und weiteren flotten Slogans auf bunten Plakaten warb die Gebäudereiniger-Innung Dortmund sechs Wochen lang für ihr attraktives und zukunftssicheres Handwerk. Jetzt zog die Standesorganisation der Gebäudereiniger eine positive Schlussbilanz. „Wir haben mit unserer Aktion sehr erfolgreich die Imagekampagne unseres Bundesinnungsverbands umgesetzt und erfreulich viele Menschen erreicht“, resümiert Innungsobermeister Kai-Gerhard Kullik. „Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass wir viele junge Menschen erreicht haben und bei einigen sogar Interesse für eine Ausbildung in unserem Beruf geweckt haben.“
Vielfältigen Beruf beworben
Insgesamt hatte die Innung über ihre 46 Mitgliedsbetriebe 1.000 Plakate in einem Gebiet von Dortmund und Lünen über Unna und Hamm bis hin nach Lippstadt verteilen lassen. Gleichzeitig warben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen mit dem Aufkleber „Ich bin stolz, Gebäudereiniger zu sein“ in der Öffentlichkeit für ihren Beruf. „Das Gebäudereiniger-Handwerk hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Wandel vollzogen. Wir sind heute längst nicht mehr nur fürs Saubermachen zuständig“, erklärt dazu Innungsgeschäftsführer Volker Walters. „Gebäudereiniger arbeiten heute vielfach im Facility-Management und erbringen Service- und Dienstleistungen rund um das Gebäudemanagement. Das reicht von Hausmeisterdiensten über Grünflächenpflege und Winterdienst bis zu Hol- und Bringdiensten und sogar Catering-Services.“
Große Resonanz in Sozialen Medien
Das machte die Innung auch mit einem Brief an Prominente, Entscheider und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in Dortmund deutlich, in dem sie auf die Bedeutung ihres Handwerks als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor für die Region hinwies. Gerade die Pandemie, so schrieb die Innung, habe gezeigt, wie wichtig und systemrelevant der Beruf des Gebäudereinigers sei. „Eine schöne Bestätigung war für uns die hohe Beteiligung an unseren Gewinnspielen in den sozialen Medien im Zuge der Kampagne“, freut sich Obermeister Kai-Gerhard Kullik. „50.000 Klicks, über 600 Likes und 80 Teilnehmer allein auf Instagram haben uns gezeigt, wie attraktiv der Beruf gerade für junge Menschen ist.“ Derzeit, so der Obermeister, seien in Dortmund noch Ausbildungsplätze für das laufende Jahr zu vergeben. Wer sich für den Beruf des Gebäudereinigers interessiere, könne sich direkt bei der Innung melden, die Kontakte zu Ausbildungsbetrieben herstelle.
Wichtiger Wirtschaftsfaktor
Mit rund 700.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Gebäudereiniger das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland. Es hat mehr Beschäftigte als VW, BMW, Daimler-Benz und alle anderen Automobilhersteller in Deutschland zusammen. Allein 5.000 Menschen arbeiten für die 46 Innungsbetriebe. Leistungsstarke, qualitätsorientierte Unternehmen, die sich seit rund 100 Jahren mit modernster Technik, innovativen Verfahren und hoher Flexibilität ihren ständig wachsenden Herausforderungen stellen.
Gebäudereiniger-Innung ist starker Verbund
Die Gebäudereiniger-Innung Dortmund ist ein starker Verbund der Handwerksunternehmen der Region. Sie vertritt die Gebäudereiniger-Betriebe in wichtigen regionalen und überregionalen Gremien und verleiht ihrer Stimme gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch Gewicht. Den Mitgliedsbetrieben bietet die Innung als Dienstleister einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Sie kümmert sich um Aus- und Weiterbildung, aber auch um juristische Unterstützung, günstige Versicherungsleistungen und aktuelle Informationen zur Betriebsführung.
Bildzeile: Zogen eine positive Bilanz der Imagekampagne des Gebäudereiniger-Handwerks in Dortmund: Obermeister Kai-Gerhard Kullik (l.) und Geschäftsführer Volker Walters (r.).
Foto: Innung

VOLKSWOHL BUND Versicherungen:
Frisch geprüfte Kaufleute
für Versicherungen und Finanzen erhalten Abschlusszeugnisse
Vorstand vergibt Stipendien für Fortbildung
Sechs junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VOLKSWOHL BUND Versicherungen haben jetzt ihre Abschlusszeugnisse als Kaufleute für Versicherungen und Finanzen erhalten.
Zu den bestandenen Prüfungen gratulierte Dietmar Bläsing, Sprecher der Vorstände der VOLKSWOHL BUND Versicherungen und zugleich Personalvorstand, per Videokonferenz.
Symbolisch überreichte er die Abschlusszeugnisse des Unternehmens zusammen mit einem Anerkennungsschreiben des Hauses. Alle sechs erzielten die Abschlussnote „gut“. Für die Prüfungen mit der höchsten Punktzahl erhielten zwei Absolventinnen je ein Stipendium, das ihnen beispielsweise die Weiterbildung zur Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen ermöglicht.
Im Gespräch hob Dietmar Bläsing hervor, welche besondere Leistung es war, die Ausbildung unter den erschwerten Corona-Bedingungen innerhalb der regulären Zeit zu absolvieren. Die jungen Angestellten ermunterte er dazu, immer wieder eigenen Ideen anzubringen: „Das sind wichtige Impulse, die dabei helfen, unser Unternehmen weiterzubringen.“
Die sechs Absolventinnen und Absolventen sind bereits in verschiedenen Abteilungen für das Unternehmen tätig. Zwei von ihnen absolvieren zugleich noch den Dualen Studiengang Versicherungswirtschaft an der Fachhochschule Dortmund.
VOLKSWOHL BUND Versicherungen
Simone Szydlak
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Südwall 37 – 41
44137 Dortmund
0231/5433-451
Fax 0231/5433-450
presse@volkswohl-bund.dex

Gestaltungsbeirat traf sich virtuell – seit 19 Jahren im Dienst für eine gut gestaltete Stadt
Die Sitzung des Gestaltungsbeirates im Februar hat pandemiebedingt erstmalig komplett in digitaler Form als Videokonferenz stattgefunden. Bis dahin waren die Treffen noch mit Präsenz, aber mit großem Abstand durchgeführt worden.
Zum Start in die fünfte Beratungsperiode begrüßte Oberbürgermeister Thomas Westphal die Mitglieder des Beirates.
Prof. Christian Schlüter wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt, der Architekt Christian Decker zu seinem Stellvertreter.
Neu in der Runde der externen Fachleute ist der Architekt Achim Pfeiffer als Fachmann für denkmalgerechtes Bauen, der in Essen mit „Böll Architekten GmbH“ seinen Bürostandort hat und an der FH Dortmund „Baukonstruktion und Bauen im Bestand“ lehrt.
Die international tätige bildende Künstlerin Prof.in Vera Lossau wurde ebenfalls neu in den Gestaltungsbeirat berufen. Sie betreibt ihr Atelier in Düsseldorf und ist im Lehrgebiet „Grundlagen der Gestaltung, Schwerpunkt plastisches und räumliches Gestalten“ am Fachbereich der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur tätig.
Seit mittlerweile 19 Jahren berät der Gestaltungsbeirat in Dortmund sehr erfolgreich Bauherrschaft, Architekt*innen und Planer*innen bei deren Konzepten und Projekten. In dieser Zeit wurden in 124 Sitzungen (zuzüglich Sondersitzungen und Exkursionen) ca. 880 Projekte beraten.
Am 20. Februar 2020 fand die erste Sitzung des Gestaltungsbeirates im Vorjahr statt. In fünf Sitzungen (eine wurde coronabedingt abgesagt) wurden insgesamt 34 Projekte beraten, einige davon mehrfach.
Themenbereiche und beispielhafte Projekte des Jahres 2020:
Städtebauliche Konzepte für Stadtquartiere, deren Konkretisierung z.B. im Kronprinzenviertel auf der Tagesordnung stand.
Bauvorhaben auf PHOENIX West, wie z.B. der Neubau eines Bürogebäudes mit Tageseinrichtung für Kinder und Parkdeck.
Wohn-, Büro- und Geschäftsbauten – da ist z.B. in Lütgendortmund die Revitalisierung eines Kaufhauses und der Neubau von Seniorenwohnungen zu nennen.
Büroneubauten an der B1.
Supermärkte und Discounter, die nach aktuellen Beschlüssen mit einer Wohnbebauung kombiniert werden – wie eine Nettofiliale in Kirchderne mit 22 Wohneinheiten.
Neubauten der Städtischen Kliniken.
Beratung für Qualifizierungs- und Werkstattverfahren wie z.B. für das Westfalenforum.
Mehrfach empfahl der Gestaltungsbeirat die Durchführung eines Qualifizierungsverfahrens, das eine besonders intensive Auseinandersetzung mit einer Bauaufgabe ermöglicht. Der fachliche Leistungsvergleich bietet die Chance vor Vergabe eines konkreten Auftrags, verschiedene Entwurfskonzepte hinsichtlich ihrer Gestaltung, ihrer städtebaulichen Dimensionen sowie ihrer Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Mehrere Wettbewerbsverfahren wurden so unter Beteiligung von Mitgliedern des Gestaltungsbeirates erfolgreich durchgeführt.
Die in den Vorjahren in wechselndem Turnus durchgeführten Exkursionen in verschiedene Stadtgebiete und Cityrundgänge mussten wegen der Corona-Pandemie leider entfallen. Nun hegen alle Beteiligten die große Hoffnung, dass Vor-Ort-Begehungen und Bereisungen gemeinsam mit Medienvertreter*innen vielleicht bald wieder möglich sein werden.
20-jähriges Jubiläum im November
Der Gestaltungsbeirat wird im November 2021 zwanzig Jahre alt. Dies soll mit einer Publikation und – falls möglich – auch mit einer Jubiläumsveranstaltung gewürdigt werden.

Fachhochschulreife mit 1,0 – Es ist nie zu spät für alles
Eigentlich sollte Sarah Kohlmanns Schulzeit einen geraden Weg nehmen: Grundschule, Gymnasium, natürlich beendet mit einem ordentlichen Abschluss. Aber es kam alles anders. Auf dem Zweiten Bildungsweg gelang schließlich der Abschluss, und der mit einem Riesenerfolg.
Als Sarah Kohlmann aus Schwerte ihren Schulweg begann lief zunächst alles bestens: die heute 24jährige besuchte nach der Grundschule ein Privatgymnasium. Allerdings fehlte dort ein Angebot, dass ihre Leidenschaft für Sport und die Schule hätte verbinden können. Daher wechselte Sarah Kohlmann in der 9. Klasse auf ein „normales“ staatliches Gymnasium. „Das war eine riesige Umstellung“, so die 24jährige heute im Rückblick. So gab es zwar die ersehnte Sportklasse, dafür aber auch große Klassen und wenig individuelle Betreuung. „Außerdem hatten wir auch durch den Sport bedingt sehr, sehr lange Unterrichtstage, dazu kamen anschließend noch die Hausaufgaben“, erinnert sich Kohlmann. Sie fühlte sich außerdem sehr auf sich selbst zurückgeworfen, weil einerseits große Selbstdisziplin gefordert wurde, andererseits aber Struktur und Regeln fehlten. „Nach einem Jahr war ich nur noch ernüchtert und frustriert, meine Noten sackten ab“, bilanziert die Schwerterin. Schließlich folgte ein Wechsel auf die Gesamtschule. Hier wurde sie sofort in die Jahrgangsstufe 11 eingestuft, ohne zuvor ihre FOR machen zu können. Als sie dann die 12. Klasse aus privaten Gründen abbrach, hatte sie keinen Abschluss der 10. Klasse. Das war ein Tiefpunkt.
Untätig blieb Sarah Kohlmann dennoch nicht. Nach einem Sozialen Jahr arbeitete sie als Integrationshelferin. Das lag nahe, da sie bereits seit Jahren ihren zu 90 Prozent schwerbehinderten Bruder mit betreute, so war sie sich sicher, gut mit Kindern arbeiten zu können.
Während der Zeit als Integrationshelferin reifte der Gedanke die abgebrochene Schullaufbahn wieder aufzunehmen und den Schulabschluss nachzuholen. Das war ein mühsamer Weg, denn trotz fast zwölf Jahren Schule fehlte ja sogar ein mittlerer Schulabschluss. Zunächst besuchte sie also das 3. und 4. Semester der Abendrealschule und holte die FOR nach.
Einerseits war sie froh über diese Möglichkeit, andererseits empfand sie es zunächst als gewaltigen Schritt zurück wieder in der Mittelstufe einzusteigen.
Der Entschluss nach der FOR anschließend nicht in einen Ausbildungsberuf einzusteigen und das Westfalen-Kolleg Dortmund zu besuchen, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben, fiel rasch, denn: „Ich wollte ja weiterkommen.“ Die Beratung der Abendrealschule, den Sprung zu wagen, tat ihr übriges.
Von Anfang an wichtig war es ihr allerdings, Arbeit und Schule miteinander vereinbaren zu können, deshalb meldete sie sich am Westfalen-Kolleg für den Bildungsgang Abendgymnasium an. Beides unter einen Hut zu bringen, stellte zwar eine Herausforderung dar, aber die Motivation war groß: „Ich habe mir jeden Tag gesagt, du willst das, du schaffst das, und du schließt mit guten Noten ab.“
Außerdem fasste sie bereits frühzeitig ein konkretes Ziel für die Zeit danach ins Auge; der Besuch einer Jobmesse gab dazu den entscheidenden Impuls. Ihr Interesse galt zunächst dem Zoll, der Polizei und der Bundeswehr. Besonders angesprochen fühlte sie sich durch die Gebirgsjäger. „Ich liebe die Berge und das Skifahren“, schmunzelt Sarah Kohlmann. Viel wichtiger erschien ihr es aber noch, dass neben einer Ausbildung als Gebirgsjägerin auch ein Studium an der Bundeswehrschule möglich ist, dazu wird allerdings mindestens die Fachhochschulreife benötigt, also lautete das Ziel: FHR.
Trotz des Willens unbedingt einen guten Schulabschluss zu machen, startete Sarah Kohlmann zunächst auch mit Bedenken. „Zu Beginn empfand ich einen großen Druck (erneut) zu versagen, aber das gab sich mit der Zeit, je besser es lief“, beschreibt die 24jährige die anfängliche Situation. „Besonders erstaunt und positiv überrascht hat mich dann aber, dass die Lehrkräfte überhaupt keine Vorurteile Schulabbrechern gegenüber haben.“ Überhaupt stimmte von Anfang an alles, so zum Beispiel die gute Lernatmosphäre im Kurs mit durchweg motivierten und lernbereiten Mitstudierenden. Zu Anfang hatte sie noch Bedenken, wenn Gruppenarbeiten angesagt waren: Was wäre, wenn keiner mitmacht? Aber das Problem stellte sich gar nicht. „Außerdem hatte ich sehr engagierte und super nette Lehrer, die immer ansprechbar waren und die sich verständnisvoll zeigten, was die Vereinbarkeit von Schule und Beruf betraf“, resümiert sie heute. Und wenn man wollte, gab es immer die Möglichkeit etwas zusätzlich zu bearbeiten. So fühlte sie sich mit allem gut versorgt, auch in Zeiten der pandemiebedingten Schulschließung, die eine zusätzliche Herausforderung darstellte.
Nun warten neue Ziele, neue Pläne. Zunächst die Ausbildung als Gebirgsjägerin in Süddeutschland, das bedeutet drei Monate Grundausbildung in Weiden in der Oberpfalz, anschließend folgen neun Monate bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall. Innerhalb der ersten sechs Monate kann Sarah Kohlmann dabei ihre Entscheidung noch mal revidieren, sich für 13 Jahre zu verpflichten. Nach dem Jahr plant sie die Prüfung für das Studium an der Bundeswehrhochschule abzulegen. Psychologie ist für sie das Studium der Wahl.
„Wichtig war es neben dem fachlichen Interesse an einem Studiengang, etwas zu wählen, das mir auch nach einer Zeit bei der Bundeswehr, also nach den 13 Jahren eine berufliche Perspektive im zivilen Leben eröffnet, falls ich dann nicht mehr bei der Bundeswehr bleiben möchte“, erläutert Kohlmann. So verspricht sie sich vom Studium der Psychologie die Möglichkeit auch in Unternehmen, Behörden oder auch selbständig, z.B. als Kinderpsychologin, arbeiten zu können.
Auch durch ihre Zeit am Westfalen-Kolleg fühlt sie sich gut gewappnet, denn die hat ihr nicht nur einen herausragenden FHR-Abschluss mit 1,0 als Ergebnis gebracht und ihr damit bislang verschlossene Türen zu neuen beruflichen Perspektiven geöffnet. Auch manche Erkenntnis nimmt sie mit: „Besonders das gemeinsame Lernen mit einem 50-jährigen Mitstudierenden hat mir gezeigt: Man muss sich nicht schämen, wenn bisher nicht alles so glatt gegangen ist, man ist nie zu alt etwas zu lernen, es gibt heute so viele Möglichkeiten.“
Foto: Westfalenkolleg Dortmund

Neuer Internetknoten für das Ruhrgebiet in Betrieb: DOKOM21 Rechenzentren beheimaten Ruhr-CIX
Die drei regionalen Netzbetreiber DOKOM21, GELSEN-NET und TMR starten mit Ruhr-CIX in die Zukunft des Datenverkehrs
Der neue Internetknoten Ruhr-CIX (Ruhr-Commercial Internet Exchange) ist jetzt in Betrieb gegangen. Der von DOKOM21, GELSEN-NET und TMR gegründete Ruhr-CIX ist ein Internetknoten für das Ruhrgebiet, der die Städte Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen verbindet. Damit starten die drei regionalen Netzbetreiber in die Zukunft des Datenverkehrs.
Ruhr-CIX dient der Verbesserung der Internetqualität
Ruhr-CIX dient der Verbesserung der Internetqualität und der internationalen Anbindung des größten deutschen Ballungsraumes Ruhrgebiet und der Wirtschaftsregion Südwestfalen. Der technische Betrieb der Internetknoten-Plattform wird von DE-CIX sichergestellt, dem Betreiber des weltgrößten Internetknotens in Frankfurt am Main.
Über einen Hochgeschwindigkeits-Glasfaserring auf n mal 100 Gigabit-Basis sind die drei beteiligten Ruhrgebietsstädte Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen, über die sich der neue Internet Exchange für Daten erstreckt, bereits miteinander verbunden. Nicht nur Glasfaserstrecken sind an diesen Internetknoten angebunden, sondern auch die Rechenzentren der regionalen Netzbetreiber.
Interconnection als Zukunft der Datenkommunikation
Innovationen bestimmen das Zeitalter der Digitalisierung. Immer mehr Daten erfordern neue Lösungen, gerade für Unternehmen. Interconnection ist die Zukunft, wenn es um Datenkommunikation geht. Das öffentliche Internet ist nicht mehr die Antwort auf die Frage „Wie kann ein Unternehmen seine Daten schnell und sicher von A nach B bringen?“, sondern Interconnection – die Zusammenschaltung von Unternehmen, Rechenzentren, Clouds und Datenbanken in einem ständig wachsenden Netzwerk.
Technische Bereitstellung des Ruhr-CIX am 18. Februar 2021
Am 18. Februar 2021 erfolgte die technische Bereitstellung des neu geschaffenen Interconnection Hub Ruhr-CIX powered by DE-CIX mit Knotenpunkten in Dortmund, Gelsenkirchen und Bochum.
Angeschlossen an das weltweit führende neutrale Interconnection Ökosystem des DE-CIX in Frankfurt am Main bietet der Ruhr-CIX seinen Kunden Zugang zu Hunderten von Netzwerken und zahlreiche Interconnection Services, darunter privaten, sicheren Zugang zu Cloudanbietern.
Der Ruhr-CIX-Internetknoten ist in den Rechenzentren der Netzbetreiber und Gründer DOKOM21 in Dortmund, GELSEN-NET in Gelsenkirchen und TMR in Bochum beheimatet. Die Infrastruktur basiert auf einem hochverfügbaren Glasfasernetz.
Globales Netzwerk zum Datenaustausch für das Ruhrgebiet
„Dieses Projekt ist einzigartig – es liefert dem Wirtschaftsstandort Ruhrgebiet ein globales Netzwerk zum Datenaustausch“, erklärt Jörg Figura, Geschäftsführer von DOKOM21. „Der Netz-Zusammenschluss stärkt die Metropolregion Ruhr in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt es, Unternehmen im gesamten Ruhrgebiet noch besser zu versorgen.“
Direkte Verbindungen in die internationalen Clouds
Der Ruhr-CIX ermöglicht Unternehmen der Metropole Ruhr und der Wirtschaftsregion Südwestfalen somit die direkte Anbindung in die gängigen Clouds wie Microsoft 365, SAP Cloud Plattform, Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Plattform, IBM Cloud über exklusive Verbindungen. Bei der Anbindung über den Ruhr-CIX werden die Verbindungen des öffentlichen Internets nicht genutzt, sondern stattdessen direkte Verbindungen von den Ruhr-CIX Gründern in die internationalen Clouds hergestellt.
Bis vor kurzem wurde noch ein Großteil des gesamten Datenverkehrs im Ruhrgebiet über Frankfurt und den dortigen zentralen Datenaustauschpunkt des DE-CIX gelenkt. Aus diesem Grund gründeten die drei Regionalcarrier DOKOM21, GELSEN-NET und TMR für die Ruhrgebietsstädte Dortmund, Gelsenkirchen und Bochum über die Stadtgrenzen hinweg zusammen ein neues Ökosystem für die digitale Wirtschaft: den Ruhr-CIX.
Ruhr-CIX als zentraler Datenaustauschpunkt ohne Umwege
Der Ruhr-CIX bietet somit eine schnelle Lösung ohne die bisherigen Umwege und dient als zentraler Datenaustauschpunkt (Peering Point) im Ruhrgebiet. Kleine und mittelständige Internet-Provider können ihren Datenverkehr – sowohl regional als auch national – direkt an ein anderes Provider-Netz übergeben. Die technische Plattform dafür liefert der Ruhr-CIX.
Das Ruhrgebiet mit seinen 53 Städten und mehr als fünf Millionen Einwohnern ist die größte Metropolregion Deutschlands – mit Ruhr-CIX können Unternehmen der Region diese Menschen erreichen.
„Mit der Inbetriebnahme des Ruhr-Backbone, der die Basis des Ruhr-CIX bildet, ist eine zukunftsträchtige Grundlage zur Umsetzung der Breitbandziele und des Glasfaserausbaus im gesamten Ruhrgebiet entstanden“, sagt Jörg Figura.
www.ruhr-cix.net
Ruhr-CIX, der neue Internetknoten für das Ruhrgebiet, ist am 18. Februar 2021 in Betrieb gegangen. DOKOM21 ist Mitgründer des Internetknotens Ruhr-CIX, der unter anderem in den Rechenzentren der DOKOM21 beheimatet ist.
Foto: DOKOM21

Aschenkreuz unter freiem Himmel
Katholische Kirche in Dortmund Ost bietet „Aschenkreuz to go“
Das „Aschenkreuz to go“ am „HimmelsFlitzer“ gab es am Aschermittwoch auf dem zentralen Platz vor der evangelischen Kirche in Dortmund Brackel. Die katholische Kirche im Pastoralen Raum Dortmund Ost hatte von 15 bis 17 Uhr dazu eingeladen.
In der Coronavirus-Pandemie war dies ein sicheres Angebot unter freiem Himmel. Viele Menschen nutzen die Möglichkeit, sich auf diese Weise mit gesegneter Asche bestreuen zu lassen und so die Fastenzeit der Christen zu beginnen. Die am Aschermittwoch ausgeteilte Asche wird aus geweihten Palmzweigen des letzten Jahres gewonnen und gilt als Zeichen für Trauer und Buße. Der Aschermittwoch markiert den Beginn der 40 Tage dauernden Fastenzeit bis Ostern.
Nachhaltiger Lebensstil
„Fasten heißt nicht unbedingt, dass man auf alles Angenehme verzichten muss“, sagt Pfarrer Ludger Keite. Es gehe darum, aufmerksam zu werden für die wesentlichen Dinge, die im Alltag oft zu kurz kommen. „Dazu zählt auch ein nachhaltiger Lebensstil“, erklärt er. Fasten könne ein Genuss sein: wieder mal ein Buch zu lesen, sich Zeiten der Stille oder bewusster Musik zu gönnen, einen überfälligen Besuch zu machen oder mal wieder Sport zu treiben.
Asche auf das Haupt
Gemeinsam mit Gemeindereferentin Claudia Schmidt teilte Pfarrer Ludger Keite am „HimmelsFlitzer“ das Aschenkreuz aus. Die Gläubigen erhielten dazu eine Karte mit einem persönlichen Bibelwort sowie eine Postkarte mit dem Titel „Aschenkreuz: getragen und geborgen“. Üblicherweise wird en Kreuz mit der Asche auf die Stirn gezeichnet. In diesem Jahr wurde die Asche allerdings kontaktlos auf das Haupt gestreut.
Mit dem „Aschenkreuz to go“ fand der „HimmelsFlitzer“ erneut ein praktisches Einsatzfeld als mobiles Angebot der Kirche in Dortmund Ost. Zur Sternsingeraktion konnte in diesem Jahr bereits der Segen der Sternsinger am Kirchenmobil abgeholt werden. Mit dem dreirädrigen Fahrzeug sind Haupt- und Ehrenamtliche aus den katholischen Kirchengemeinden in Dortmund Ost bei vielen Gelegenheiten unterwegs zu den Menschen, so auch bei Straßen- und Stadtteilfesten, an Schulen, Friedhöfen und vielen weiteren Orten. Das Mobil wurde aus Mitteln des Fonds für innovative Projekte des Erzbistums Paderborn gefördert.
Weitere Informationen unter www.kirche-dortmund-ost.de
Bildzeile: Gemeindereferentin Claudia Schmidt streut das Aschenkreuz auf das Haupt eines Besuchers am Kirchenmobil „HimmelsFlitzer“ in Dortmund Brackel.
Foto: Michael Bodin / Erzbistum Paderborn

Städtediplomatie: Statement der OB von Dortmund und Pittsburgh/USA –
„Ein Neustart der transatlantischen Beziehungen zwischen Deutschland und der USA wird nur Erfolg haben, wenn die Städte in den Prozess involviert sind“
Am kommenden Freitag, 19. Februar 2021, werden weltweit ranghöchste Entscheidungsträger*innen auf der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz zusammenkommen und über die globalen Herausforderungen und die Erneuerung des transatlantischen Verhältnisses sprechen. Was fehlt, ist die Einbindung kommunaler Entscheidungsträger in den Dialog zur Verbesserung des transatlantischen Verhältnisses. Die Oberbürgermeister der Städte Dortmund und Pittsburgh fordern in einem gemeinsamen Beitrag, dass die Regierungen beider Länder die Chance nutzen müssen, in diesem Prozess auf belastbare Strukturen der Städte und kommunalen Netzwerke in den USA und Deutschland zurückzugreifen.
Oberbürgermeister Thomas Westphal, Dortmund:
„Wenn das transatlantische Verhältnis wieder auf festen Füßen stehen soll, muss die US-amerikanische und deutsche Außenpolitik sich unter Zuhilfenahme der Städte ein weiteres Instrument in den Werkzeugkoffer der Diplomatie legen: Die globale Städte-Diplomatie. Sie wird für die künftige Transformation und Ausrichtung der Außenpolitik unverzichtbar sein.“
„Die Menschen kommen gerne zu uns nach Dortmund und nach Pittsburgh – sie sind von der Lebensqualität in unseren Städten überzeugt. Wir sind daher in der Pflicht, den Weg der Stärkung von Diplomatie, der Freundschaft und der Nachbarschaft über den Atlantik zu gehen. Gemeinsam bewahren wir den Gedanken der Demokratie. Wir sind internationale Großstädte der Nachbarn“, so OB Westphal.
Oberbürgermeister William Peduto, Stadt Pittsburgh, USA:
„Wir sollten die Chance in diesem Jahr nutzen, ein dauerhaftes Format zu entwickeln, Oberhäupter der Städte in den politischen Prozess gemeinsam mit den Regierungen beider Länder zu integrieren: Ein Deutsch-Amerikanisches Oberbürgermeister*innenforum, das sich den Themen Pandemiebekämpfung, nachhaltige Stadtentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz widmet. Es ist besonders nützlich, da die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten sind und wir uns dringend mit Fragen zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz im November in Glasgow 2021 befassen müssen.“
Hintergrund:
Dortmund und Pittsburgh setzen in der Erneuerung des transatlantischen Verhältnisse auf die „Städte-Diplomatie“ („Urban Diplomacy“).
Beide Städte sind „Post-Industrial-Cities“, die ähnliche und tiefgreifende Veränderungen erlebt haben. Sie sind seit Jahren freundschaftlich verbunden und kooperieren in einigen Bereichen. Dortmund und Pittsburgh verbinden die ähnlichen Herausforderungen – wie andere Städte rund um den Globus: Pandemiebekämpfung, Migration, Digitalisierung, Mobilitätswende, Arbeitslosigkeit, Strukturwandel und Klimaschutz.
Pittsburgh und Dortmund fühlen sich nicht nur in ihrer Historie, sondern auch in ihrer Mentalität verbunden, um bspw. gut aus Krisen herauszukommen: In der Zeit der Transformation beziehen sie ihre Historie und Erbe bewusst in die zukünftige, nachhaltige Stadtentwicklung ein. Beide Städte sind heute starke Wissenschaftsstandorte mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen, lebendigen Start-Up-Szenen und Weltmarktführern aus verschiedenen Branchen und Expertisen in Zukunftstechnologien.
Bildzeile: Links Pittsburghs OB William Peduto, rechts Dortmunds OB Thomas Westphal.
Fotos: Stadt Pittsburgh / Stadt Dortmund

Mit Achtsamkeit durch die Fastenzeit
„junge kirche dortmund“ lädt zur Online-Fastenaktion ein
Jeden Tag einen Post und Videoimpulse zum Thema „Achtsamkeit“ auf Facebook und Instagram. Zu diesem Angebot lädt die katholische „junge kirche dortmund“ in der heute beginnenden Fastenzeit ein.
Nicht Verzicht, sondern Aufmerksamkeit und Anregungen für eine bewusste Gestaltung des Alltages in den Wochen bis Ostern stehen im Mittelpunkt der Aktion. „Im Lukas-Evangelium heißt es ‚Haltet euch bereit und seid wach‘ – Jesus ruft dazu auf, wie die Kinder zu sein, empfänglich, offen, interessiert, neugierig“, erklärt Simone Goerigk, Referentin für Jugend und Familie der Katholischen Stadtkirche Dortmund.
Videoimpulse
Die Videoimpulse werden mit einfachen Mitteln, beispielsweise mit dem Smartphone aufgenommen. Simone Goerigk filmt dazu in der St. Josef-Kirche in Kirchlinde eine Meditation von Gemeindereferent Michael Thiedig. Der Religionspädagoge ist zugleich auch Lehrer für Tai Ji und meditative Körperarbeit (IfB). In fünf kurzen Videosequenzen gibt Michael Thiedig kurze Anleitungen für eine Meditation, welche die Nutzer für sich zu Hause umsetzen können. Dabei sitzt er auf einem Stuhl in der alten Kirche vor dem sogenannten „Kleinen Goldenen Wunder“, dem Altarwerk aus der Antwerpener Stiftsschule der Zeit um 1520, ein Ort, wie geschaffen für ein Meditationsangebot.
Atmung
Für den Meditations-Lehrer ist aber nicht so sehr der Ort entscheidend: vor allem still sollte es sein, damit innere Ruhe möglich wird. „Du brauchst einen Ort, an dem Du wirklich absolut ungestört bist“, rät er. Atmung ist wichtig. „Richte Deine Aufmerksamkeit auf das Spüren Deines Atems in Deiner Nase“, leitet er die Nutzerinnen und Nutzer des Videos an.
Bei den Angeboten in der Fastenzeit soll es aber nicht nur um Körperwahrnehmung und Meditation gehen. Die Initiatoren laden darüberhinaus dazu ein, über den Weg der Achtsamkeit auch einen neuen Zugang zum Glauben zu bekommen und aufmerksamer für die Mitmenschen zu sein. Dazu beteiligen sich an den Angeboten auch Stefan Kaiser vom Katholischen Forum, Dekanatsjugendseelsorger Martin Blume und Gemeindereferent Hubertus Wand.
Zu finden sind die Beiträge auf den Facebook- und Instagram-Auftritten der „jungen kirche dortmund“ sowie unter fish-it.
Zu der Aktion gehört auch der Gottesdienst der „jungen kirche“ am 12. März um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, Kreuzstraße 61 unter dem Motto „Thank God It’s Friday“. Am 5. April ist ab 17 Uhr ein „Emmausgang“ um den Phoenixsee geplant, der den Abschluss der Fastenaktion bilden soll. Anmeldungen sind über die Internetseite www.fish-it.de möglich.
Bildzeile: Gemeindereferent Michael Thiedig gibt in der St. Josef-Kirche Anleitungen zur Meditation, die als Videoimpulse bei der Fastenaktion der „jungen kirche dortmund“ eingesetzt werden.
Foto: Michael Bodin / Erzbistum Paderborn

Platz drei für Materna im bundesweiten Arbeitgeber-Ranking der Rubrik „IT und Telekommunikation“
Materna zählt zu den Top-Arbeitgebern in der Region Dortmund
Eine jetzt veröffentlichte Umfrage der Zeitschrift Stern und des Marktforschungsunternehmens Statista hat ergeben: der IT-Dienstleister Materna zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern in der Region Dortmund. Deutschlandweit schaffte es Materna in der Rubrik „IT und Telekommunikation“ auf Platz drei und lässt dabei so manchen internationalen IT-Konzern hinter sich. Bei der Bewertung aller 650 teilnehmenden Unternehmen über alle Branchen erreicht Materna einen sehr guten Platz 67.
Im Rahmen der Analyse wurden fast 50.000 Arbeitnehmer zu dem eigenen Arbeitgeber sowie zu anderen Unternehmen befragt, sodass insgesamt 1,73 Millionen Meinungen in die Bewertung eingeflossen sind. Je Arbeitgeber mussten mindestens 100 Urteile abgegeben werden, um in die Wertung zu gelangen.
Materna hat sich in den vergangenen Jahren zu einem sehr attraktiven Arbeitgeber entwickelt. Im IT-Sektor zählt das Unternehmen zu den größten Ausbildungsbetrieben in der gesamten Region Dortmund.
„Für uns ist das Ergebnis des Arbeitgeber-Rankings ein riesiger Erfolg und ein Beleg dafür, dass wir mit unserer Arbeitgeberpositionierung richtig liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden bei uns ein Arbeitsumfeld, in dem sie sehr viele Gestaltungsspielräume haben und sich mit ihren Ideen und ihrer Expertise in interessante Kundenprojekte einbringen können. Zudem ist es unseren Mitarbeitern wichtig, dass sie sich weiterentwickeln können, sich mit Kollegen fachlich austauschen und voneinander lernen können. Wir haben dafür die Arbeitgeberwerte „Autonomiekönner“ und „Substanz zählt“ geprägt“, erläutert Martin Wibbe, CEO der Materna-Gruppe, wichtige Aspekte der Unternehmenskultur.
Ein weiterer wichtiger Teil der Arbeitskultur sind umfangreiche Onboarding-Programme für neue Mitarbeiter. Dazu zählen ein digitales Onboarding-Paket mit allen wichtigen Informationen zum Start, ein begleitendes Patensystem sowie digitale Welcome-Veranstaltungen.
Wer bei Materna Karriere machen möchte, wird durch ein individuelles Laufbahnmodell gefördert, dass die eigenen Leistungen und Fähigkeiten berücksichtigt. Darüber hinaus können Mitarbeiter aus einem Angebot von zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten wählen und so ihre eigene Entwicklung mitgestalten. Zur Bereitstellung digitaler Inhalte wie E-Learnings kommt zum einen ein eigenes Lernsystem zum Einsatz und zum anderen werden international etablierte digitale Fachplattformen genutzt.
Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
Mobiles Arbeiten ist bei Materna zum festen Bestandteil der Arbeitskultur geworden. Die Infrastruktur ist auf mobiles Arbeiten ausgerichtet und aktuell arbeiten knapp 90 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Laut der letzten Mitarbeiterumfrage, die zweimal jährlich durchgeführt wird, wünscht sich die Mehrheit der Mitarbeiter, dass sie auch nach der Corona-Pandemie weiterhin im Homeoffice arbeiten können. Mobiles Arbeiten und die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden zudem unterstützt durch ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell.
Sportangebote und JobRad
Für viele Menschen ist heute ein Fahrrad beinahe wichtiger als ein Auto. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, über Materna ihr persönliches Wunsch-Fahrrad bequem und günstig zu beziehen. Das JobRad wird von Materna geleast und kann von Mitarbeitern für den Weg zur Arbeit oder zum Sport genutzt werden. Neben dem JobRad bietet Materna viele weitere Sportangebote bzw. die finanzielle Unterstützung für Sportaktivitäten, darunter zum Beispiel auch Bouldern.
Bildzeile: Martin Wibbe, Vorstandsvorsitzender und CEO der Materna-Gruppe.
Foto: Materna

Bolmke-Allianz dankt Politik
„Der langjährige Kampf um den Erhalt der Frischluftschneise an der Bolmke hat nun endlich zum lang ersehnten Erfolg geführt“, freut sich die Allianz für die Bolmke. Sie hat sich 2018 aus den Naturschutzverbänden (BUND, NABU, AGARD), Naturfreunde Dortmund Kreuzviertel sowie den Kleingartenvereinen „Goldener Erntekranz“ und „Heideblick“ zusammengeschlossen und erfolgreich gegen eine Bebauung zwischen Stockumer Straße und Naturschutzgebiet Bolmke gekämpft. Mit dem jetzt gefassten Beschluss zur Änderung des Landschaftsplanes sei erfreulicherweise auch die seit Langem bestehende Forderung zur ökologischen Bewirtschaftung beschlossen worden. Im Weiteren wird es nun um die Gestaltung gehen. Denn die Fläche soll als Bestandteil des Freiraumverbundes Bolmke mit in das Naherholungs- und Wegekonzept eingebunden werden.
Foto: Naturfreunde Dortmund-Kreuzviertel

Wertschätzung der Arbeit durch Dortmunds Polizeipräsidenten
Im Februar überreichte der Leiter Polizeiwache Lütgendortmund, Polizeihauptkommissar Michael Dukat Mitgliedern der Nachbarschaftshilfe „Marten aktiv“ e.V. ein Schreiben vom Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange. In diesem Schreiben würdigt der Polizeipräsident die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder der Nachbarschaftshilfe „Marten aktiv“. „Dieses ist für uns eine besondere Wertschätzung“ so Margarete Konieczny, Nachbarschaftshelferin des Vereins.
Foto: Polizei Dortmund

Anika Duglosch – Neue Leiterin der Malteser Kinder- und Jugendtrauergruppe
Festliche Verabschiedung von Vorgängerin Maria Längert
Dortmund. Kinder und Jugendliche trauern anders als Erwachsene. Oft tut es ihnen gut, ihre Trauer mit Gleichaltrigen zu erleben und dafür einen geschützten Raum zu haben. Diesen geschützten Raum bieten die Kinder- und Jugendtrauergruppen des ambulanten Malteser Hospizdienstes in Dortmund. Bereits seit 2001 erfahren Kinder und Jugendliche, die einen nahen Angehörigen oder geliebten Menschen verloren haben, hier altersgerechte Unterstützung, um ihre Trauer auszuleben und in ihr neues Lebensgefüge zu integrieren. Die Trauerarbeit dem Alter anzupassen, ist der neuen Leiterin Anika Duglosch besonders wichtig: „Wir finden kreative und individuelle Wege des Abschiednehmens, um die jungen Menschen zu begleiten. Damit geben wir ihnen Orientierung und zeigen auf, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein sind.“ Seit 2017 ist Anika Duglosch anerkannte Trauerbegleiterin und war bis zu ihrem Start als Leiterin ehrenamtlich bei den Malteser Hospizdiensten engagiert.
Auch ihre Vorgängerin Maria Längert weiß um die besonderen Bedürfnisse von trauernden Kindern und Jugendlichen. In den fünf Jahren als Trauergruppenleiterin hat sie vor allem auch bildnerische und musische Ausdrucksmöglichkeiten gefördert, damit die jungen Trauernden ihre Gefühle zeigen und formulieren können. Die Malteser Hospizdienste danken Maria Längert für ihre wegweisende Arbeit und verabschiedeten sie mit einer Corona-bedingt nur kleinen Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand.
Die andauernde Corona-Pandemie stellt auch den ambulanten Hospizdienst vor neue Herausforderungen. Um die Trauerbegleitung weiterhin aufrecht erhalten zu können, wurde das Angebot um Brief-, Online- und Telefon-Begleitungen erweitert. Daneben sind persönliche Einzelbegleitungen unter Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen weiterhin möglich. Um die Kontaktaufnahme zu erleichtern, wird eine wöchentliche Sprechstunde angeboten. Diese und weiterführende Informationen gibt es unter www.malteser-hospizdienste-dortmund.de bzw. www.kinderhospizdienst-dortmund.de oder unter (0231) 8632902. Die Kinder- und Jugendtrauergruppen werden ausschließlich durch Spenden finanziert.
Spendenkonto IBAN: DE15 3706 0120 1201 2160 24 bei der PaxBank Köln
Bildzeile: Staffelübergabe – Neue Leiterin der Malteser Kinder- und Jugendtrauergruppe Anika Dlugosch (l.) und Vorgängerin Maria Längert (r.)
Foto: Laila Schubert

Dortmunder SPD-Landtagsabgeordneter Volkan Baran gedenkt dem „Schwarzen Mittwoch“
Im Februar versammelte sich eine kleine Delegation des Knappenvereins Borussia 1872 gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Volkan Baran und dem Bezirksbürgermeister Oliver Stens auf dem Nordfriedhof in Eving, um den 136 Bergleuten zu gedenken, die 1925 ihr Leben verloren haben. Eine Schlagwetterexplosion auf Schacht 3 der Zeche Minister Stein hatte für den Tod der Bergleute gesorgt. Der sogenannte „Schwarze Mittwoch“ ist als eine der schwersten Bergwerk-Katastrophen in die Geschichte des Ruhrgebiets eingegangen.
„Diese Katastrophe ist eng mit der Geschichte Evings verbunden. Der Bergbau war damals der wichtigste Arbeitgeber der Gegend und dadurch waren viele Männer dort beschäftigt. So hat beinahe jede Evinger Familie Väter, Brüder und/oder Söhne verloren. Das hat in ganz Dortmund Spuren hinterlassen. Die ganze Stadt hat getrauert, deshalb gedenken wir dem Unglück auch noch fast einhundert Jahre danach“ , erklärt der Abgeordnete Baran.
Am Ehrenmahl für die Bergleute auf dem Nordfriedhof legten die Anwesenden einen Kranz nieder. Das Denkmal war 1927 errichtet worden, um an die beim Schwarzen Mittwoch ums Leben gekommenen Evinger Bergmänner zu erinnern.
Foto: Ramazan Kabatas

IG BAU: Fachkräfte sollen Tariflohn verlangen | Zusatzrente gesichert
Lohnuntergrenze in Dortmund
für 670 Dachdecker gestiegen
Mehr Geld im Handwerk: Für die rund 670 Dachdecker aus Dortmund gilt eine neue
tarifliche Lohnuntergrenze. Gelernte Kräfte haben seit 1. Januar Anspruch auf einen
Mindestverdienst von 14,10 Euro pro Stunde – 3,7 Prozent mehr als bisher. Das teilt die
IG BAU Bochum-Dortmund mit – und ruft Beschäftigte in der Region zum Lohn-Check
auf. „Auf der aktuellen Lohnabrechnung muss das Plus auftauchen. Wer leer ausgeht,
sollte sich an die Gewerkschaft wenden“, so Bezirksvorsitzende Gabriele Henter.
Die IG BAU appelliert zugleich an Fachkräfte, auf dem deutlich höheren Tariflohn zu
bestehen. Dieser liegt bei 19,12 Euro pro Stunde. „Trotz Pandemie laufen die Arbeiten im
Dachdeckerhandwerk auf Hochtouren. Hier sollte sich niemand unter Wert verkaufen“,
sagt Henter. Anspruch auf die tarifliche Bezahlung haben Gewerkschaftsmitglieder, deren
Firma Mitglied in der Dachdeckerinnung ist.
Außerdem bleibt die tarifliche Altersvorsorge in der Branche bestehen. „Die Unternehmen
wollten bei der Zusatzrente sparen. Die Folgen für Dachdecker, die wegen der harten
körperlichen Arbeit nur selten bis zum gesetzlichen Rentenalter durchhalten und nur auf
geringe Altersbezüge kommen, wären fatal gewesen. Jetzt müssen Arbeitgeber sogar
einen höheren Rentenbeitrag zahlen“, erklärt IG BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten
Burckhardt. Für Beschäftigte sei damit die tarifliche Extra-Rente von 94 Euro pro Monat
gesichert.
Auch die Vergütungen für Azubis sind zum Januar gestiegen. Sie kommen jetzt auf
780 Euro im ersten, 940 Euro im zweiten und 1.200 Euro im dritten Ausbildungsjahr.
Bildzeile: Dachdecker haben Anspruch auf einen höheren Mindestlohn. Die IG BAU ruft Beschäftigte
zum Lohn-Check auf.
Foto: IG BAU

Neue Geschäftsführung bei der SPD-Ratsfraktion Dortmund
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund hat einen neuen Fraktionsgeschäftsführer gewählt. Die Nachfolge von Andrew Kunter wird
Jan-Joschka Pogadl
ab Anfang März 2021 antreten. Der Fraktionsvorsitzende Hendrik Berndsen freut sich mit der Gesamtfraktion und den Mitarbeitern*innen auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Die SPD-Ratsfraktion mit vielen jungen neuen Ratsmitgliedern stellt mit Herrn Pogadl die Weichen auch in der Geschäftsstelle für einen Generationswechsel. Herr Pogadl ist 30 Jahre alt und in der Dortmunder SPD gut vernetzt. Derzeit ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landtagsabgeordneten Anja Butschkau beschäftigt.
Bildzeile: Jan Joschka-Pogadl wird neuer Fraktionsgeschäftsführer der Dortmunder SPD.
Foto: SPD-Ratsfraktion Dortmund

„Eine neue Normalität“
Reinigungskräfte auf der Covid-Intensivstation
des Klinikums: Putzen während einer Pandemie
Seit Beginn der Pandemie erhalten Krankenhäuser berechtigterweise viel
Aufmerksamkeit. Neben medizinischem und pflegerischem Personal kämpfen
auch andere Berufsgruppen dafür, dass sich das Virus nicht weiter
ausbreitet – nicht zuletzt die Reinigungskräfte. Doch wie reinigt man eigentlich
ein Zimmer, in dem noch kurz zuvor ein infizierter Patient gelegen hat?
Wie hoch ist die Angst, dass man sich selbst ansteckt? Und wie hat Corona
den Alltag verändert? Andelka Dumancic und Katarzyna Szczesny, Reinigungskräfte
im Klinikum Dortmund, berichten von ihren Erfahrungen.
Wie ist das für Sie, wenn Sie ein infektiöses Zimmer betreten?
Dumancic: Am Anfang, also im Frühjahr 2020, ist die Verunsicherung beim Personal
groß gewesen. Das war aber mehr die Angst vor dem Namen Corona, der
durch die Medien ging. Inzwischen sind alle im Team sehr entspannt. Und für den
Fall, dass es sehr viele stationäre Covid-Patienten gibt, existiert für unseren Bereich
auch ein übergreifender Plan für beide Klinik-Standorte. Wir waren und sind
also gut vorbereitet.
Szczesny: Man muss es so sehen: Während andere wegen Covid-19 erschwerte
Bedingungen bei der Arbeit haben, befinden wir uns im Klinikum in der glücklichen
Position, dass sogar noch neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt wurden.
Es gab sogar schon sehr früh für die von Covid betroffenen Stationen eine
Reinigungskraft mehr pro Schicht. Das war auch gut so, denn die Säuberung
stellt ja vor allem einen zeitlichen Mehraufwand dar.
Wie reinigt man ein solches Zimmer?
Dumancic: Tja, einfach erklärt: Da fangen Sie oben an und hören unten auf. Man
zieht Schutzkittel, FFP2-Maske und Handschuhe an und säubert und desinfiziert
dann tatsächlich auch Decke und Wände. Jeden kleinsten Bereich wollen wir natürlich
erwischen. Das ist aber kein Neuland – es gibt ja auch andere hoch infektiöse
Krankheiten, bei denen wir die Patientenzimmer nach Entlassung putzen
müssen. Wir sind also, wenn man so will, schon jahrelang Profis in diesem Bereich.
Hat sich Ihr Arbeitsalltag seit Beginn der Pandemie dann überhaupt stark
verändert?
Szczesny: Man ist jetzt noch aufmerksamer als vorher, fragt sich, ob man noch
mehr desinfizieren könnte – natürlich Quatsch, aber man will seinen Job eben
doppelt so gut machen.
Dumancic: Klar hat sich einiges verändert, der Ablauf war ja auf einmal ein ganz
anderer. Aber natürlich nimmt man die neue Herausforderung an. Und ganz ehrlich:
Irgendwann normalisiert sich das alles. Und dann gibt es eben eine neue Normalität.
Foto: Klinikum Dortmund

DOGEWO21: Ein Stück Kunst im „Kulturfenster“ Löttringhausen
In dieses Zeiten ist eben alles anders. Auch die Ausstellung von sechs Künstler*innen des Fototreffs der Nachbarschaftsagentur Löttringhausen. Natürlich findet diese nicht wie sonst als öffentliche Ausstellungen in den eigenen Räumlichkeiten statt, sondern in einer kleineren persönlichen Form – im Kulturfenster.
Die Künstler stellen ihre Werke im Schaufenster der Nachbarschaftsagentur aus. Zu sehen ist jeweils ein Bild inklusive eines Steckbriefs mit Informationen zu den Künstlern. Gewechselt wird jede Woche.
„Das Kulturfenster soll den Nachbarn in der Umgebung als kleines Ausflugsziel dienen, wenn sie einkaufen oder spazieren gehen und den Künstlern auch in dieser Zeit die Möglichkeit einer kleinen Ausstellung geben.“ sagen die Organisatorinnen Heike Rolfsmeier (Diakonie) und Katja Jüngst (DOGEWO21).
Die Ausstellung beginnt am 15. Februar mit der großformatigen Fotografie „Shopping Queen“ von Pit Clausmeyer.
Die Nachbarschaftsagenturen sind ein Kooperationsprojekt von DOGEWO21 und dem Diakonischen Werk Dortmund und Lünen gGmbH. Neben der Nachbarschaftsagentur Löttringhausen gibt es drei weitere Standorte in Wambel, Wickede und Mengede, jeweils in den dortigen DOGEWO21-Quartieren. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Agenturen derzeit geschlossen.
Bildzeile: Pit Clausmeyer (Künstler) und Heike Rolfsmeier (Diakonie) mit der großformatigen Fotografie „Shopping Queen“.
Foto: Dogewo21



