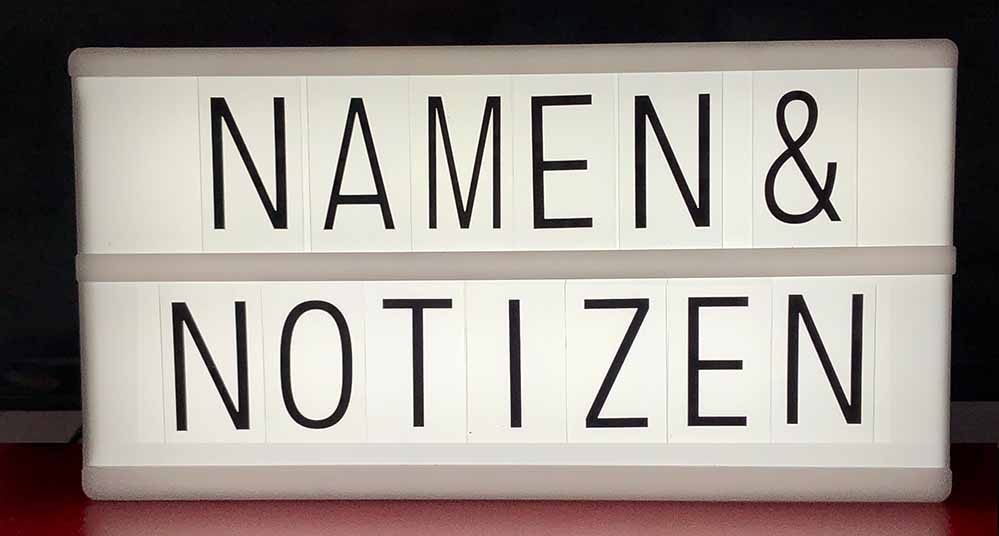Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“
Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Frühes Jubiläum
„Noah“ erblickt das Licht der Welt: Klinikum
Dortmund feiert die 1000. Geburt im Jahr 2021
57 Zentimeter groß und 3990 Gramm schwer: Das ist das Ergebnis der
1000. Geburt in diesem Jahr, die das Team um die leitende Hebamme Margot
Lefarth am Mittwoch, 26. Mai 2021, betreuen durfte. Der kleine Neuankömmling
trägt den Namen Noah Alexander und ist genau wie seine Mutter
wohlauf. Bereits am Wochenende durften die beiden gemeinsam nach Hause
gehen. Das Jahr 2021 ist bislang äußerst geburtenstark im Klinikum
Dortmund: Schon jetzt wurden rund 130 Kinder mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
geboren.
Um 22.34 Uhr am späten Mittwochabend, 26. Mai 2021, ist Noah Alexander auf
natürlichem Wege zur Welt gekommen: Mit einem Kopfumfang von 35,5 Zentimetern
hat er das Licht der Welt erblickt – rundum gesund, wie Lefarth der frischgebackenen
Mutter versichert. Der Familienzuwachs ist das erste Kind für Lavinia
Diehl, die vor gut 21 Jahren selbst im Klinikum Dortmund (damals noch „Städtische
Kliniken“) geboren wurde. „Ich freue mich auf den neuen Alltag mit Noah
und natürlich auch darauf, ihn meiner Familie vorzustellen“, so die Dortmunderin.
„Ich bin überglücklich, dass es dem Kleinen gut geht und gespannt auf das Familienleben.“
Mit Noah hat die 1000. Geburt im Jahr 2021 rund einen Monat früher stattgefunden
als im Vorjahr, denn 2020 war es erst am 17. Juni so weit. „Zu Beginn der
Pandemie hatten wir die Sorge, dass die Menschen stark verunsichert sind und
die Geburten zurückgehen“, sagt Lefarth. „Aber seit Januar 2021 erleben wir ein
monatliches Plus von etwa 20 bis 30 Geburten im Vergleich zum Vorjahr. Die
Dortmunder zeigen sich von der Situation demnach wohl eher unbeeindruckt.“
Dennoch seien solche Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren, gibt Lefarth zu bedenken:
„Man kann zum aktuellen Zeitpunkt natürlich keine eindeutigen Aussagen
darüber tätigen, ob irgendwelche Zusammenhänge zwischen Corona und
der Geburtenzahl bestehen.“
Foto: Klinikum Dortmund

Impfsaal21 hat die Arbeit aufgenommen
Im Werkssaal von DSW21 werden unter betriebsärztlicher Leitung der Prävent GmbH Beschäftigte aus bis zu 400 Unternehmen geimpft
Strahlend blauer Himmel. Strahlende Gesichter. Pünktlich um 8 Uhr öffnete der Impfsaal21, das betriebsärztliche Impfzentrum im Werkssaal von DSW21, am Donnerstag (10. Juni) seine Pforten. Mit der Prävent GmbH als medizinischem Partner könnten in den sechs Impfstraßen pro Woche mehr als 4.000 Beschäftigte geimpft werden. Könnten – denn so viel Impfstoff steht aktuell (noch) nicht zur Verfügung. Aber immerhin: Mehr als 600 Mitarbeiter*innen erhalten gleich an den ersten beiden Tagen ihre Erstimpfung mit dem Biontech-Impfstoff; rund ein Drittel sind Beschäftigte der Stadtwerke und ihrer Töchter und Beteiligungen in der kommunalen Unternehmensfamilie.
„Wir sind froh und glücklich, dass wir unseren Mitarbeitenden jetzt selbst ein Impfangebot machen können“, sagt Guntram Pehlke. Der Vorstandsvorsitzende von DSW21 hatte die Bereitschaft und den festen Willen zum Aufbau einer eigenen Infrastruktur schon sehr frühzeitig signalisiert. „Wir fühlen uns als kommunales Unternehmen sowohl unseren Beschäftigten als auch den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Dortmund gegenüber in der Verantwortung. Wenn wir also mit unserem Impfsaal21 dazu beitragen können, das städtische Impfzentrum und die niedergelassenen Ärzte zu entlasten und mehr Tempo in die Impfkampagne zu bekommen, machen wir das sehr gerne“, so Pehlke weiter. DSW21-Arbeitsdirektor Harald Kraus ergänzte: „Was hier innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt wurde, ist überragend. Den beteiligten Kolleginnen und Kollegen gebührt Dank und Respekt für diese Leistung.“
Allein aus der kommunalen Unternehmensfamilie hat rund ein Dutzend Unternehmen an den Impfsaal21 angedockt. Neben DSW21 u.a. auch DEW21/DONETZ, DOGEWO21, DOKOM21, Dortmund Hafen und Dortmund Airport, die EDG, die Dortmunder Eisenbahn, Wasserwerke Westfalen und Gelsenwasser.
Eine interne Arbeitsgruppe um Dr. Maximilian Vuga, Leiter Arbeitsschutz bei DSW21, hat den Impfsaal21 aufgebaut und mit der Prävent GmbH den passenden Partner gefunden. Eine Win-Win-Situation, denn Prävent kann die bis ins kleinste Detail hochprofessionelle Infrastruktur nutzen, um auch andere Kunden zu bedienen. Bis zu 400 Unternehmen sind es, mit denen der Medizin-Dienstleister zusammenarbeitet – darunter Kleinstbetriebe mit zwei oder drei Beschäftigten ebenso wie die Sparkasse Dortmund und ThyssenKrupp. „Wir fiebern diesem Moment seit Tagen entgegen und sind wirklich sehr froh, dass es jetzt endlich losgehen kann“, sagen Dr. Andreas Brune und Henrik Fibbe, Ärztlicher bzw. Kaufmännischer Leiter von Prävent.
Der erste Eindruck aus dem Impfsaal21: Abläufe und Logistik funktionierten auf Anhieb gut. Keine langen Wartezeiten, keine Schlangen, kein Papierkrieg – vom Anmelden bis zum Auschecken läuft der gesamte Prozess digital ab. Fehlt nur noch: mehr Impfstoff, damit die Kapazität ausgeschöpft werden kann.
Bildzeile: Sven Baumgarte, Leiter Strategie & Transformation bei DEW21, war einer der ersten, die am Donnerstag im Impfsaal21 ihre Impfung erhielten.

Ein Schalker in Dortmund
Wegen einer Krisensitzung „auf Schalke“ kam Gerald Asamoah Anfang Juni mit einer Stunde Verspätung ins Honorarkonsulat der Republik Ghana in Dortmund, um sein Visum für eine Reise in die Heimat abzuholen. Honorarkonsul Klaus Wegener empfing das Schalker Urgestein im Konsulat im Haus der Auslandsgesellschaft. Die herzliche Begegnung kam natürlich nicht ohne einen Seitenhieb auf die derzeitige Situation beim FC Schalke 04 aus. Auf Wegener`s Frage, ob er jetzt einfach nur noch weg wolle, konterte Asamoah: „Wir können Dortmund ja nicht im Stich lassen. Echte Derbys ohne Schalke sind undenkbar. Der direkte Wiederaufstieg wird kommen.“ Wir wünschen eine gute Reise !
Bildzeile: Gerald Asamoah und Klaus Wegener, Präsident der Auslandsgesellschaft.
Foto: Auslandsgesellschaft.de e.V.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ortsverband Innenstadt-West, Kreisverband Dortmund trauet um Hans-Ulrich Fibitz
Wir betrauern den plötzlichen Tod unseres langjährigen Mitglieds, ehemaligen BV-Fraktionssprechers und Parteifreundes Hans-Ulrich „Ulli“ Fibitz, der am 27.05.2021 im Alter von 61 Jahren verstorben ist.
Ulli hat sich über Jahrzehnte mit großem Engagement und Herzblut für die Gestaltung und die positive Entwicklung des Stadtbezirkes Innenstadt-West eingesetzt – in der Arbeit der Bezirksvertretung wie auch im Wahlkampf. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Seit 1981 war Ulli Mitglied der GRÜNEN, 1986 wurde er Vorstandsmitglied im Kreisverband, war langjähriges Mitglied der Bezirksvertretung Innenstadt-West und Sprecher der GRÜNEN Fraktion. Für seine Arbeit erhielt Ulli 2016 den Ehrenring des Stadtbezirks Innenstadt-West.
Seine Begeisterung für die Natur und ihren Schutz hat er nicht nur zu seinem Beruf gemacht, sondern hat auch dazu beigetragen, dass das Projekt “Westgarten” in der Innenstadt-West realisiert werden konnte.
Im Kreise Gleichgesinnter hat Ulli in der Partei eine zweite Heimat gefunden und mit seiner langjährigen Erfahrung die ehrenamtliche Arbeit vieler bereichert.
Wir blicken auf eine schöne und erfolgreiche gemeinsame Zeit zurück. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden.
Wir werden dich vermissen!
Foto: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Sommer der Berufsausbildung“ ist gestartet Großangelegte Aktion der Allianz für Aus- und Weiterbildung
Duale Ausbildung hat Zukunft. Doch wegen der Corona-Pandemie kommen Unternehmen und Jugendliche deutlich schwerer zusammen. Im „Sommer der Berufsausbildung“, der heute bundesweit startet, wollen die Partner der „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ von Juni bis Oktober mit vielfältigen Aktionen das Matching intensivieren. Mit einer breiten Auswahl an Veranstaltungen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene sollen die vielfältigen Unterstützungsangebote bekannter gemacht werden. Die Handwerkskammer (HWK) Dortmund beteiligt sich mit zahlreichen Aktivitäten an dieser Initiative.
Kammer-Präsident Berthold Schröder: „Die Ausbildung im Handwerk ist von der Corona-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Dabei hat das Handwerk in den letzten Monaten bewiesen, dass es auch in Krisenzeiten sichere Beschäftigungsperspektiven bietet und als wohnortnaher Dienstleister unverzichtbar ist. Mit dem ‚Sommer der Berufsausbildung‘ möchten wir als Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung verstärkt Jugendliche für das Handwerk begeistern und ihnen die zahlreichen Entwicklungs- und Karrierechancen aufzeigen, die unser Wirtschaftsbereich für sie bereithält.“
Zu den Themen, die in den kommenden Wochen und Monaten speziell aufgegriffen werden, gehören zum Beispiel Perspektiven und Chancen durch Ausbildung bzw. höhere Berufsbildung, MINT- und Zukunftsberufe, die duale Ausbildung für Menschen mit Migrations- und Flüchtlings-hintergrund sowie Förderangebote für Jugendliche.
ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer: „Ein Pluspunkt der dualen Ausbildung ist die persönliche Betreuung während der Ausbildung, die gerade nach den Kontakteinschränkungen der Pandemie für Jugendliche eine attraktive Perspektive und Unterstützung darstellt. Gemeinsam wollen wir mit dem ‚Sommer der Berufsausbildung‘ jungen Menschen Lust auf Ausbildung machen, ihnen Sicherheit geben und Zukunftsängste nehmen und ihnen helfen, eine für sie passende Ausbildung zu finden.“
Für ausführliche Beratung und Hilfestellung bei der Bewerbung stehen die Lehrstellenvermittler der HWK Dortmund bereit: https://www.hwk-do.de/artikel/wege-in-die-ausbildung-37,34,20.html
Informationen zum „Sommer der Berufsausbildung“ und zur Allianz für Aus- und Weiterbildung gibt es unter: https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/DE/Home/home.html
Foto: HWK Dortmund

Die Bedeutung der Wohnungswirtschaft ist in der Pandemie unterschätzt worden
Wie bewältigt ein Wohnungsunternehmen in Corona-Zeiten die für 40.000 Mieter*innen wichtigen Aufgaben? Machen sich die bewilligten Hilfen für Menschen in prekären Situationen bemerkbar? Hat das Kurzarbeitergeld zur Stabilisierung von Lebenssituationen beigetragen?
Um mehr über die derzeitige Situation der Wohnungswirtschaft in Dortmund zu erfahren, hat sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann mit Klaus Graniki, dem Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsunternehmens DOGEWO21, zum Austausch getroffen. Die Politikerin, neben Wirtschaftsthemen befasst sie sich auch mit Stadtentwicklung und Wohnen, sitzt außerdem im fraktionsübergreifenden „Unterausschusses Pandemie“ des deutschen Bundestages. Und dessen Aufgabe ist es unter anderem, die Folgen der Corona-Pandemie aufzuarbeiten.
„Die Bedeutung der Wohnungswirtschaft ist in der Pandemie nicht ausreichend berücksichtigt worden. Wir gelten nicht als kritische Infrastruktur, obwohl gerade in die sen Zeiten wichtige und grundlegende Aufgaben von uns erfüllt werden“, erklärt Klaus Graniki. Ein sicheres und funktionierendes Zuhause hat speziell in der Corona-Zeit für viele Mieter*innen eine enorme Bedeutung. „Und alles muss ja weiterhin funktionieren – unsere Mitarbeiter*innen sorgen dafür, dass Reparaturen ausgeführt, im Winter Dachlawinen oder Eisflächen beseitigt werden, oder dass die Mieter*innen notwendige Bescheinigungen für die Ämter erhalten“, so Graniki. Auch das Tagesgeschäft – Wohnungsabnahmen, notwendig gewordene Modernisierungen, speziell nach längerer Mietdauer, und auch die Wiedervermietung, sind unter entsprechenden Schutzmaßnahmen, fortgeführt worden.
Sabine Poschmann hakt nach, wie es um Mietausfälle bestellt sei. Haben die Hilfen für Unternehmen und die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gegriffen? „Durchaus. Wir stellen fest, dass seit Beginn der Pandemie nur rund 0,15 % unserer Mieter*innen coronabedingt von Zahlungsschwierigkeiten betroffen sind. Und mit denen haben wir Vereinbarungen getroffen“, erläutert Klaus Graniki. „Uns liegt der Erhalt der Quartiere am Herzen, deshalb haben wir mit unseren Pächter*innen intensive Gespräche geführt, Zahlungen gestundet, bis die Hilfen ausbezahlt wurden.“
Auch Baumaßnahmen müssen fortgeführt werden. Das ist in Corona-Zeiten nicht immer einfach: Hier müssen Mieter*innen genauso geschützt werden wie die Mitarbeiter*innen des eigenen Unternehmens und der Handwerksbetriebe. Das führt dann durchaus einmal zu zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung von Projekten. Hinzu kommt die Schwierigkeit, aktuell am Markt Baumaterial zu erhalten. „Davon hängt wiederum ab, dass die Aufträge mit dem lokalen Handwerk umgesetzt werden können“, weiß Sabine Poschmann, in der SPD-Bundestagsfraktion auch zuständig für Mittelstand und Handwerk. „Für den Unterausschuss Pandemie werde ich einige Anregungen aus dem Gespräch nach Berlin mitnehmen. Das ist wichtig, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein“, so die Bundestagsabgeordnete.
Bildzeile: Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann hat sich mit DOGEWO21-Geschäftsführer Klaus Graniki zum Gespräch getroffen.
Foto: Dogewo21

Gärtnerische Aufwertung der Wiese zwischen Bibliothek und Katharinentreppe
Die Auszubildenden des Grünflächenamtes haben zur Verschönerung die Wiese zwischen der Bibliothek und der Katharinentreppe mit Pflanzstreifen versehen, die das Grün der Wiese mit bunten Farben und weiteren Grüntönen auflockern und attraktiver machen sollen. Die Beete sind landschaftsarchitektonisch der Rundung der Bibliothek nachempfunden.
Jeder einzelne Streifen beinhaltet ein ganz eigenes Konzept aus Stauden und Gräsern. Die einzelnen Pflanzungen sind aufgrund ihrer Auswahl der Stauden, sowie Gräsern in höhengestaffelt angeordnet.
Die Übersicht der verwendeten Gräser und Stauden aus Blickrichtung des Platzes der Deutschen Einheit:
· Vorderer Streifen: Prachtkerze (Gaura lindheimerii), Silberährengras (Achnatherum calamagrostis)
· Mittlerer Streifen: Herbst-Anemone (Anemone japonica ‚Honorine Jobert‘), Diamantgras (Calamagrostis brachytricha)
· Hinterer Streifen: Duftnessel (Agastache rugosa ‚Black Adder‘), Feinhalm Chinaschilf (Miscanthus sinensis ‚Gracillimus‘)
Zur Gestalterischen Wiederholung beinhalten alle Pflanzungen zudem das Eisenkraut (Verbena bonariensis).
Diese Pflanzaktion gehört zu den sogenannten Ad-hoc-Maßnahmen aus dem Sofortprogramm zur Attraktivitätssteigerung der City. Die prominente Stelle zwischen Bibliothek und Platz der Deutschen Einheit gilt als ein „Willkommenstor“ für Gäste, die vom Hauptbahnhof zur City geleitet. In der Katharinenstraße hat das Grünflächenamt bereits im vergangenen Jahr neue Pflanzbeete an den Baumscheiben angelegt.
Bildzeile: Auszubildende auf der Wiese gemeinsam mit der Leitung des Grünflächenamtes (hintere Reihe links: Heiko Just, stellvertretender Leiter; daneben Ulrich Finger, Leiter).
Foto: Roland Gorecki / Dortmund-Agentur

Stadtverwaltung Dortmund gewinnt
Blutspende-Award 2020
Die Stadtverwaltung Dortmund hat beim Blutspende-Award 2020 der Klinikum Dortmund gGmbH gewonnen und durfte die Trophäe für den ersten Platz entgegen nehmen- Aufruf zur Blutspende auch für das Jahr 2021.
Eine Blutspende ist bei vielen Krankheitsbildern unverzichtbar, wie zum Beispiel bei der Behandlung von Tumorpatient*innen, Operationen oder Organtransplantationen, Organtransplantationen. Dieser Notwendigkeit haben viele Kolleg*innen der Stadtverwaltung Dortmund im vergangenen Jahr Rechnung getragen und ihr Blut im Klinikum Dortmund gespendet. Damit haben sie sich nicht nur für eine gute Sache engagiert, sondern auch den vom Klinikum Dortmund ausgelobten Blutspende-Award 2020 gewonnen. „Ich bin stolz auf alle Kolleginnen und Kollegen, die sich trotz der Corona-Pandemie dazu entschlossen haben, Blut zu spenden und damit das Gesundheitssystem maßgeblich unterstützen“, zeigt sich Personal- und Organisationsdezernent Christian Uhr erfreut.
Lisa Cathrin Müller, stellvertretende Leiterin der Unternehmenskommunikation des Klinikums, lobt den großen Einsatz: „Die Stadt Dortmund ist sogar auf Platz 1 gelandet! Ihr Engagement war 2020 wirklich beeindruckend, vor allem – das muss betont werden – trotz Corona. 119 Spenden konnte die BlutspendeDO seitens der Stadt verzeichnen, viele der Spender*innen darunter waren ‚Wiederholungstäter*innen‘. Offenbar sind aufgrund von Covid-19 einige der anderen Teilnehmer*innen der Blutspende ferngeblieben – oder mussten fernbleiben. Umso dankbarer sind wir, dass die Mitarbeiter*innen der Stadt sich regelmäßig beteiligen.“
Anke Deutschmann, Ansprechpartnerin beim Betrieblichen Arbeitschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) für die Blutspende-Aktion der KlinikumDO gGmbH, hat auch in diesem Jahr wieder einen Aufruf an die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung gestartet, sich an der guten Aktion zu beteiligen: „Blut spenden heißt Leben retten. Also machen Sie mit und tun Sie etwas Gutes!“
Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadtverwaltung Dortmund wieder an der Aktion der KlinikumDO gGmbH. Alle Mitarbeitenden, die über das Jahr verteilt zur Vollblutspende kommen, tragen dazu bei, dass das Unternehmen mit der höchsten Beteiligung den Award 2021 gewinnen kann. Die Aktion läuft vom 01.01. bis zum 31.12.2021.
Bildzeile: Anke Deutschmann, Ansprechpartnerin beim Betrieblichen Arbeitschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) für die Blutspende-Aktion des Klinikums überreicht Personaldezernent Christian Uhr den Award.
Foto: Roland Gorecki

Solidaritätsgedanke wichtiges Anliegen
Landtagsabgeordnete besuchte zum Tag der Nachbarn die Nachbarschaftshilfe Marten aktiv
„Es ist bemerkenswert, was dieser kleine Verein in einem Jahr auf die Beine gestellt hat, um in Marten einen wichtigen Beitrag für eine solidarische und lebendige Nachbarschaft zu leisten.“ Das war das Fazit von Anja Butschkau, Landtagsabgeordnete für den Dortmunder Südwesten. Sie besuchte am Freitag anlässlich des Tags der Nachbarn die Nachbarschaftshilfe „Marten aktiv“ e.V.
Im neuen Nachbarschaftstreff in der Meile informierte sie sich beim Vereinsvorsitzenden Axel Wolff und den Vorstandsmitgliedern Angelika Welzel und Martin Schmitz über die Arbeit und die Angebote des Vereins. „Der Nachbarschaftstreff ist zum Anlaufpunkt für viele Martenerinnen und Martener geworden, die hier Unterstützung im Alltag finden, aktuell zum Beispiel bei der Buchung eines Termins im Corona-Testzentrum“, sagt Axel Wolff.
Im Mittelpunkt stehe aber immer noch die Einkaufshilfe für Senior*innen und erkrankte Menschen, die nach wie vor gut angenommen wird. Aber auch Familien mit geringem Einkommen zählen zur Zielgruppe des Vereins. So stehen seit Kurzem für Kinder und Jugendliche Laptops zum Lernen zur Verfügung. Diese könnten im Nachbarschaftstreff genutzt werden. Geplant sei auch ein Hausaufgaben- und Nachhilfeprojekt für Kinder und Jugendliche, die sich so etwas nicht leisten können.
„All diese Hilfe ist nur möglich, weil sich viele Menschen in der Nachbarschaftshilfe Marten aktiv engagieren,“ so Wolff. „Und weil es viele Menschen, Unternehmen und Organisationen gibt, die finden, dass wir das gut machen und uns deshalb mit Spenden unterstützen.“
Von dem Engagement zeigte sich auch die Abgeordnete Anja Butschkau begeistert: „Hier wird aktive Nachbarschaftshilfe gelebt. Der Solidaritätsgedanke ist allen Beteiligten sichtlich ein wichtiges Anliegen.“ Dieses Projekt sei ein Gewinn für den Stadtteil Marten, das auch für andere Quartiere in Nordrhein-Westfalen ein positives Beispiel sein könnte.
Foto: Martin Schmitz

Vonovia in Dortmund: Historische Lore aus
Bergbau-Siedlung restauriert
In der ehemaligen Bergbau-Siedlung in
Dortmund-Brechten restaurierte das Wohnungsunternehmen
Vonovia Ende Mai eine alte Zechen-Lore für die Bewohner. Die
Siedlung gehört zum Wohnungsbestand von Vonovia. Zur Einweihung
des mit Blumen bepflanzten Erinnerungsstücks erschienen
die ehemaligen Bergmänner Gotthard Kindler und Udo Bernhard
in ihrer Bergmannsbekleidung mit Helm und Leuchten. Die beiden
Bewohner der Siedlung freuten sich sehr, dass die Lore als Erinnerung
an vergangene Zeiten restauriert und zukünftig von der
Brechtener Gemeinschaft gepflegt wird.
Erinnerungen aus der Vergangenheit
Die Lore war zu Zeiten des Bergbaus ein Förderwagen, mit der
unter anderem Kohle und Werkzeuge transportiert wurden. Die
Zeche nahe der Brechtener Siedlung hatte eine über hundertjährige
Tradition – sie wurde 1871 gegründet und 1987 geschlossen.
Nach der Schließung wurden viele Loren verschrottet. Denkmalschützer
konnten jedoch einige Exemplare retten, um sie als Erinnerung
in den Bergbausiedlungen oder in Gartenanlagen aufzustellen
und mit Blumen zu schmücken. Auch in der Brechtener
Siedlung stand eine alte Lore. Das Ehepaar Kindler bat bei Vonovia
um eine Restaurierung der Lore, damit die vergangenen Zeiten
des Bergbaus in Erinnerung gehalten werden.
Vonovia Regionalleiterin Vanessa Weber: „Gerne leisten wir unseren
Beitrag, die Bergbau-Tradition und die damit verbundenen Erinnerungen
vieler Bewohner in der Siedlung präsent zu halten.“
Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das Wohnungsunternehmen
steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von Vonovia
niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive.
Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen auf dem
Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr
altersgerechte Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation
mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle
Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia
an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer
Wohnungen.
Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern
sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe
sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig
in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für
mehr Lebensqualität. Für Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen
ist der zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per EMail,
Fax, App oder postalisch erreichbar.
Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch.
Bildzeile: Die zwei ehemaligen Bergleute Gotthard Kindler (links) und Udo Bernhard (rechts) mit der restaurierten Lore.
Foto: Vonovia / Bierwald

SPD Bundes- und Landtagsabgeordnete tauschen sich mit Arbeitnehmervertretern bei der Dortmunder Tedi Tochter DLG aus.
Der für Freitag (04.06) angekündigte Besuch durch einen Vertreter der Gewerkschaft ver.di sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete der SPD, bei der Logistik-Tochter der Tedi (DLG mbH), in Dortmund am Brackeler Hellweg hat aller Widerstände zum Trotz stattgefunden. Hintergrund des Gespräches ist die derzeitige Unklarheit über die Zukunft der rund 280 Lagermitarbeiter.
Im Vorfeld hatte die Geschäftsführung der Tedi und der DLG den Politikern das Betreten der Betriebsgebäude nicht erlaubt, mit Verweis auf die pandemische Lage. Das hielt die Beteiligten jedoch nicht auf, und so wurde sich unter Einhaltung von Abstand und Maskenpflicht vor der Einfahrt des Parkhauses ausgetauscht.
Betriebsrat berichtet von enormer Existenzangst der Beschäftigten
„Gestern habe ich eine Kollegin trösten müssen, die hat solche Angst um Ihren Arbeitsplatz, dass sie die ganze Zeit nur geweint hat.“, berichtet einer der Betriebsräte. Die Geschäftsführung der Tedi Tochter DLG bleibt bei Aussagen zu der Zukunft der Beschäftigten gegenüber dem Betriebsrat ungenau. Das schürt weiter Ängste. Betriebsratsvorsitzender Serkan Cam dazu: „Uns geht es um die Sicherung der Beschäftigung hier am Standort“ erklärt er, und weiter: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir jetzt auch Unterstützung aus der Politik erhalten.“ Notwendig ist die Unterstützung allemal. Anstatt die eigenen Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, entscheidet sich die Tedi dazu, einen Teil der Logistikaufgaben an eine Drittfirma abzugeben. „Einfach nicht nachvollziehbar! Erst lässt man sich vom Staat die Lohnkosten bezahlen, nur um dann die Auftragslage durch die Beauftragung eines Dritten noch zu verschlechtern.“ So der Gewerkschaftssekretär Philip Keens.
SPD Abgeordnete wollen das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen
Die Vertreter der SPD werden nun den Kontakt zum Arbeitgeber suchen. Ziel soll es sein, die Geschäftsführung und den Betriebsrat zu Verhandlungen über einen Sozialplan wieder an einen Tisch zu holen. „Und danach treffen wir uns wieder genau hier, und sprechen darüber wie es weitergeht. Wir bleiben am Ball!“ so Anja Butschkau MdL (SPD)
Teilgenommen an dem Gespräch haben der Betriebsrat, Philip Keens (ver.di) sowie folgende Vertreter aus der Politik:
Sabine Poschmann SPD – Bundestagsabgeordnete
Anja Butschkau SPD – Landtagsabgeordnete
Nadja Lüders SPD – Landtagsabgeordnete
Volkan Baran SPD – Landtagsabgeordneter
Foto: ver.di

Dortmund: Klimaschutz-Protest an VW-Autohaus
Bundesweit bekleben Greenpeace-Aktive Verbrenner mit Warnhinweisen
Umweltschützer:innen von Greenpeace protestierten Anfang Juni für mehr
Klimaschutz und einen schnellen Verbrenner-Ausstieg bei Volkswagen. Auf dem Parkplatz des
VW-Autohauses in der Planetenfeld Straße bekleben sie ausgestellte Diesel und Benziner mit
Botschaften wie „Von Wegen: Klima-Vorreiter“, „Von Wegen: just electric“ und „Von Wegen:
sauber“. Die Aufkleber im DIN A3 Format sind umweltverträglich und rückstandsfrei ablösbar.
In einem offenen Brief fordern die Greenpeace-Aktiven VW-Chef Herbert Diess auf, die
Entwicklung einer nächsten Verbrenner-Generation zu stoppen. „VWs Verkaufszahlen bringen
die Scheinheiligkeit des Konzerns auf den Punkt“, sagt Joachim Hermes, Verkehrsexperte der
Greenpeace-Gruppe Dortmund: „Ein paar Elektroautos können nicht darüber
hinwegtäuschen, dass Volkswagen rücksichtslos weiter Verbrenner entwickelt und noch
Jahrzehnte verkaufen will.“ VW ist allein durch seine produzierten Autos für über ein Prozent
der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Aktuell will der Konzern Milliarden in die
Entwicklung einer neuen Plattform investieren, auf der noch millionenfach neue Diesel und
Benziner bis mindestens 2040 verkauft werden sollen. Die Proteste von Greenpeace-Aktiven
finden heute bundesweit in 35 Städten statt.
2020 waren über 95 Prozent der verkauften VW-Autos klimaschädliche Verbrenner
Volkswagen vertreibt seine Hausmarke maßgeblich über den stationären Handel. Hier
entscheidet sich der klimafreundliche Umstieg auf Elektroautos: Die Beratung der
Händler:innen beeinflusst entscheidend, welcher Antriebstechnologie Kund:innen vertrauen.
Testgespräche von Greenpeace-Aktiven vor einigen Monaten (https://act.gp/37nd24w)
zeigten, dass die Verkehrswende in den allermeisten VW-Autohäusern noch nicht
angekommen ist: Das Verkaufspersonal riet mehrheitlich zum Kauf eines Verbrenners, einige
warnten sogar ausdrücklich vor dem Kauf eines elektrischen ID.3. Unterschiedliche
Provisionssysteme sorgen zudem dafür, dass Verbrenner-Verkäufe für VW-Autohäuser
lukrativer sind als Verkäufe von Elektroautos. So treibt der Konzern mit seinem Verbrenner-
Altgeschäft die Klimakrise voran: Von weltweit rund neun Millionen verkauften Autos im Jahr
2020 verbrennen bislang noch immer über 95 Prozent Öl.
Zwei gewonnene Klimaschutz-Klagen geben den Umweltaktivist:innen Rückenwind: Nach
dem jüngsten Urteil des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts haben künftige Generationen
ein Grundrecht auf wirksamen Klimaschutz. Zudem wurde der Ölkonzern Shell vergangene
Woche von einem Gericht in Den Haag zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Die Argumentation
des Gerichts betrifft auch andere fossile Unternehmen wie Volkswagen: Die von VW in einem
einzigen Jahr produzierten Autos verursachen über ihre Lebensdauer 582 Millionen Tonnen
CO2. Das übersteigt die jährlichen Treibhausgas-Emissionen Australiens.
Foto: Greenpeace Dortmund

Eurowings fliegt nach Heraklion
Flexibilität auf beliebter Strecke wächst
Anfang Juni startete der Erstflug der Eurowings von Dortmund nach Heraklion. Eurowings fliegt die Strecke immer sonntags, dienstags und donnerstags. Die Flugzeiten sind somit eine perfekte Ergänzung zu der Verbindung der Wizz Air auf die griechische Insel. Diese fliegt ab dem 14. Juni wieder montags, mittwochs und freitags von Dortmund nach Heraklion.
„Damit können unsere Passagiere fast jeden Tag nach Kreta fliegen. Der Erstflug der Eurowings am heutigen Tag ist ein weiterer Beleg dafür, dass die griechischen Ziele ab Dortmund immer beliebter werden. Vor einem Jahr wurde nur Thessaloniki angeflogen. Mittlerweile können Reisende zwischen fünf Zielen wählen: Thessaloniki, Santorini, Athen, Kavala und Kreta“, so Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing.
Die Verbindungen nach Griechenland sollen auch in Zukunft weiterwachsen. Ab dem 2. Juli fliegt Eurowings zusätzlich nach Rhodos. Bereits im Juni starten wöchentlich ca. 17 Flieger von Dortmund in das beliebte Urlaubsland.
Bildzeile: Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing, begrüßte die Crew auf dem Vorfeld.
Foto: Hans Jürgen Landes / Dortmund Airport

DEW21 hat Windrad AIRWIN repariert
Mit einem Spezialkran wurde am Kopf der Anlage geschraubt
Er ist ein echter Wind-Trendsetter: Das Windrad AIRWIN der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) am Steinsweg in Dortmund-Oespel. „Wir sind stolz darauf, dass wir ihn schon im Jahr 1997 als erstes Windrad in Dortmund realisieren konnten,“ sagt Maik Löhr, Leiter des Bereichs Erneuerbare Energien bei DEW21. AIRWIN hat deshalb für DEW21 und die Stadt eine besondere Symbolkraft. Jetzt ist er gerade repariert worden – eine ganz schön Aufsehen erregende Angelegenheit. Bereits einen Tag vorher ist dazu ein 350 Tonnen-Kran angereist, um ordentlich vorbereitet zu werden. Damit ging es auf eine Arbeitshöhe von 70 Metern zur Kanzel der Windkraftanlage, um den Generator in luftiger Höhe auszutauschen. Die Ersatzteile bringen 25 Tonnen auf die Waage.
Technisch durchgeführt wurde die Reparatur von einer Spezial-Firma, die langjährige Erfahrungen in diesem Bereich vorweisen kann. „Instandsetzungen wie diese müssen genau geplant und abgestimmt werden,“ betont Löhr. „Dazu waren Umweltamt und die untere Naturschutzbehörde mit im Boot. Wir können damit nachhaltig zu einem guten Ergebnis für Klima, Landschaft und Artenschutz in der Region beitragen.“.
Mit der Reparatur kann DEW21-Trendsetter AIRWIN auch in Zukunft grünen Strom in und für Dortmund produzieren. Das Windrad erster Stunde erzeugt jährlich rund 660.000 kWh und kann damit umgerechnet rund 400 Bürger*innen versorgen. Durch seinen Dreh können 500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Foto: DEW21

Naturforschen mit der Kamera
Kostenloser Fotoworkshop für 10–14-Jährige in den Sommerferien
Mit Foto- oder Handykamera erforschen wir die Natur in unserer Umgebung. Wir gehen zum Beispiel ganz nah dran, lernen dabei die verschiedenen Möglichkeiten der Makrofotografie kennen. Wir überlegen uns auch, wie wir kleine Inszenierungen machen können, die auf die aktuellen Themen wie Bienen- und Klimaschutz eingehen. Wir besprechen kleine Hilfsmittel und erforschen Farben und Stimmungen.
Eure Kreativität steht im Vordergrund, dazu gibt es Einblicke in die Technik, um auch dafür ein Verständnis entwickeln zu können.
Kennt ihr schon den neuen Stadtteil-Garten 7000 Schmetterlinge, der in der Nordstadt ganz in der Nähe des Künstlerhauses entsteht? Ein idealer Lebensraum für Vögel und Insekten. Auch dort werden wir auf fotografische Spurensuche gehen.
Bitte bei der Anmeldung angeben, ob eine eigene Kamera mitgebracht, oder eine bei der Kursleiterin ausgeliehen wird.
Termine:
08. + 09.07. und 15. +16.07.2021, jeweils 11.00 bis 15.00 Uhr
Der Kurs ist kostenlos.
Leitung:
Etta Gerdes, Diplom-Fotodesignerin
Ort:
Künstlerhaus Dortmund e. V.
Sunderweg 1
44147 Dortmund
Der Workshop findet im überdachten Außenbereich statt. Ausflüge in die nähere Umgebung sind geplant.
Die Teilnehmer*innen müssen eine Maske tragen.
Rückfragen und Anmeldung:
Etta Gerdes
post@etta-gerdes.de
0179-1360920

Schuldenfalle Internet vermeiden
Creditreform Dortmund vermittelt Schülerinnen und Schülern der Marie-Reinders-Realschule Finanzkompetenz – Online-Seminar mit Tipps zu Taschengeld, Onlinegeschäften und Vertragsarten
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Besonderheiten von Online-Verträgen, das Widerrufs- und Rückgaberecht, Vertragsklauseln und versteckte Abo-Modelle – bei Geschäften im Internet gibt es viel zu beachten. „Gerade für Jugendliche, die noch wenig Erfahrungen im Geschäftsleben haben, ist hier Vorsicht geboten“, so Wolfgang Scharf, Geschäftsführer der Creditreform Dortmund. In einem Online-Seminar vermittelte er zusammen mit seiner Tochter Romina den Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen der Marie-Reinders-Realschule alle wichtigen Informationen zum Thema „Finanzkompetenz – Verträge im Internet“.
„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Jungen und Mädchen gerade in dieser Zeit, in der bereits so viele Veranstaltungen nicht stattfinden können, diese digitalen Kompetenzen und wichtigen Lebenstipps für ihre berufliche und persönliche Zukunft mit auf den Weg zu geben. Auch wenn es in diesem Jahr – den Umständen geschuldet – nur online stattfinden konnte“, so Scharf.
Folgen wirtschaftlichen Handelns abschätzen
Dass viele Jugendliche und junge Erwachsene Probleme haben, die Folgen ihres wirtschaftlichen Handelns abzuschätzen, zeigt die jährliche Insolvenzuntersuchung der Creditreform. Nach den aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2020 sind rund 1,11 Millionen Menschen in Deutschland unter 30 Jahren überschuldet. „Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage zwar um rund 303.000 (21,4%) Fälle verringert, dennoch sind die Zahlen enorm hoch“, so Romina Scharf. Ein Grund aus Sicht der Experten: Häufig können Betroffene nicht abschätzen, was „hinter den Kulissen“ geschieht, wenn sie beispielsweise eine Onlinebestellung tätigen. „Bei der reinen Handhabung der Technik macht der jungen Generation niemand etwas vor“, so Finanzexperte Scharf. „Aber ab wann ein Vertrag zustande gekommen ist und welche Folgen ein vielleicht falscher Klick haben kann, ist für viele nur schwer nachzuvollziehen.“
Was die Schüler beim Vortrag besonders interessierte, war, wie Internethändler die Bonität ihrer Kunden so schnell beurteilen können. Spannend war für sie dabei zu erfahren, dass Unternehmen diese Infos bereits innerhalb von einer Sekunde nach einem Klick des Kaufinteressenten vorliegen haben. Wolfgang und Romina Scharf zeigten den Schülerinnen und Schülern auf, woher diese persönlichen Informationen stammen, sowie welche Daten von Unternehmen weitergegeben werden dürfen und welche nicht.
Als Kooperationspartner der Marie-Reinders-Realschule unterstützt die Creditreform Dortmund die Schule seit langem bei Projekten zur Berufsorientierung und zur Stärkung der Finanzkompetenz. Für Schulleiter Jörg Skubinn ist dies besonders wichtig: „Zusätzlich zum vorgegebenen Lehrplan muss Schule immer auch eine zeitgemäße Allgemeinbildung vermitteln. Gerade wirtschaftliche Zusammenhänge, Themen wie Datenschutz und Sicherheit im Internet gehören unbedingt dazu.“
www.creditreform.de/dortmund
www.mrrdo.com
Bildzeile: „Finanzkompetenz – Verträge im Internet“: In diesem Jahr als Online-Seminar, aber nicht minder wertvoll: Nathalie Kehls (v.l.), Lehrerin an der Marie-Reinders-Realschule, Wolfgang Scharf, Geschäftsführer der Creditreform Dortmund, und seine Tochter Romina gaben den Schülerinnen und Schülern der Realschule wichtige Tipps zu Taschengeld, Onlinegeschäften und Vertragsarten.
Foto: Stephan Schütze

Klimafreundliche Lebenshilfe Kita Körne: Tiefbauamt errichtet Fahrradbügel an der Berliner Straße
Die Lebenshilfe Kita Körne an der Berliner Straße setzt sich aktiv für klimafreundliche Mobilität ein. Eine gute und sichere Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Rad ist der Kindertagesstätte daher besonders wichtig. Kita und Eltern haben auf eigene Initiative den Kontakt zur Bezirksvertretung hergestellt, um die Verkehrssituation vor der Tageseinrichtung für Kinder zu verbessern. Auf Vorschlag des Tiefbauamtes wurden nun vier Fahrradbügel an der Ecke Berliner Straße/Spreestraße errichtet. Die neuen Stellplätze bieten genügend Platz für die immer beliebteren Lastenräder und Kinderfahrradanhänger.
„Wir freuen uns sehr, dass die Fahrradbügel eingebaut worden sind und dadurch die Verkehrssituation vor dem Eingang unserer Kita entschärft wird“, sagt Heike Salm, Leiterin der Lebenshilfe Kita Körne. Die Fahrradbügel wurden auf einer Fläche des verkehrsberuhigten Bereichs errichtet, der nicht als Parkplatz gekennzeichnet ist, der jedoch häufig regelwidrig zum Parken genutzt wurde.
„In Zukunft werden wir Fahrradabstellbügel vermehrt in Kreuzungsbereichen aufstellen. Zum einen werden dadurch sichere Abstellmöglichkeiten für Radfahrende geschaffen. Zum anderen verhindern die Fahrradbügel, dass wichtige Sichtbeziehungen durch den ruhenden Verkehr behindert werden“, erklärt Sylvia Uehlendahl, Leiterin des Tiefbauamtes, den doppelten Nutzen.
In Kombination mit den Sicherheits-Verkehrsfiguren, die die Kita angeschafft hat, freuen sich die Erzieher*innen nun über die gesicherte gute Einsehbarkeit des Haupteingangs. „Wer sich in die Perspektive von Kita-Kindern hineinversetzen möchte, kann neben einem geparkten Pkw in die Hocke gehen. So bekommt man ein Gefühl dafür, wie die Sicht auf die Straße durch den ruhenden Verkehr für Kinder minimiert wird und wie wichtig es ist, Querungsbereiche freizuhalten“, rät der Fuß- und Radverkehrsbeauftragte Fabian Menke.
Die Kita nimmt darüber hinaus am Programm „So läuft das“ im Rahmen des EU-Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt teil. Mithilfe eines externen Beratungsbüros unterstützt die Stadt Dortmund die Einrichtung darin, Kompetenzen für klimafreundliche Mobilität und Spaß an diesem Thema zu vermitteln. Den pädagogischen Mitarbeiter*innen werden im engen Austausch mit dem Beratungsbüro Projekte, Initiativen und Wettbewerbe näher gebracht, um das Thema klimafreundliche Mobilität in den Kitaalltag einzubinden.
16 Maßnahmen für klimafreundliches Mobilitätsverhalten
Das Mobilitätsmanagement an Kitas sowie zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt sind Maßnahmen des EU-Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt. Die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützen das Förderprojekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Bildzeile: Kita-Leiterin Heike Salm mit ein paar Kindern vor den neu installierten Fahrradbügeln.
Foto: Stadt Dortmund
Foto: Stadt Dortmund

Tempo, Tempo: Musikschule Dortmund organisierte Schnellspiel-Wettbewerb für junge Musiker*innen
Die 60 jungen Musiker*innen des Orchesters „Sinfonietta“ der Musikschule Dortmund mussten sich in den vergangenen Monaten an digitale Proben und einsames Üben gewöhnen. Um die Motivation zu erhalten, hat sich das Leitungsteam des Orchesters, Mechthild van der Linde und Achim Fiedler, einen besonderen Wettbewerb ausgedacht: eine Challenge zum Schnellspielen.
Dazu eignete sich das Bravourstück „Elfentanz“ des Komponisten Ezra Jenkinson (1872 -1947). Die 10- bis 16-Jährigen bekamen Playbacks in verschiedenen Tempostufen zugeschickt, die sie, mit ihrer eigenen Aufnahme ergänzt, als Audiodatei dem Leitungsteam zur Bewertung zurückschickten. Der Ansporn für die jungen Menschen war groß, und die Freude am Üben stieg enorm – ob mit der Querflöte, dem Cello oder der Geige.
„Die Ergebnisse waren überragend, es gibt allein sieben erste Plätze“, sagt Achim Fiedler. „Eigentlich müssten jedoch alle jungen Musiker*innen eine Medaille erhalten, die in diesen Zeiten ihrem Instrument treu bleiben“.
Bildzeile: Die sieben Erstplatzierten im Schnellspiel-Wettbewerb v.l.: Piet Bracklow, Leni Leiwering, Marlene Kruse, Anna Biosca, Lea Ksnieziak, Shiqing Sun, Fabiola Schlinkert. Hinten das Leitungsteam: Mechthild van der Linde, Tilman Muth, Achim Fiedler.
Foto: Musikschule Dortmund

Für mehr Bienen in der Stadt
Mit umweltfreundlichem Ökostrom lässt DEW21 neue Wildblumenwiesen in Dortmund entstehen
Zum Weltbienentag haben die Vereinten Nationen dazu aufgerufen: Bienen werden rar, im Sinne der Artenvielfalt müssen wir sie schützen. „Als nachhaltiges Unternehmen wollen wir in Dortmund mit anpacken, denn Naturschutz fängt zuhause an. Jede*r kann etwas tun, um seine Stadt umweltfreundlicher zu gestalten“, betont Dominik Gertenbach, Vertriebsleiter der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21). Das Unternehmen hat jetzt ein neues bienenfreundliches Ökostromprodukt für Dortmunder Bürger*innen auf den Weg gebracht.
„StromBiene“ besteht zu 100 Prozent aus Ökostrom. Das Besondere ist aber: Die Nutzer*innen tun Gutes für Immen, Honigbienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten in Dortmund. Mit 1 Cent pro Kilowattstunde werden sie zu Bienenhelfer*innen. Ein Beitrag, mit dem sich viel erreichen lässt: Beim durchschnittlichen Jahresverbrauch eines 2-Personenhaushaltes von 2.500 kWh macht das 25 Euro im Jahr. Eine Summe, die für die städtische Natur eingesetzt wird. DEW21 stellt Nutzflächen bereit, besät sie mit heimischen bienenfreundlichen Wildblumen, stellt Insektenhotels auf und unterstützt Imker bei ihrer Arbeit. Schon jetzt laufen erste Vorbereitungen von DEW21 für eine neue Wildblumenwiese an der Manteuffelstraße 60. „Wir wollen mit der StromBiene nicht nur Ökostrom anbieten, sondern zusätzlich neue und vielfältige Lebensräume für unsere Bienen und andere Insekten schaffen,“ so Dominik Gertenbach.
Zusätzlich ruft DEW21 dazu auf, selbst im Garten oder auf dem Balkon für farbenfrohe und bienenfreundliche Gewächse zu sorgen und gibt Tipps auf der Internetseite. Denn Wildblumen, Sonnenblumen, Kräuter wie Rosmarin und Thymian, Obstbäume und –Sträucher sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch eine tolle Nahrungsquelle für die emsigen Honigsammler*innen.
www.dew21.de/strombiene
Bildzeile: Wildwuchernde Wiesen wie diese sind ein perfektes Zuhause für Bienen.
Foto: Frauke Schumann

Bienen-Hotels für die Emscher
Zum „Tag der Artenvielfalt“ eine tierische Bilanz des Emscher-Umbaus
Die neue Emscher kommt – und mit ihr die Natur! Ende 2021 werden die Emscher-Gewässer vom Abwasser befreit sein, in weiten Teilen sind sie bereits heute naturnah umgestaltet. Die Emschergenossenschaft fördert die Steigerung der Artenvielfalt nun mit dem Aufstellen von Bienen-Hotels – das erste ging nach Herne. Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, überreichte es an Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda, der zugleich Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft ist.
„Im Zuge der Emscher-Renaturierung hat sich die Artenvielfalt seit Anfang der 1990er-Jahre nahezu verdreifacht – heute sind es rund 500 Arten, die in das Emscher-Gebiet zurückgekehrt sind“, bilanziert Dr. Frank Dudda zum Tag der Artenvielfalt, der jedes Jahr am 22. Mai begangen wird. Zahlreiche Tierarten sind wieder in und an der Emscher zu finden: Längst haben wieder Forellen, Groppen und Stichlinge das Gewässer als Lebensraum wiederentdeckt. „Ich freue mich sehr darüber, dass die Artenvielfalt in der Emscher und ihren Zuflüssen sich so positiv entwickelt hat. Die Wiederansiedlung der Emscher-Groppe im Herner Ostbach ist ein gutes Beispiel hierfür“, so Dr. Dudda.
Doch nicht nur im Fluss, sondern auch an den Ufern kann sich die Fauna mittlerweile wieder sehen lassen. „Der Eisvogel als Indikator einer guten Gewässerqualität fühlt sich mittlerweile an der Emscher und ihren Nebengewässern genauso wieder zuhause wie die Gebirgsstelze und die Blauflügelige Prachtlibelle – der Emscher-Umbau hat es möglich gemacht“, sagt Uli Paetzel.
Bald summt’s an der Emscher
Groppe, Libelle und Eisvogel bekommen bald summende Nachbarn, denn mit den neuen artengerechten Nisthilfen für Wildbienen engagiert sich die Emschergenossenschaft aktiv für den Schutz der Insektenvielfalt. Der in den Bienen-Hotels eingebaute Tonstein wurde von Volker Fockenberg, einem regionalen Wildbienenexperten mit langjähriger Erfahrung im Insektenschutz, optimal für die summenden Individuen entworfen und in Handarbeit angefertigt. Bis zu 1500 Bienen unterschiedlicher Arten finden darin Platz. Durch ergänzende Holzrahmen, gebaut in der Werkstatt der Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel, erhält der Stein einen zusätzlichen Witterungsschutz und hindert Fressfeinde am Öffnen der Nestverschlüsse.
Aus der Erfahrung des Herstellers ist bekannt, dass der Bienenstein in der Regel bereits im ersten Jahr angenommen wird. Über den Sommer hinweg legen die Wildbienen ihre Nester an und tragen ausreichend Winterproviant für ihre Larven heran. Im Winter bleiben die Gänge verschlossen, bis im darauffolgenden Jahr die jungen Bienen ausfliegen.
Neue Emscher ist schon da
Die Steigerung der Biodiversität im Ruhrgebiet ist eines der Ergebnisse des Generationenprojektes Emscher-Umbau. Zahlreiche bereits abwasserfreie Abschnitte – an der Emscher, aber auch an den Nebenläufen – sind bereits fertig renaturiert worden. Idyllische Flusslandschaften gibt es unter anderem an diesen Gewässern: gesamter Emscher-Oberlauf in Holzwickede und Dortmund inkl. aller Nebengewässer, Deininghauser Bach in Castrop-Rauxel, Hellbach-System in Recklinghausen, Ostbach in Herne, Resser Bach in Herten, Hofsteder Bach in Bochum, alle Gewässer in Gladbeck, Kirchschemmsbach in Bottrop, Borbecker Mühlenbach in Essen, Läppkes Mühlenbach in Oberhausen sowie die Emscher-Altarme in Duisburg.
Die neue Emscher kommt – vielerorts ist sie schon längst da!
Hintergrund: Biodiversitätsinitiative
Der drastische, weltweite Rückgang der Artenvielfalt ist besorgniserregend. Der negativen Entwicklung will der öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsverband Emschergenossenschaft entgegenwirken und die Biodiversität an Gewässern und auf verbandseigenen Anlagen stärken. Der ökologische Gewässerumbau im Emscher-Gebiet, die nachhaltige Nutzung vieler wasserwirtschaftlicher Anlagen und das gezielte Wiederansiedeln von verschiedenen, selten gewordenen Fischarten sind nur einige Beispiele für bereits laufende Maßnahmen.
Biodiversität ist ein Kernbestandteil des Programms „Lebendige Gewässer“, das an Gewässern wie Auen erfolgreich umgesetzt wird. Der Gewässerumbau wird dazu seit vielen Jahren durch ein intensives Monitoring begleitet, das z.B. die Entwicklung der gewässertypischen Fauna und Flora, darunter auch gefährdete Arten, beobachtet. Insgesamt hat sich beispielsweise im Zuge der ökologischen Verbesserung der Emscher seit rund 30 Jahren die Artenzahl gewässerlebender wirbelloser Tiere im Emscher-Gebiet etwa verdreifacht.
Die Emschergenossenschaft
Die Emschergenossenschaft ist ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das effizient Aufgaben für das Gemeinwohl mit modernen Managementmethoden nachhaltig erbringt und als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Sie wurde 1899 als erste Organisation dieser Art in Deutschland gegründet und kümmert sich seitdem unter anderem um die Unterhaltung der Emscher, um die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie um den Hochwasserschutz.
Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft in enger Abstimmung mit den Emscher-Kommunen das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von rund 30 Jahren prognostizierte 5,38 Milliarden Euro investiert werden. www.eglv.de
Bildzeile: Die Emschergenossenschaft fördert die Steigerung der Artenvielfalt mit dem Aufstellen von Bienen-Hotels – das erste ging ganz aktuell nach Herne. Prof. Dr. Uli Paetzel (li.), Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, überreichte es an Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda, der zugleich Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft ist.
Foto: Philipp Stark/Stadt Herne

Investitionen zur Abwasserinfrastruktur werden weiter gesteigert – Erneute Zusammenarbeit von Stadt und Wirtschaft über eine „Projektträgerschaft“
Die Stadtentwässerung begegnet dem weiterhin hohen Investitionsbedarf in die Abwasserinfrastruktur mit der erneuten Ausschreibung einer sogenannten „Projektträgerschaft“ eines externen Partners zur Planung und Umsetzung von Kanalbaumaßnahmen.
Diese neue Form einer Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wirtschaft wurde bereits im Jahre 2019 gemäß Beschluss des Rates in Form einer Rahmenvereinbarung abgeschlossen. Hierbei wird neben der originären Planungsleistung auch die eigenverantwortliche Leitung, Steuerung und Überwachung der Bauleistung samt aller für die Planung und den Bau notwendigen Nebenleistungen, wie Baugrundgutachten sowie Abstimmungen mit sachberührten Dritten vergeben. Der Projektträger übernimmt damit alle Bauherrenfunktionen vollumfänglich bis zur Fertigstellung der Kanalbaumaßnahmen und der Übergabe in das Eigentum des Eigenbetriebs Stadtentwässerung. Der Projektträger ist an das öffentliche Vergaberecht gebunden.
Bei der laufenden Rahmenvereinbarung sind nach weniger als zwei von vier Jahren Laufzeit Projekte in Höhe von 20 Mio. EUR bereits abgerufen und befinden sich in der Umsetzung. Der Finanzierungsrahmen des laufenden Projektes ist damit ausgeschöpft. Dr. Christian Falk, Technischer Betriebsleiter der Stadtentwässerung: „Die bundesweit erstmalige Vergabe einer Projektträgerschaft im Bereich der Abwasserbeseitigung, die durch eine Veränderung im Vergaberecht ermöglicht wurde, verläuft reibungslos. Die damit beabsichtigte Steigerung der Investitionen funktioniert.“
Nun soll dieser Weg durch die Ausschreibung einer weiteren Projektträgerschaft fortgesetzt werden. Das Gesamtvolumen wird über eine Laufzeit von 4 Jahren 40 Mio. EUR betragen.
Investitionsschwerpunkte sind: Kanalsanierung, Kanalbaumaßnahmen zum Gewässerschutz sowie die Veränderung der Siedlungsentwässerung im Kontext des Klimawandels.
Baudezernent Arnulf Rybicki erklärt: „Gerade die aktuellen Veränderungsprozesse der Siedlungsentwässerung aber auch der weiterhin große Bedarf zur Kanalsanierung verlangen eine Ausweitung der Investitionslinie. Die Projektträgerschaft ist ein guter Weg, das auch zu realisieren.“
Wie auch bei der laufenden Projektträgerschaft soll sichergestellt werden, dass die Stadtentwässerung vollumfänglich am Steuer bleibt: „Wichtig ist, dass die Stadtentwässerung zwar weitgehend die Aufgabe überträgt und damit entlastet wird, die Entscheidungshoheit, wann und wo Kanalbaumaßnahmen erfolgen, aber behält“, sagt Mario Niggemann, Kaufmännischer Betriebsleiter der Stadtentwässerung.
Ausschreibung, Vergabe und Beginn der Projektträgerschaft II könnten in 2022 erfolgen.
Bildzeile: Kanalbauarbeiten
Foto: Stadt Dortmund

Digitaler Fachtag „Bildung braucht Bewegung – Bewegung fördert Lernen“
Der Fachtag „Bildung braucht Bewegung“ war auch in seiner vierten Auflage, als digitale Veranstaltung, ein großer Erfolg. Rund 160 Fachkräfte aus den Bereichen Schule, Kita und Sport kamen digital zusammen. Ziel der Veranstaltergemeinschaft aus StadtSportBund Dortmund e. V. und dem Fachbereich Schule der Stadt Dortmund war es, die kommunale Bedeutung des Zusammenspiels von Bildung und Bewegung hervorzuheben. Die Veranstaltung wurde durch eine Videobotschaft von Frau Daniela Schneckenburger (Dezernentin für Schule, Jugend und Familie) und Frau Birgit Zoerner (Dezernentin Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit) eröffnet. Den thematischen Einstieg gab Herr Prof. Dr. Nils Neuber von der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster in einem Impulsreferat zum Thema „Bildung braucht Bewegung – Zum Zusammenhang von Lernen und Bewegung“. Durch das Impulsreferat besten vorbereitet konnten die Teilnehmer*innen anschließend in drei Phasen insgesamt 25 verschiedene Workshops besuchen. Theoretische und praktische Informationen mit Anregungen zum Thema Bewegungsförderung im Kleinkind-, Kindes- und Jugendalter sowie zu neuesten Entwicklungen in den Bereichen Diagnostik, Prävention und Intervention waren die Themen in den Workshops. Die qualifizierten Referentinnen und Referenten kamen hauptsächlich aus dem organisierten Sport, Sportfachverbänden, der Wissenschaft und kommunalen Partnern, so dass sich alle Teilnehmer*innen eine Teilverlängerung ihrer Lizenzen mit acht Lerneinheiten anerkennen lassen konnten.
Foto: StadtSportBund Dortmund e. V.

Bettina Gayk wird neue Landesbeauftragte für Datenschutz
Reul: „Bettina Gayk bringt eine Spitzen-Erfahrung mit; sie weiß wirklich, was Datenschutz bedeutet und kennt das Thema seit Jahren.“
Das nordrhein-westfälische Parlament hat Bettina Gayk zur neuen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) einstimmig gewählt. Innenminister Herbert Reul beglückwünschte die Leitende Ministerialrätin aus seinem Haus zur Wahl: „Bettina Gayk bringt eine Spitzen-Erfahrung mit; sie weiß wirklich, was Datenschutz bedeutet und kennt das Thema seit vielen Jahren. In meinem Haus wird sie für ihre Kompetenz und ihre Freundlichkeit sehr geschätzt. Für uns ein Verlust, für den Datenschutz in Nordrhein-Westfalen ein Riesengewinn.“
Seit 2012 ist Bettina Gayk im nordrhein-westfälischen Innenministerium tätig; als Referatsleiterin verantwortete sie zuletzt den Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz und war stellvertretende Abteilungsleiterin.
Ihre Karriere begann Gayk im Jahr 1991. Als Beamtin des Landes Nordrhein-Westfalen absolvierte die studierte Juristin zunächst Stationen bei der Bezirksregierung Düsseldorf, der Stadt Velbert und in Hilden.
Mehr als zehn Jahren lang (von 2001 bis 2012) arbeitete sie bereits in ihrem neuen Aufgabenbereich: Unter den Landesdatenschutzbeauftragten Bettina Sokol und Ulrich Lepper war sie Referatsleiterin und Pressesprecherin.. In dieser Zeit beschäftigte sie sich unter anderem mit neuen Sicherheitsmaßnahmen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001; so etwa mit der Zulässigkeit von Videoüberwachung. Außerdem beriet die gebürtige Wuppertalerin Konzerne zur Zulässigkeit des Datenaustauschs mit Stellen außerhalb der Europäischen Union und besonders mit den USA.
Damals wirkte Gayk an der noch heute verwendeten Homepage des LDI mit, „der ein Update nicht schaden würde“, so Gayk und benennt damit ein erstes Ziel: „Die Öffentlichkeitsarbeit liegt mir sehr am Herzen. Nur wenn wir die Menschen erreichen, um deren Daten es schließlich geht, können wir diese Grundrechte effektiv schützen. In meiner neuen Funktion möchte ich zum Beispiel mein eigenes Werk von damals, das immer noch online ist, den aktuellen Ansprüchen anpassen. Schließlich will ich die Bürgerinnen und Bürger möglichst nutzerfreundlich und einfach informieren..“
Gayk folgt auf Helga Block, die das Amt seit 2015 innehatte und im Sommer vergangenen Jahres in den Ruhestand getreten war.
Die unabhängige und weisungsfreie Landesbeauftragte überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen. Ihre Behörde setzt sich dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger ihr Recht auf freien Zugang zu behördlichen Informationen in Nordrhein-Westfalen erhalten. Daneben berät sie öffentliche und private Stellen bei datenschutzrechtlichen Themen.
Foto: Land NRW

Mit Abitur jetzt am neuen Boom der Gastronomie und Hotellerie teilhaben …
… das verspricht die WIHOGA Dortmund mit einem attraktiven Karrierestart für (Fach-)Abiturient/innen und BWL-Affine.
Im Rahmen des zweijährigen Assistent/innen-Bildungsgangs „Hospitality Management“ werden die Absolvent/innen nicht nur für die Gastronomie und Hotellerie, sondern für jede kaufmännische Tätigkeit bestens qualifiziert. zumal sie über das in allen Branchen hoch geschätzte „Gastgeber-Gen“ verfügen.
Somit interessieren sich schon seit einigen Jahren und besonders jetzt während der Pandemie auch größere Arztpraxen und -kliniken, Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, Autovermietungen, Autohäuser, Verwaltungen und moderne Industrieunternehmen usw. für diese praxisnahe Ausbildung.
Zugangsvoraussetzung für die vollschulische Berufsausbildung „Staatl. gepr. Kaufmännische(r) Assistent(in)“ mit Schwerpunkt Hospitality Management ist das Abitur oder der schulische Teil des Fachabiturs.
Daher ist der Bildungsgang auch eine hervorragende Alternative für Menschen, die nicht (mehr) sicher sind, ob ein Studium der richtige Weg für sie ist.
Unterrichtsfächer sind v.a. Betriebswirtschaftslehre, Marketing. Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsinformatik und Revenue-Management.
Spannend und praxisnah ist diese Ausbildung durch fünf vierwöchige Praxisphasen im Stil eines dualen Studiums.
Der nächste Durchgang startet am 18. August 2021. Freie Plätze sind noch vorhanden.
Beratung und weitere Informationen persönlich in der WIHOGA Dortmund, Am Rombergpark 40, telefonisch unter 0231/ 79 22 07 – 0 oder online: www.wihoga.de
Bildzeile: Der moderne Campus der WIHOGA bietet beste Voraussetzungen für eine zeitgemäße und praxisnahe kaufmännische Ausbildung. Der nächste Gastro-Boom kann kommen!
Foto: WIHOGA

Power für neue DEW21-Energiezentrale
Wichtiger Eckpfeiler für die neue Wärmeversorgung
Derzeit baut die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) an der Weißenburger Straße eine neue Energiezentrale.
Gerade sind dafür zwei von drei neuen Heizkesseln aufgestellt worden – und das war ein echtes Spektakel!
Bereits der Transport der beiden Kessel war eine spektakuläre Angelegenheit, denn jeder von ihnen wiegt im leeren Zustand 70 Tonnen und ist 4,60 Meter x 4,60 Meter x 11,0 Meter groß. Um die zwei Schwergewichte sicher nach Dortmund zu bringen, reisten sie mit Schwerlasttransportern von 38 Metern an, bevor sie mit einem Spezialkran auf das Fundament der neuen Wärmezentrale gehoben wurden. „Die Kapazität aller drei Kessel, die hier zukünftig zum Einsatz kommen werden, reicht aus, um bis zu 7.500 Haushalte zu wärmen“, beschreibt Projektleiter Alexander Kampmann die Leistung der Power-Pakete.
Die Energiezentrale an der Weißenburger Straße ist ein wichtiger Eckpfeiler für die umweltfreundliche Umstellung der Wärmeversorgung in der Dortmunder Innenstadt. Gemeinsam mit den Energiezentralen an der Adlerstraße und auf dem Betriebsgelände Lindenhorst produziert sie zukünftig als Spitzenlastheizwerk dann Wärme, wenn die ökologisch sinnvoll genutzte Abwärme der Deutschen Gasrußwerke nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen sollte. Alles in allem können mit dem Umbau der Wärmeversorgung durch DEW21 pro Jahr 45.000 t CO2 eingespart werden.

Anschaffung und Anwendung des Kinderrechte – Spiels in der Zusammenarbeit mit Familien
Über 30 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention sind die Kinderrechte ein wichtiges Thema im Alltag von Kindern geworden. Welche Rechte haben Kinder – und was bedeuten sie genau? Wie sehen Kinder und Jugendliche selbst ihre Rechte und wie können sie sich aktiv dafür einsetzen? Wie sieht es mit der Umsetzung der Kinderrechte in unserer Kommune aus?
Trotz der weltweit bekannten Bedeutung der Kinderrechte in der Fachöffentlichkeit, sind Kinder weit entfernt vom Wissen um und der Durchsetzung ihrer Rechte!
Das „Große Kinderrechte Spiel“ unterstützt Fachkräfte dabei mit Familien, Kindern und Jugendlichen spielerisch die Thematik aufzugreifen, aufzuzeigen welche Rechte es gibt und wie sich Familien dafür einsetzen können, unter Berücksichtigung des direkten Lebensumfeldes und der familiären Lebenslage.
Das Jugendamt hat mit großzügiger Unterstützung der Deutschen Kinderschutzstiftung „Hänsel und Gretel“ 150 Spiele angeschafft, um das Thema „Kinderrechte“ durch Fachkräfte kindgerecht zu vermitteln und Kinder anzuregen, über eigene Rechte im Alltag zu diskutieren. Fachkräfte haben die Möglichkeit durch den Einsatz des Spieles und den verschiedenen Spielaufgaben die Durchsetzung von Rechten im täglichen Zusammenleben spielerisch einzuüben. Das Spiel lässt individuelle Einschätzungen zu, die einen lebhaften Austausch zwischen Erwachsenen und Kindern ermöglicht.
Im Mittelpunkt steht Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, „Berücksichtigung des Kindeswillens“ und damit die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In dem Kinder und Jugendliche beteiligt werden, erleben sie, dass sie Dinge beeinflussen können und dass es sich lohnt, sich zu engagieren.
Unter dem Leitspruch „Jugendamt – Unterstützung die ankommt“ möchte das Jugendamt im Rahmen der kommunalen Präventionskette neue Zugänge schaffen – das Kinderrechtespiel bietet einen solchen innovativen Zugang.
Bildzeile: Übergabe der Kinderrechtespiele von der Jugendamtsleitung Dr. Frenzke-Kulbach an Fachkräfte aus den Bereichen Kindertagesbetreuung, den Vormundschaften, Krisenintervention und begleiteter Umgang und dem Jugendberufshaus. v.l. Nele Braß (Kindertagesbetreuung), Christoph Lewark (Jugendberufshaus), Karin Jaschowez (Krisenintervention und begleiteter Umgang), Dr. Annette Frenzke-Kulbach (Jugendamtsleitung Dr. Frenzke-Kulbach ), Jennifer Weise (Vormundschaften)
Foto: Roland Gorecki / Dortmund Agentur

Rohstoffmangel: Auch der Gerüstbau bleibt nicht verschont
Die Nachfrage nach deutschem Holz im Ausland hat enorm zugenommen. Hinzu kommt, dass der Lockdown viele zum Heimwerken angeregt hat. Die Konsequenz: Das Holz wird knapp und die Preise steigen.
Auch im Gerüstbau ist Holz ein unerlässlicher Rohstoff. Aus diesem sind z.B. die Bohlen und Boardbretter der Gerüstbau Bönninger GmbH & Co. KG hergestellt.
Da sich das junge Unternehmen im stetigen Wachstum befindet und Holz leider nicht unkaputtbar ist, muss fortlaufend für neues Material gesorgt werden. Bisher stellte dies keine Schwierigkeit dar – doch nun kommt der Rohstoffmangel in die Quere.
Die Veränderungen auf dem Markt wurden zum Glück rechtzeitig erkannt, sodass Geschäftsführer Christian Bönninger, bereits vor einigen Monaten große Mengen Holz rechtszeitig bestellt und die Lager gefüllt hat. Damit ist der Bestand an Material fürs Erste gesichert und alle Baustellen können planmäßig gerüstet werden. Die ersten LKW Lieferungen erfolgten bereits im Mai.
Foto: Gerüstbau Bönninger GmbH & Co. KG

Dortmund zeigt mit Diversity Tag im Deutschen Fußballmuseum Flagge für Vielfalt
Der Dortmunder Diversity Tag fand zum ersten Mal im Deutschen Fußballmuseum statt – das Motto: „Allianz für Vielfalt“. Expert*innen sprachen unter anderem über Themen wie Homophobie im Fußball oder den Fortschritt von Diversität in der deutschen Gesellschaft.
Auch der diesjährige Dortmunder Diversity Tag stand, wie praktisch alle Veranstaltungen derzeit, im Zeichen von Corona. So fanden etwa die sechs Breakoutsessions via Zoom statt: Vertreter*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Aktivenverbänden lieferten hier Denkanstöße zu Themen der Diversität und Inklusion.
Deniz Greschner vom Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück formulierte Thesen zu einer wachsenden Solidarität zwischen Minderheiten-Communities, die einen Beitrag zur Überwindung der stark umstrittenen Identitätspolitiken leisten; Rudolf Kast, Vorstandsvorsitzender von „ddn Netzwerk“, berichtete über vorbildliche Unternehmensbeispiele im Umgang mit älteren Mitarbeiter*innen und räumte dabei mit einigen Vorurteilen auf. Paula Scholz vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg schaute auf die Diskriminierung von Interpersonen im Fußball und fragte, ob „diese Ausschlüsse fußballspezifisch“ seien? Und der Gründer von „Vielfaltsprojekte“, Lorenz Narku Laing, zeigte auf, wie Rassismus Grenzen in unserer Gesellschaft schafft.
Keynote von Claudia Roth
Im Anschluss an die Eröffnung durch Oberbürgermeister Thomas Westphal und dem Direktor des Deutschen Fußballmuseums, Manuel Neukirchner, richtete sich die Vizepräsidentin des deutschen Bundestags, Claudia Roth, mit einer Keynote an die Referent*innen und die rund 370 Teilnehmer*innen im Netz. Roth feierte den Diversity Tag als „einen Tag der Menschenrechte“ und betonte Diversität und Inklusion als „große Idee einer gleichberechtigten Gesellschaft“, basierend auf Artikel eins des Grundgesetztes. Vieles sei in den letzten Jahren, gerade in Bezug auf Frauenrechte, erreicht worden. „Aber der gesellschaftliche Zusammenhang steht in der Pandemie auf der Kippe. Corona drängt die Errungenschaften von Jahrzehnten der Frauen zurück.“ So steige die Gewalt in den „eigenen vier Wänden“, Frauen müssten wieder verstärkt „Care-Arbeit leisten“.
Deshalb, und vor dem Hintergrund erstarkender Nationalismen, von Homophobie, Rassismus und Antisemitismus, rief Rorth dazu auf, solchen Spaltungen entgegenzutreten – gerade in Zeiten der Pandemie. Denn: „Multikulti ist nicht out, sondern mega in“, erklärte sie und verwies auf die Bildergalerie im Fußballmuseum mit Porträts von Spieler*innen wie Miroslav Klose, Anthony Yeboah oder Steffi Jones, die die Gesellschaft positiv geprägt hätten.
Outing von Fußballprofis?
Um Fußball im Kontext von Diversität ging es auch in einer prominent besetzten Gesprächsrunde, die trotz Corona im Fußballmuseum stattfinden konnte. Alle Mitglieder des Podiums hielten sich an die Hygienemaßnahmen und wiesen einen offiziell bestätigten negativen Corona-Test aus.
Unter der Moderation von Christiane Poertgen, diskutierten sechs Teilnehmer*innen, darunter die Stadtdramaturgin vom Schauspiel Dortmund, Megha Kono-Patel, und Oberbürgermeister Thomas Westphal, etwa die Ausgrenzung Homosexueller im Männerfußball und die Gefahren – und Chancen? – eines Outings. Der Soziologe Aladin El-Mafaalani sieht hier eine große Problematik beim jeweiligen Team. „Bei Mitspielern gibt es oft Signale, die ein Outing als Risiko erscheinen lassen. Ich kann verstehen, dass man da vorsichtig ist.“ Ähnlich die Meinung Thomas Westphals, der ein entsprechendes Bekenntnis, trotz der Fortschritte, etwa durch das Outing von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, nach wie vor „als hohe Barriere“ deutet. Laut Christian Rudolph sollte diese Vorbildfunktion aber nicht allein Fußballprofis zugewiesen werden. Der Leiter der zentralen Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim Deutschen Fußballbund fordert darüber hinaus, „dass sich viel mehr Personen im Sinne sexueller Vielfalt outen, neben Fußballer*innen auch Mitarbeiter*innen der Vereine oder Sportjournalist*innen“.
Diversität braucht Vorbilder
Diversität als gesellschaftliches Ziel braucht Vorbilder. Vorbilder wie Conny Dietz. Die Blindenfußballerin und Paralympics-Gewinnerin aus Dortmund ist seit Jahrzehnten Fan der Dortmunder Borussen und setzt sich im Lernzentrum Südtribüne in der Arbeit mit Jugendlichen für Toleranz und gegen Rassismus ein. Wichtig ist für sie, „die Jugendlichen auch in Bezug auf ihre Sprache zu sensibilisieren“, wobei fast immer auch ihr Leben mit dem Handicap einer Sehbehinderung eine Rolle spielt.
Transition in der Öffentlichkeit
Ähnlich offensiv geht auch Nicu Burgheim mit seiner Lebensgeschichte um. Als transidenter Mann, ehemalige Kickerin in der Frauenbundesliga und aktuell Lehrer an einer Bielefelder Schule, konnte er so während seiner „Transition in der Öffentlichkeit vielen den Wind aus den Segeln nehmen“. Gerade bei seinen Schüler*innen stieß er auf große Akzeptanz: „Ich habe den Schüler*innen erklärt, ‚Frau Burgheim geht, Herr Burgheim kommt‘ und gleichzeitig klargemacht, dass sie mich alles fragen dürfen. Dass es keine dummen Fragen gibt, sondern die Haltung dahinter entscheidend ist.“ Mit dieser offenen Art habe er „viel mehr gute als schlechte Erfahrungen gemacht“.
Megha Kono-Patel sieht das Eintreten für Akzeptanz durch biografische Bezüge kritisch. Für sie sollte Akzeptanz schon weit selbstverständlicher sein: „Es ist nicht die Aufgabe von Betroffenen, sich zu erklären“, stellt sie fest. Im Gegensatz dazu vertritt Aladin El-Mafaalani. die Überzeugung, es müsse weiter Menschen geben, „die an die Ausgrenzung von anderen erinnern und daran, dass wir trotz zahlreicher Fortschritte erst die Hälfte der Treppe erreicht haben“.
„Die offene Gesellschaft braucht uns alle!“
Weitere Themen des Podiums waren etwa die Auswirkungen von Black Lives Matter auf Deutschland, die Notwendigkeit von Empathie im öffentlichen Diskurs oder Rassismus an deutschen Theatern. Zum Abschluss der rund vierstündigen Veranstaltung unterzeichnete Manuel Neukirchner für das Deutsche Fußballmuseum die Charta der Vielfalt. Das Schlusswort gehörte Oberbürgermeister Thomas Westphal: „Die offene Gesellschaft braucht uns alle! Um die Flagge für Vielfalt wehen zu lassen, braucht es Streit und Energie, aber auch Wohlwollen. Es geht nicht darum, Abgrenzung zu definieren. Dortmund ist eine Stadt der Nachbarschaft, und das wird uns auch in Zukunft ausmachen.“
Auch der diesjährige Dortmunder Diversity Tag wurde federführend von der „Koordinierungsstelle für Lesben, Schwule und Transidente“ organisiert, erstmals in Kooperation mit dem Deutschen Fußballmuseum und mit freundlicher Unterstützung durch DSW21, DEW21 und EDG. Deutschlandweit wird dieser Tag am 18. Mai gefeiert, aus Rücksicht auf den Terminkalender einiger Teilnehmer*innen fand dessen Dortmunder Variante einen Tag vorher statt: Am 17. Mai erinnern Menschen weltweit im Rahmen des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) an die Entscheidung der WHO vor 31 Jahren, Homosexualität nicht mehr als Krankheit zu definieren.
Bildzeile: Ausrollen der Flagge für Vielfalt. (v.l.) Manuel Neukirchner (DFM), Kirsten Fronz (DSW 21), OB Thomas Westphal, Stefanie Edelbrauk (DEW 21), Paul Klammer (Vorstand SLADO), Susanne Hildebrandt (Orgateam Stadt Dortmund) .
Foto: Roland Gorecki / Stadt Dortmund

Leuchtender Auftritt fürs „Studio 54“: Wall GmbH überlässt Dortmunder U digitale Werbeflächen
„Studio 54: Night Magic“ eröffnet am 26. Juni im Dortmunder U – und strahlt schon in der City: Die nächste große Ausstellung im U wird derzeit großflächig auf digitalen Werbeanlagen in der Innenstadt beworben. Dank einer Kooperation mit der Wall GmbH erhält das Dortmunder U die Möglichkeit, prominent auf die Ausstellung aufmerksam zu machen. Insgesamt zehn Anlagen werden bis Ende Oktober 28 Tage lang mit Motiven aus dem Dortmunder U bespielt.
Die Ausstellung „Studio 54: Night Magic“ wird bis zum 17. Oktober zu sehen sein. Sie erzählt die glamouröse Geschichte der berühmten New Yorker Discothek, die Kulturgeschichte schrieb.
„Die Dortmunder Innenstadt wird damit zur digitalen Kulturmeile, das ist auch für uns ein besonderes Projekt“, sagt Cristian Kohut, Regionalmanager der Wall GmbH, der die Kooperation mit dem Dortmunder U angeschoben hat. Stefan Heitkemper, der Leiter des Dortmunder U, bedankt sich dafür herzlich. „Das digitale Schaufenster bringt Kunst und Kultur in die Dortmunder Innenstadt und passt perfekt zu uns als Haus für zeitgenössische Kultur“, so Heitkemper.
Infos und Tickets: studio54.dortmunder-u.de
Bildzeile: Werbeanlage am Ostenhellweg für die Ausstellung „Studio 54“ mit Stefan Heitkemper (Leiter Dortmunder U, links) und Cristian Kohut (Wall GmbH).
Foto: Roland Gorecki, Dortmund Agentur

DOKOM21 unterstützt die
Sparkassen Chess Trophy
Gigabit-Internet-Geschwindigkeit beflügelt
die digitale Gegenwart und Zukunft der
48. Internationalen Dortmunder Schachtage
Die Sparkassen Chess Trophy findet vom 10. bis
18. Juli 2021 in Dortmund und im Internet statt
DOKOM21 unterstützt als Sponsor die 48.
Internationalen Dortmunder Schachtage. Mit Gigabit-Internet-
Geschwindigkeit und einer Anbindung an das DOKOM21
Glasfasernetz beflügelt der regionale
Telekommunikationsdienstleister die digitale Gegenwart und Zukunft
des renommierten Schachfestivals, das vom 10. bis 18. Juli 2021 in
Dortmund und weltweit im Internet stattfindet.
„Bereits seit 2003 unterstützt DOKOM21 als einer der führenden
Telekommunikationsdienstleister in der Region erfolgreich die Internationalen
Dortmunder Schachtage. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr mit
Gigabit-Internet-Geschwindigkeit und einer Anbindung an das DOKOM21
Glasfasernetz mit dazu beitragen, dass das international renommierte Schachfestival auch digital zu einem Megaerfolg werden kann“, sagt Helen
Waltener, Marketingmitarbeiterin bei DOKOM21.
DOKOM21 unterstützt Präsentation der Veranstaltung im Internet
Die 48. Internationalen Dortmunder Schachtage wollen den Zuschauern auf der
gesamten Welt Livebilder und die Partien im Internet präsentieren. DOKOM21
stellt den Schachtagen für die Präsentation der Veranstaltung im Internet eine
synchrone Glasfaseranbindung mit einer permanent stabilen Bandbreite von 500
Mbit/s kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich stattet DOKOM21 das Pressezentrum
und das Organisationsbüro der Schachtage im Kongresszentrum der
Westfalenhallen mit einer exklusiven Glasfaserleitung mit 100 Mbit/s im Upload
und Download aus. Damit trägt der regionale Telekommunikationsdienstleister
mit dazu bei, die digitale Gegenwart und Zukunft des renommierten
Schachfestivals zu sichern.
Dortmunder Schachtage erfahren digitalen Schub
Die Dortmunder Schachtage erfahren in diesem Jahr einen digitalen Schub.
Durch die Digitalisierungsoffensive wird das internationale Schachturnier, bei
dem Weltmeister, Großmeister, Nachwuchssportler und Amateure
gleichermaßen beteiligt sind, noch intensiver zu erleben sein. Im Rahmen des
digitalen „Sparkassen Online Open“ können Spielerinnen und Spieler weltweit
direkt teilnehmen. Dieses offene Turnier startet bereits am 10. Juli 2021.
Der Veranstaltungsleiter der Dortmunder Schachtage Carsten Hensel freut sich,
die seit 2003 erfolgreiche Zusammenarbeit mit DOKOM21 fortzusetzen: „Wir sind
sehr froh, dass wir wieder auf DOKOM21 als Unterstützer für das Schachfestival
mit nationaler und internationaler Bedeutung zählen können. Die Gigabit-Internet-
Anbindung durch DOKOM21 ist für uns eine sehr gute Grundlage, um die digitale
Präsenz der Dortmunder Schachtage erfolgreich zu entwickeln und zu gestalten.“
Schachfreunde auf der ganzen Welt fiebern bereits dem Highlight im Sommer in
Dortmund entgehen: Mit Wladimir Kramnik (Russland) und Viswanathan Anand (Indien) duellieren sich bei den Schachtagen der 14. und der 15.
Schachweltmeister in einer innovativen Schachvariante beim „NC World
Masters“. Außerdem messen sich die deutschen Topspieler mit internationalen
Großmeistern beim „Deutschland Grand Prix“. Beide Topevents finden, ebenso
wie der NRW Jugend Cup, vom 13. bis 18. Juli 2021 im Kongresszentrum der
Westfalenhallen in Dortmund statt, das digitale „Sparkassen Online Open“ vom
10. bis 18. Juli 2021 im Internet.
www.sparkassen-chess-trophy.de
www.dokom21.de
Bildzeile: Helen Waltener (li.), Marketingmitarbeiterin bei DOKOM21, und Stefan Koth,
Vorsitzender der Initiative Pro Schach e.V., freuen sich auf die 48.
Internationalen Dortmunder Schachtage, die DOKOM21 als Sponsor unterstützt.
Mit Gigabit-Internet-Geschwindigkeit und einer Anbindung an das DOKOM21
Glasfasernetz beflügelt der regionale Telekommunikationsdienstleister die
digitale Gegenwart und Zukunft des renommierten Schachfestivals, das vom 10.
bis 18. Juli 2021 in Dortmund und weltweit im Internet stattfindet.
Foto: Roland Kentrup

„Tacheles reden und Respekt zeigen“: Ein Abschied aus dem Hörder Revier
Der 5. November 1975 war sein erster Arbeitstag und der 31. Mai 2021 sein letzter – dazwischen: fünfundvierzigeinhalb Jahre Polizei NRW. Nun geht Polizeihauptkommissar Jürgen Heinrich in den Ruhestand. Der Dortmunder erlernte als 16-Jähriger den Polizeiberuf und kehrte nach einem kurzen Abstecher in Düsseldorf 1979 zurück nach Dortmund.
Seitdem arbeitete er ununterbrochen auf der Wache in Hörde. Bis 1998 im Streifendienst und dann fast 25 Jahre als Bezirksdienstbeamter im Bereich Clarenberg. „Ich habe bei einer Verfolgungsfahrt einen Streifenwagen in den Graben gesetzt, leider auch tödliche Verkehrsunfälle aufnehmen müssen und den Strukturwandel in Hörde miterlebt. Was mir hier gefällt, das ist der sehr ehrliche Umgang zwischen der Polizei und den Bürgerinnen und Bürgern: Man kann hier Tacheles reden und zugleich Respekt zeigen – und bekommt das dann genau so zurück.“
Tausenden Kindern brachte Jürgen Heinrich das sichere Überqueren von Straßen bei. Mit ihm lernten sie das Radfahren. An manchen Tagen holten sie morgens ihren Bezirksdienstbeamten an der früheren Polizeiwache in der Alten Benninghofer Straße ab, um mit ihm zur Schule zu gehen. Oder sie sangen für ihn dort ein Geburtstagsständchen. Diese Momente zählt der Polizeihauptkommissar zu den Höhepunkten seiner Laufbahn.
„Ich werde es auch vermissen, morgens nicht mehr vor der Stift-Grundschule und der Brücherhof-Grundschule zu stehen und persönlich für einen sicheren Schulweg sorgen zu können“, sagt der 62-Jährige, der von den Vereinen, Kindergärten, Schulen und den Bürgerinnnen und Bürgern seines Reviers kurz vor dem letzten Arbeitstag gerne persönlich Abschied nehmen möchte. Doch die Pandemie macht ihm einen Strich durch die Rechnung.
Also sagt er auf diesem Weg Danke: „Danke für die gute Zusammenarbeit, das Vertrauen. Danke dafür, dass wir es durch gemeinsame Verkehrserziehung an den Kindergärten und Schulen geschafft haben, Unfälle zu vermeiden. Und wenn es nur ein Unfall mit einem Kind war, den ich in meinem Berufsleben als Polizist verhindert habe, dann haben sich diese 45 Jahre gelohnt.“
Gelohnt haben sich die Kontakte auch für die Jungen und Mädchen, für die der Bezirksdienstbeamte ein Vorbild war, wenn er erwachsene Falschparker vor einer Schule darum bat, hinter einem Auto in die Hocke zu gehen – um die Perspektive von Kindern im Straßenverkehr einzunehmen. Manch ein Kind von damals hat sich inzwischen selbst für den Polizeiberuf entschieden. „Kennst Du mich noch …?“, fragen die jungen Kolleginnen und Kollegen in Uniform dann „ihren“ ehemaligen Bezirksdienstbeamten.
Nach mehr als vier Jahrzehnten Polizeidienst rät er ihnen, in Einsätzen immer an die Eigensicherung zu denken und – egal, ob jung oder alt, groß oder klein und ganz gleich welcher Herkunft oder Hautfarbe – allen Menschen unvoreingenommen zu begegnen. „Ob Arbeitslose oder Hochschulprofessor – ich habe alle immer gleich behandelt und bin ganz gut damit gefahren.“
„Natürlich gibt es die Unbelehrbaren“, sagt Jürgen Heinrich, „aber mit denen muss man dann eben in die Hocke gehen und die Perspektive verändern.“ Die Perspektive ändern – das rät er auch im Umgang mit dem Clarenberg in Hörde. Jürgen Heinrich: „Früher sind wir da mit mindestens zwei Streifenwagen in den Einsatz gefahren. Heute gehe ich da durch und die Kinder kommen auf mich zugelaufen.“
Bildzeile: Nach fast 25 Jahren als Bezirksdienstbeamter in Hörde geht Polizeihauptkommissar Jürgen Heinrich in den Ruhestand. Persönlich verabschieden kann er sich bei Schulen, Kindergärten sowie Bürgerinnen und Bürgern wegen der Pandemie leider nicht.
Foto: Polizei Dortmund

Starke Logistikpartnerschaft für die Region
Betreiberkonsortium für Containerterminal Osnabrück hat sich gegründet
Das Betreiberkonsortium für das neue Containerterminal am Osnabrücker Hafen, das die beiden Stadtwerke Osnabrück und Dortmund derzeit bauen, hat sich gegründet. Drei starke Logistiker mit Sitz in Osnabrück übernehmen das Ruder in der neuen Terminal-Betreibergesellschaft – und setzen ein Zeichen für den Logistikstandort Osnabrück.
Hinter der Container Terminal Osnabrück – kurz CTO – steht ein Konsortium der regionalen Logistiker Hellmann, Koch International und Nosta als Mehrheitsgesellschafter. Die restlichen CTO-Anteile hält die Terminalbesitzgesellschaft Osnabrück (TBOS) als Bauherrin der Anlage. Hinter der TBOS stehen die Stadtwerke Dortmund und Osnabrück. „Wir freuen uns, dass wir für den Betrieb der Anlage weltweit tätige Logistikunternehmen mit regionaler Verankerung gewinnen konnten“, betont TBOS-Geschäftsführer Guido Giesen. „Das ist ein weiterer Beleg für die Bedeutung, die Osnabrück als starker Logistikstandort hat – und ein enormer Gewinn für unsere Region.“
Fokus auf Nachhaltigkeit
„Diese starke Partnerschaft setzt uns mit einem Schlag auf die internationale Landkarte des Containerumschlags“, ergänzt TBOS-Co-Geschäftsführerin Kristina Rummeld. Die Möglichkeiten, die sich insbesondere durch die enge Vernetzung mit dem Dortmunder Logistikstandort böten, machen die gesamte Region zu einer noch bedeutenderen Logistik-Drehscheibe. „Und dies mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, indem wir die zunehmenden Ladeverkehre auf die Schiene bringen.“
Betrieb ab Herbst
„Genau wie die TBOS-Gesellschafter versprechen auch wir uns weitere Entwicklungsmöglichkeiten durch den Betrieb des Terminals“, erläutert Klaus Hellmann vom Betreiberkonsortium. „Die Güterströme nehmen zu, Güterwege wie die neue Seidenstraße werden immer bedeutender – hier an entscheidender Stelle mit starken Partnern gemeinsam zu wirken, Ladeverkehre zu bündeln und auf die Schiene verlagern zu können, bietet große Potentiale für uns alle.“ Die CTO wird den Betrieb der KV-Anlage (kombinierter Verkehr) zum 1. Oktober dieses Jahres aufnehmen.
Portalkräne bereits aufgebaut
Bereits im Sommer soll das Terminal mit seinen Wahrzeichen – den beiden kürzlich aufgebauten, gut 40 Meter hohen Portalkränen – fertiggestellt sein. Ab Oktober können 700 Meter lange Ganzzüge ins Terminal einfahren und be- und entladen werden. Bis zu 150.000 Ladeeinheiten pro Jahr können und sollen über das Terminal von der Straße auf die Schiene umgeschlagen werden. Rund 29 Millionen Euro investieren die TBOS-Gesellschafter in den Bau der Anlage. Gut 80 Prozent des Gesamtinvests kommen aus einem Fördertopf des Bundesverkehrsministeriums.
Hintergrund: TBOS & CTO
Die Terminalbesitzgesellschaft OS (TBOS) GmbH & Co. KG ist Bauherrin des neuen Containerterminals am Hafen Osnabrück. Gesellschafter sind die DSW21 (49 Prozent) und die Stadtwerke Osnabrück (25 Prozent), die restlichen 26 Prozent der Anteile halten Osnabrücker Spediteure.
Die Container Terminal Osnabrück (CTO) GmbH ist Betreiberin der KV-Anlage. Gesellschafter sind die Logistikunternehmen Hellmann (41 Prozent), Koch International (5 Prozent) und Nosta (5 Prozent) sowie die TBOS (49 Prozent).
Bildzeile: Das Betreiberkonsortium für das Containerterminal Osnabrück hat sich gegründet: (V.l.) Nosta-Geschäftsführer Rüdiger Tepe, der Osnabrücker Stadtwerke-Vorstand Dr. Stephan Rolfes, TBOS-Geschäftsführerin Kristina Rummeld, Hellmann-Gesellschafter Klaus Hellmann, TBOS-Mitgesellschafter Dr. Clemens Haskamp, Koch International-Geschäftsführer Uwe Fieselmann sowie TBOS-Geschäftsführer Guido Giesen.
Foto: TBOS / Uwe Lewandowski

Das WILDWUCHS-Kollektiv erobert den öffentlichen Raum
Anfang Mai konnten aufmerksame Passant:innen die ersten Sprossen des WILDWUCHS-Kollektivs ausfindig machen. An (semi-)öffentlichen Räumen zwischen dem Speicher100 und dem Fredenbaumpark konnten Wandersteine gefunden, Plakate gebastelt und Collagen gestaltet, Kaffee getrunken und Lyrik verfasst werden. Zusätzlich wurden QR Codes in der Stadt verteilt, die auf Spotify-Playlists des Kollektivs verwiesen haben. Über 30 Passant:innen und zufällig vorbeigekommene Personen nahmen an den Aktionen der jugendlichen Künstler:innen teil und trugen so dazu bei, dass die erste, von insgesamt acht Aktionen des Kollektivs, die bis Ende September 2021 angedacht sind, ein voller Erfolg wurde.
“Ganz besonders schön fand ich, dass Menschen, die Wildwuchs noch nicht kennen stehengeblieben sind und gefragt haben, was es mit den Aktionen auf sich hat”, sagt Birgit Götz, die künstlerische Initiatorin des Projekts. Es habe durchweg positives Feedback gegeben, Gespräche wurden mit den Jugendlichen gesucht und der Freude über das kulturelle Angebot wurde Ausdruck verliehen.
Geplant sind weitere Aktionen für die Sommermonate, unter anderem ein Workshop zu Urban Gardening, Kunstaktionenin der Galerie 42 und einem Upcycling Workshop bei Pandora 2.0. Informieren können sich Interessierte über den Instagram-Kanal wildwuchs-kollektiv, sowie über die Homepage des Trägers www.vier-d.info/projekte/wildwuchs. Ermöglicht wird das Projekt durch die Zuwendungen im Rahmen von NEUSTART KULTUR: Young Experts des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, sowie des Fonds Soziokultur. Ebenso durch das Kulturbüro Dortmund und durch die Kooperation mit Maschinerie e.V. im Speicher 100.

Expertin im Bereich Neuroimmunologie Neue Direktorin der Neurologie: Herzlich willkommen, Priv.-Doz. Dr. Gisa Ellrichmann!
Die Klinik für Neurologie im Klinikum Dortmund hat eine neue Leitung: Priv.-Doz. Dr. Gisa Ellrichmann ist fortan Klinikdirektorin und fachlich mit ihren Schwerpunkten Akut-Neurologie sowie Neuroimmunologie ein großer Gewinn für das Haus. Vor ihrer neuen Tätigkeit in Dortmund war sie geschäftsführende Oberärztin im St. Josef-Hospital in Bochum und dort zuletzt auch Teil des Corona-Krisenstabs. Im Klinikum möchte die 42- Jährige die ambulante und stationäre Versorgung in Hinblick auf Krankheitsbilder wie Multiple Sklerose, Parkinson und Kopfschmerzen intensivieren. „Ich darf dank meines Vorgängers eine hervorragend funktionierende und große Abteilung übernehmen, die ich nun um meine eigenen Schwerpunkte und Ideen ergänzen möchte“, sagt Priv.-Doz. Dr. Ellrichmann. „Um das bereits breite Angebot zu vergrößern, ist unter anderem der Ausbau der neurologischen Intensivstation geplant.“ Auch die Erweiterung der Stroke Unit (Schlaganfall-Station) und der ambulanten Angebote soll zeitnah umgesetzt werden. Zu den Zielen der neuen Direktorin gehört zudem die Entwicklung einer neurologisch- neuroonkologischen Frührehabilitation: Dabei wird gemeinsam mit den Patient* innen und einem fachübergreifenden Ärzte- sowie Therapeutenteam noch am Krankenbett ein maßgeschneidertes Therapieprogramm erstellt. „Für die Patientenversorgung ist es ein enormer Vorteil, dass wir zahlreiche Fachdisziplinen unter einem Dach vereint haben und auf schnellem Wege Kolleginnen und Kollegen anderer Bereiche um Rat bitten können“, so Priv.-Doz. Dr. Ellrichmann. PD Dr. Ellrichmann folgt in ihrer neuen Funktion auf Prof. Dr. Michael Schwarz, der dem Klinikum weiterhin als Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer erhalten bleibt.
Bildzeile: Begrüßt wurde PD Dr. Gisa Ellrichmann von dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Rudolf Mintrop (links), Arbeitsdirektor Dr. Karsten Schneider (rechts) sowie ihrem Vorgänger Prof. Dr. Michael Schwarz, der dem Klinikum weiterhin als Ärztlicher Direktor sowie Medizinischer Geschäftsführer erhalten bleibt.
Foto: Klinikum Dortmund

Frühjahrsputz Westerfilde & Bodelschwingh: Ein Quartier putzt sich heraus!
Eine*r für alle, alle für die Umwelt: Im Rahmen des Frühjahrsputzes rief das Quartiersmanagement Westerfilde & Bodelschwingh alle Bewohner*innen des Stadtteils dazu auf, sich in Kleinstgruppen auf Müllsammel-Tour zu begeben und das Quartier von achtlos entsorgtem Unrat und Müll zu befreien. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Im Zeitraum der Aktionswoche 2021 wurden über 50 Müllsäcke zusammengetragen und dem Quartiersmanagement kontaktfrei zur Entsorgung übergeben.
Rund 60 Teilnehmer*innen folgten dem Aufruf des Quartiersmanagements und machten sich in coronakonformen Kleinstgruppen auf Müllsammeltour durch das Stadtgebiet. Ob in der Nachbarschaft, im Rahmer Wald oder rund um den nächsten Supermarkt – die Einsatzorte der fleißigen Sammler*innen waren vielfältig. Mit Zangen, Handschuhen und Müllsäcken, die nach Voranmeldung vom Quartiersmanagement überreicht wurden, ging es dem achtlos entsorgten Müll an den Kragen. Abgeholt wurde er mit dem „Mülltaxi“: Mit Muskelkraft und elektronischer Unterstützung steuerte Veranstaltungsmanagerin Kathrin Eilinghoff ein umweltfreundliches Lastenrad zu den einzelnen Teilnehmenden und sammelte den Müll ein.
Auf diese Weise konnten nicht nur über 50 prall gefüllte Müllsäcke, sondern auch weiterer Unrat wie alte Autoreifen oder illegal entsorgte Styroporplatten zusammengetragen und vorschriftsgemäß entsorgt werden.
„Es ist wirklich toll, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht und mit angepackt haben“, freut sich Quartiersmanager Christoph Schedler. „Die Aktion hat viel positives Feedback aus dem Quartier erhalten. Ich denke, es ist gelungen, auch in diesen gesellschaftlich schwierigen Zeiten ein wahrnehmbares Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein im Stadtteil zu setzen“, so Schedler weiter. Die Aktion „Wir für ein sauberes Quartier – Frühjahrsputz Westerfilde & Bodelschwingh“ wurde organisiert vom Quartiersmanagement Westerfilde & Bodelschwingh und ist ein Projekt des Amtes für Stadterneuerung, finanziert mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Dortmund aus dem Programm „Soziale Stadt Westerfilde & Bodelschwingh“.
Bildzeile: Kinder der Kita Wattenscheidskamp kümmern sich um ihr Quartier.
Foto: FABIDO Kita Wattenscheidskamp

Expertin für Bildungsforschung
Prof. Susanne Prediger in wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz berufen
Mit insgesamt 16 Expertinnen und Experten wird die neugegründete und unabhängige „Ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz“ die Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen beraten. Prof. Susanne Prediger von der Fakultät für Mathematik der TU Dortmund ist eine von zwölf Expertinnen und Experten, die neben vier festen Mitgliedern in die Kommission berufen worden sind.
Aufgabe der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (KMK), die Ende Mai ihre Arbeit aufnimmt, wird es sein, die Länder in Fragen der Weiterentwicklung des Bildungswesens und des Umgangs mit seinen Herausforderungen zu beraten sowie konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Die Kommission nimmt in ihrer Arbeit eine interdisziplinäre, längerfristige und systemische Perspektive entlang der Bildungsbiografie ein.
„Es ist eine große Verantwortung, für die Kommission ausgewählt worden zu sein. Zu vielen großen Fragen können wir inzwischen substanzielle Forschungsergebnisse aufzeigen und darlegen, welche Maßnahmen sich zur Weiterentwicklung der Qualität von Schule und Kita lohnen und welche weniger erfolgsversprechend sind“, sagt Prof. Susanne Prediger. „Um die Unterrichtsqualität systematisch weiterzuentwickeln, braucht es zum Beispiel keine Schulstrukturreform, sondern professionelle Lehrkräfte, eine Anpassung von Lehrplänen und Prüfungsanforderungen sowie treffsichere Unterstützungsmaterialien, gerade für die derzeitigen Herausforderungen.“
Diese Herausforderungen betreffen neben einer besseren Vergleichbarkeit des Bildungswesens auch längerfristige Strategien für mehr Bildungsgerechtigkeit, für die Inklusion und die Digitalisierung. Ein weiterer Punkt ist der Mangel an grundständig ausgebildeten Lehrkräften, der zu längerfristigen Nachqualifizierungsprogrammen für Seiteneinstiegende führen muss.
Ein aktuelles Thema könnte für die Kommission gleich zu Beginn das vom Bund angekündigte „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ sein, bei dem derzeit noch ungeklärt ist, wie das Geld eingesetzt und verteilt werden kann. „Wir müssen aufpassen, dass die zwei Milliarden Euro nicht in kurzfristiger Nachhilfe verpuffen, sondern auch in nachhaltige Qualitätsentwicklung für Aufarbeitungsprogramme an den Schulen selbst investiert werden“, erklärt Prof. Prediger.
Über Prof. Susanne Prediger
Susanne Prediger ist seit 2006 Professorin für Mathematikdidaktik am Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts der TU Dortmund. Seit 2017 ist sie Vize-Direktorin des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik (DZLM), das zum Jahresbeginn Teil des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) wurde. Seit 2021 leitet sie das DZLM-Netzwerk und arbeitet dabei mit den Landesinstituten vieler Bundesländer eng zusammen. Von 2017 bis Ende 2020 war sie Präsidentin der European Society for Research in Mathematics Education und seit 2019 ist Prof. Prediger Mitherausgeberin der Zeitschrift Educational Studies in Mathematics. Sie ist eine international ausgewiesene Expertin für den Umgang mit Heterogenität im Fachunterricht. Jüngst war sie Mitglied der Arbeitsgruppe Corona und Bildung der Leopoldina-Akademie.
Die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz
In der KMK arbeiten die für Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und Minister bzw. Senatorinnen und Senatoren der Länder zusammen. In einer Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen war im Oktober letzten Jahres die Einrichtung einer Ständigen wissenschaftlichen Kommission beschlossen worden. Diese wird zunächst befristet für sechs Jahre eingerichtet. Ihre Empfehlungen an die KMK wird die Kommission veröffentlichen.
Bildzeile: Prof. Susanne Prediger von der Fakultät für Mathematik der TU Dortmund wurde in die „Ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz“ berufen.
Foto: privat

Erste Hilfe fürs Kulturgut: Dortmund Archive kooperieren mit der Feuerwehr – Notfall-Rollwagen eingelagert
Sieben große Rollwagen mit Notfallmaterialien sind heute bei der Feuerwehr Dortmund in Dorstfeld eingelagert worden. Sie enthalten eine „Erste Hilfe“-Ausstattung für die Bergung, Erstversorgung und Sicherung von Kulturgut nach Katastrophen. Angeschafft wurden die Wagen vom „Notfallverbund Dortmund“, der sich Anfang 2019 gegründet hat, um das Dortmunder Kulturgut gemeinsam besser schützen zu können.
Zum Notfallverbund Dortmund gehören aktuell neun Archive, Bibliotheken und Sammlungen: das Baukunstarchiv NRW, das Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt, das Institut für Zeitungsforschung, das Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse e.V., das Stadtarchiv Dortmund, die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, die Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, das Universitätsarchiv und die Universitätsbibliothek der TU Dortmund.
Überflutungen, Feuer oder Gebäudeschäden – das schriftliche Kulturgut ist vielen Gefahren ausgesetzt. Die Mitglieder des Dortmunder Notfallverbunds haben sich zur gegenseitigen Unterstützung verpflichtet. Sie entwickeln Notfallpläne, führen Übungen durch und tauschen kontinuierlich Wissen und Informationen aus. Regelmäßige Treffen sorgen dafür, dass die Notfallplanung für Kultureinrichtungen als Daueraufgabe ernst genommen wird. Jedes Haus hält Notfallmaterialien für kleine Schadensereignisse in so genannten Notfallboxen bereit.
Um aber auch für größere Katastrophen gerüstet zu sein, hat der Notfallverbund Dortmund nun sieben Notfall-Rollwagen für insgesamt 22.213 Euro angeschafft und diese mit zusätzlichen Materialien bestückt. Finanziert wurde die Anschaffung durch Eigenanteile der Mitglieder sowie eine Bundesförderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), die Kulturstiftung der Länder (KSL) sowie die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK).
In den Wagen enthalten sind Hilfs- und Arbeitsmittel wie Sackkarren, Bergungsbehälter, Kabeltrommeln und Stirnleuchten, Werkzeuge wie Hacken, Hämmer und Schaufeln, Verbrauchsmaterial wie Stretchfolie, Schutzbekleidung wie Atemmasken, Sicherheitsstiefel, Handschuhe und Overalls sowie größere Gerätschaften, beispielsweise Arbeitstische und Leitern, die nicht von jedem Mitglied des Notfallverbundes vor Ort vorgehalten werden können. Die zentrale Organisation der Materialien spart Kosten und minimiert den Aufwand für Wartung und Ersatzbeschaffung.
Im Notfall alarmieren sich die Mitglieder des Verbundes über eine Telefonkette sofort gegenseitig, die Feuerwehr Dortmund transportiert die Rollwagen mit den Materialien ohne Zeitverlust an den Schadensort, und die Rettungsmaßnahmen können binnen weniger Minuten beginnen.
Das Hochwasser im Dresdener Zwinger, der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek Weimar und der Einsturz des Stadtarchivs Köln haben seit Ende der 1990er-Jahre deutschlandweit das Bewusstsein für die Gefährdung der kulturellen Überlieferung geschärft. Die Mitglieder des Notfallverbundes Dortmund sind mit den eingelagerten Notfall-Rollwagen bestens auf größere Katastrophen vorbereitet. Trotzdem hoffen alle Mitglieder, dass die sorgfältig ausgewählten Notfallmaterialien nie zum Einsatz kommen müssen.
Foto: Ilka Minneker

Weiterer Preisregen für Kurator des Comic-Schauraums: Dr. Alexander Braun mit PENG!-Auszeichnungen bedacht
Dr. Alexander Braun, Kurator des schauraum: comic + cartoon in Dortmund, ist mit dem Münchner Comicpreis PENG! ausgezeichnet worden. Der Comicpreis wird seit 2005 alle zwei Jahre zum Comicfestival München verliehen. Alexander Braun erhält den Preis in den Kategorien „Beste Edition eines Klassikers“ sowie „Beste Sekundärliteratur“ und ist damit der erste Preisträger, der in zwei Kategorien zugleich erfolgreich ist.
Zuletzt veröffentlichte Alexander Braun „Will Eisner – Graphic Novel Godfather“ im avant-verlag, zuvor „Anime fantastisch“ (riva Verlag). Beide Bücher erschienen zu den gleichnamigen Ausstellungen im schauraum: comic + cartoon.
Seit 2019 kuratiert Braun die Ausstellungen für den neu gegründeten schauraum: comic + cartoon in Dortmund. Noch bis zum 15. August läuft dort die große Will Eisner-Retrospektive. Im Anschluss wird die Schau in Erlangen und Basel sowie 2023 in Rendsburg gezeigt.
Im vergangenen Jahr wurde Dr. Alexander Braun bereits zum zweiten Mal mit dem Eisner Award geehrt, der weltweit wichtigsten Comic-Auszeichnung. Damit ist der gebürtige Dortmunder der erste Deutsche, dem diese Ehre zu Teil wurde.
Bildzeile: Dr. Alexander Braun mit dem Münchner Comicpreis PENG!
Foto: Alexander Braun

Stellvertretende Dechanten gewählt
Aufgaben in der Leitung der Katholischen Stadtkirche Dortmund Propst Andreas Coersmeier gab im Mai das Wahlergebnis für seine Stellvertreter im Amt des Stadtdechanten in Dortmund bekannt. Nach dem Ablauf der Amtsperiode von fünf Jahren wurden die Pfarrer Michael Ortwald und Michael Vogt wiedergewählt sowie Pastor Stefan Tausch vom Katholischen Forum neu zu einem der drei Stellvertretenden Dechanten bestimmt. Gewählt haben per Briefwahl die Mitglieder der Dekanatspastoralkonferenz, der Priester, Diakone und Gemeindereferentinnen und –referenten angehören.
Erster Repräsentant der Katholiken in Dortmund ist, wie bisher, Propst Andreas Coersmeier als Stadtdechant. In Dortmund ist das Amt des Stadtdechanten mit dem des Propstes, des Pfarrers der Propsteigemeinde St. Johannes Baptist, verbunden und wird nicht durch eine Wahl bestimmt.
Die drei gewählten Stellvertreter unterstützen gemeinsam mit dem Dekanatsteam den Stadtdechanten bei seinen Aufgaben. Dabei wenden sie sich in der Regel besonderen Schwerpunkten, wie Caritas, Jugend oder Ökumene zu. Das Dekanat Dortmund ist mit rund 148.000 katholischen Christen das größte Dekanat im Erzbistum Paderborn.
Propst Andreas Coersmeier dankte besonders Pfarrer Ansgar Schocke, der nicht mehr kandidiert hatte, für sein Engagement als stellvertretender Dechant in den letzten fünf Jahren. Sein Schwerpunkt war vor allem die Ökumene der christlichen Kirchen und der Dialog der Religionen in Dortmund.
Bildzeile: Stellvertretende Dechanten in Dortmund gewählt (v.l.): Michael Vogt, Stefan Tausch, Propst Andreas Coersmeier (Stadtdechant) und Michael Ortwald.
Foto: Michael Bodin / Kath. Stadtkirche

Neue Koordinatorin Katharina Sonnet lädt im Palliativbereich zur Kooperation ein
Die erste Koordinatorin des neuen Ambulanten Erwachsenen Hospizdienstes Dunkelbunt hat ihre Arbeit aufgenommen: Katharina Sonnet (54) ist Diplom-Sozialpädagogin und hat schon alle Hände voll zu tun. Wer Interesse hat, Ehrenamtliche in der Sterbebegleitung einzusetzen, ist herzlich eingeladen, sich zu melden.
Im März wurde der erste überkonfessionelle Erwachsenenhospizdienst in Dortmund vom Verein Forum Dunkelbunt gegründet. Derzeit werden die ersten Ehrenamtlichen ausgebildet, die ab Juni in die Begleitung starten können. Katharina Sonnet ist Mutter eines Sohnes und hat vorher in einer queeren Frauenberatungsstelle gearbeitet. Sie baut derzeit am Netzwerk des Hospizdienstes und nimmt Kontakte auf zu Seniorenbüros, Pflegeheimen, Palliativärzt*innen und allen anderen, die Patient*innen von der kurativen in die palliative Phase zu begleiten.
„Wir möchten auch gerne schon frühzeitig eingebunden werden, damit sich zwischen Patienten und Ehrenamtlichen eine Beziehung entwickeln kann,“ sagt Katharina Sonnet. Es ginge nicht darum, nur in den allerletzten Stunden am Bett zu wachen. Auch die Angehörigen der Patientinnen sollen Entlastung und Unterstützung erfahren – auch hier ist es gut, wenn die Begleitung nicht zu spät beginnt.
Auch Pflegedienste aus Dortmund, die gerne Ehrenamtliche einsetzen möchten, sind eingeladen, sich bei Katharina Sonnet zu melden. Aber auch alle Altenheime, Palliativstationen usw. können Kontakt aufnehmen, wenn sie einen Rahmenvertrag abschließen möchten.
Nach den Sommerferien werden zwei neue Ausbildungskurse für Ehrenamtliche starten. Der erste Kurs läuft komplett als ZOOM-Kurs, die nächsten zwei Kurse haben die Chance, in den Vereinsräumen an der Dresdener Straße 15 in Präsenz zu laufen, wenn sich die Corona-Lage bis dahin entspannt hat. Bisher haben sich bereits 18 Personen ihr Interesse an der Ausbildung bekundet. Katharina Sonnet: „Es ist begeisternd, wie viele Menschen in Dortmund bereit sind, andere Menschen ehrenamtlich in der letzten Lebensphase zu unterstützen.“
Kontakt: katharinasonnet@forum-dunkelbunt.de; 0231-53300881
Bildzeile: Die erste Koordinatorin des Ambulanten Erwachsenen Hospizdienstes
Dunkelbunt, Katharina Sonnet.
Foto: Forum Dunkelbunt e.V.

Im Einsatz für ein sauberes Eving
SPD-Landtagsabgeordneter Volkan Baran packt mit an
Im Mai war der Dortmunder Landtagsabgeordnete Volkan Baran mit
Müllsack, Zange und Handschuhen in Eving unterwegs, um Müll einzusammeln, denn seit längerer Zeit erreichen ihn zahlreiche Beschwerden über die
Vermüllung an der Evinger Straße im Bereich des Biotops Winterkampweg.
Baran erläutert dazu: „Wegen der Beschwerden haben Bastian Prange von der EDG, Bezirksbürgermeister Oliver Stens und SPD-Bezirksvertreter Sebastian Kieninger bereits im April eine Ortsbegehung dort gemacht. Im Biotop selbst
haben wir hauptsächlich Sperr- und Industrieabfälle entdeckt, an der Straße vor allem Verpackungen von einem Fast Food-Restaurant, der nicht korrekt entsorgt
wurde und vom Wind verteilt wird.“
Aufgrund der geltenden Corona-Regeln waren
der Landtagsabgeordnete, seine Helferinnen und Helfer in Zweierteams
unterwegs, um den herumliegenden Müll einzusammeln. Doch Baran hat sich in
der Sache auch weitergehend eingesetzt:
„Ich habe den Verantwortlichen bei Burger King kontaktiert, um dort daraufhin
zu drängen, dass auf dem Gelände hinterlassener Müll von der Filiale selbst
beseitigt wird. Das wurde mir zugesagt und ich werde beobachten, ob man dort Wort hält.“
Bildzeile: Links Bastian Prange von der EDG und rechts SPD-Landtagsabgeordneter Volkan Baran
Foto: SPD Dortmund

BUNT IST BESSER – Die große Frühlingsinitiative in Westerfilde & Bodelschwingh
Gestalten, entdecken und gewinnen: Pünktlich zum Frühlingsanfang startete im Quartier Westerfilde & Bodelschwingh die große „Bunt ist besser“- Frühlingsinitiative. Neben einer spannenden digitalen Rallye durch die aufblühenden Stadtteile wartete der große „Frühlingsgärten“-Wettbewerb auf zahlreiche Teilnehmer*innen. Die Gewinner*innen stehen nun fest!
Die Sonne scheint und die Vögel singen – genau der richtige Zeitpunkt, um selber aktiv zu werden! Zum Auftakt der Aktion am 22. März verteilte das Quartiersmanagement Westerfilde & Bodelschwingh rund 200 Pflanzen, 1.000 Samentütchen und zahlreiche Bastelvorlagen im Stadtteil, um für die „Bunt ist besser“-Frühlingsinitiative zu werben und zum Mitmachen zu ermuntern.
Im Rahmen des „Frühlingsgärten“-Wettbewerbs waren alle Bewohner*innen des Stadtteils dazu aufgerufen, ihre Umgebung kreativ zu gestalten. Ob selbst gebastelte Dekorationen für die Fenster der Wohnung oder einem Arrangement aus Frühlingsblumen im Vorgarten oder auf dem Balkon – der Fantasie der Teilnehmenden waren dabei keine Grenzen gesetzt. Das ist nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch wertvoll für die Insektenwelt.
Viele Kinder in Kitas und Schulen haben mitgemacht und auch einige Privathaushalte. Fotos der schönsten Einsendungen wurden nach Ablauf des Aktionszeitsraumes am 11. April in den Schaufenstern des Quartiersbüros sowie des Nachbarschaftszentrums „NebenAn“ ausgestellt. Bis zum 30. April konnte abgestimmt werden, welche Frühlingsidee den Wettbewerb gewinnen sollte. Das Rennen machte dabei die Offene Ganztagsschule der Grundschule Bodelschwingh, dicht gefolgt von dem Falkentreff Westerfilde und der FABIDO Kindertagesstätte Wattenscheidskamp auf den Plätzen zwei und drei. Auf sie warteten tolle Preise wie ein Insektenhotel, Vogelnistkästen oder Futterhäuschen für Vögel oder Eichhörnchen.
Doch nicht nur das gestalterische Geschick war gefragt. Gerade im Frühling gibt es im Quartier viel zu entdecken! „Die große Frühlingsrallye“, die per App individuell und digital spielbar war, führte die Teilnehmer*innen quer durch den Stadtteil, wo an zahlreichen Stationen Aufgaben aller Art auf sie warteten. Auch hier konnten sich die Bestplatzierten über nützliche Gewinne für Garten oder Balkon freuen.
Die Aktion „BUNT IST BESSER – Die große Frühlings-Initiative in Westerfilde & Bodelschwingh“ wurde organisiert vom Quartiersmanagement Westerfilde & Bodelschwingh und war ein Projekt des Amtes für Stadterneuerung, finanziert mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Dortmund aus dem Programm „Soziale Stadt Westerfilde & Bodelschwingh“. Unterstützt wurde die Aktion von Vonovia.
Bildzeile: Auftaktaktion des Quartiersmanagements am Marktplatz Westerfilde, v. l. n. r.: Katrin Eilinghoff, Sabine Hirsch, Andrea Hirsch, Silke Freudenau
Foto: QM Westerfilde & Bodelschwingh

Schokolade zum Frühstück- Dortmunder Landtagsabgeordnete sagen „Danke“
Im Mai besuchten die Dortmunder SPD-Landtagsabgeordeten
Volkan Baran, Anja Butschkau und Nadja Lüders das Dortmunder Impfzentrum
auf PHOENIX West und übergaben dem ärtzlichen Leiter Reinhard Büker stellvertretend für sein Team 100 Tafeln Schokolade.
Die Drei erklärten dazu: „Seit der Eröffnung des Impfzentrums geben die
Helferinnen und Helfer, Ärztinnen und Ärzte hier jeden Tag alles für uns. Wir wollten uns deshalb bedanken. Ihr macht einen tollen Job!“
Foto: SPD Dortmund
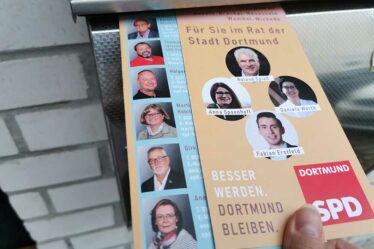
Start der SPD-Nachbarschaftskampagne – Trotz Pandemie ansprechbar
Über den Sommer ist es in den Stadtteilen im Stadtbezirk Brackel bereits gelebte Tradition, aktiv die Menschen zu ermuntern sich mit Problemen und Anregungen an die SPD zu wenden. Seien es Gullideckel, die eine Gefahr für Fahrradfahrende darstellen, Vermüllung von öffentlichen Flächen, nicht mehr erkennbare Fahrbahnmarkierungen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen, die SPD kommt vorbei, hört zu und kümmert sich, sofern es möglich ist. Ab Juni ist die SPD, sofern die Pandemie es zulässt, auch regelmäßig in den Ortsteilen direkt mit einer Anlaufstelle vertreten.
Die Menschen im Stadtbezirk Brackel können sich daher direkt bei den Ansprechpersonen melden und ihre Anregungen und Probleme mitteilen. Dies kann entweder telefonisch wie auch per E-Mail über die gewählten Vertreter*innen im Rat oder der Bezirksvertretung erfolgen oder per Mail an: nachbarschaft@spd-hellweg.de.
Darüberhinaus werden in den Haushalten auch wieder handverteilte Flyer in die Briefkästen flattern. Auch hier wird auf die Nachbarschaftskampagne hingewiesen und es stellen sich nach der Kommunalwahl die neugewählten Rats- und Bezirksvertretungsmitglieder der SPD im Stadtbezirk Brackel sowie die Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann vor.
Foto: SPD Stadtbezirk Brackel

Thomas Szabo ist neuer Präsident des Marketing Clubs Dortmund
Turnusgemäße Wahl bringt weitere Veränderungen des Vorstands
Die Mitglieder des Marketing Club (MC) Dortmund e. V.
wählten turnusgemäß einen neuen Vorstand. Thomas Szabo löst die nach vier Jahren
auf eigenen Wunsch aus dem Amt scheidende Sandra Heller als Präsident des
Netzwerks ab. In ihren Ämtern bestätigt wurden zudem Vizepräsident Jürgen Wallinda-
Zilla, Kommunikation und Ideenpreis, Hartmut Irmer, Mitgliedergewinnung und -betreuung, Caroline Pitzer, Sprecherin der Marketing Pioniere, sowie Kathrin Schickle-Berger, Geschäftsführender Vorstand.
Mit Lars Gröhnke und Ute Börner wurden zwei langjährige Mitglieder für die Vorstandsarbeit des Clubs gewonnen. Lars Gröhnke wird zukünftig für das Programm
zuständig sein, während Ute Börner das Ressort Finanzen übernimmt. Sie löst damit Elke Niermann ab, die sich viele Jahre im Vorstand des MC engagierte.
Der MC Dortmund ist ein führendes Marketing-Netzwerk in der Region Dortmund. Zu den über 300 Mitgliedern zählen Unternehmer, Geschäftsführer, Marketing- und
Vertriebsleiter, Produktmanager, Werbefachleute, Unternehmensberater, PRSpezialisten
und Wissenschaftler.
www.mc-dortmund.de
Bildzeile: Der neue Vorstand des MC Dortmund: Ute Börner, Hartmut Irmer, Thomas Szabo (neuer Präsident), Jürgen Wallinda-Zilla, Caroline Pitzer, Lars Gröhnke und Kathrin Schickle-Berger.
Foto: MCDO

Software für barrierefreien Zugang zu Webinhalten
Projekt „Easy Reading“ der TU Dortmund von Internationaler Fernmeldeunion ausgezeichnet
Die Software „Easy Reading“, die von einem Forschungsteam aus der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der TU Dortmund und acht internationalen Partnern entwickelt wurde, um Websites barrierefrei zugänglich zu machen, hat von der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen die Auszeichnung „Innovative digitale Lösung für ein barrierefreies Europa 2021“ erhalten.
Für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten sind digitale Inhalte im Internet häufig nicht barrierefrei zugänglich. Um das zu ändern, hat ein internationales Team, zu dem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Dortmund aus den Fachgebieten „Rehabilitationstechnologie“ und „Körperliche und Motorische Entwicklung in Rehabilitation und Pädagogik“ gehören, das Software-Framework „Easy Reading“ entwickelt. Das Projekt war 2018 gestartet und im Rahmen des EU-Programms Horizon 2020 mit zwei Millionen Euro gefördert worden. Nach zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit konnte das Tool dann im vergangenen Jahr der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Nun hat die Internationale Fernmeldeunion (ITU) das „Easy Reading“-Software-Framework im Wettbewerb „Innovative digitale Lösungen für ein barrierefreies Europa 2021“ als beste Lösung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ausgezeichnet. Das Projekt konnte sich damit im europäischen Wettbewerb gegen fast 100 konkurrierende Lösungen durchsetzen.
Prof. Christian Bühler und Dr. Susanne Dirks aus dem Fachgebiet Rehabilitationstechnologie der TU Dortmund zeigten sich begeistert über die Auszeichnung ihres Projekts. „Eine solche Anerkennung für unsere Bemühungen zu erhalten, motiviert uns sehr, weitere Forschungsprojekte in diesem Bereich voranzutreiben und damit noch mehr Menschen eine Chance zu geben, digitale Inhalte selbstständig zu nutzen“, sagt Prof. Bühler.
„Easy Reading“ überzeugte die internationale Jury besonders durch den innovativen und inklusiven Ansatz „Keeping the user at the digital original“. Dr. Susanne Dirks erklärt, was das bedeutet: „Mit unserer Anwendung können alle für die Barrierefreiheit notwendigen Anpassungen direkt auf den Original-Webseiten vorgenommen werden.“ Die Nutzerinnen und Nutzer bekommen so die Möglichkeit, die Darstellung jeder beliebigen Webseite in Echtzeit ganz nach ihren Bedürfnissen zu personalisieren. Die Unterstützungsfunktionen erlauben es beispielsweise, Layout und Struktur von Webseiten zu verändern. Auch ist es möglich, sich Webinhalte durch Symbole, Videos und Bilder erklären beziehungsweise den Text vereinfachen zu lassen. Realisiert werden diese Funktionen durch moderne Mensch-Computer-Interaktionstechniken wie Pop-ups, eingebettete Funktionen und Eye-Tracking.
Die ITU hat es sich als Sonderorganisation der Vereinten Nationen zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen weltweit die Nutzung des Internets als Informationsquelle zu ermöglichen. Im Zuge der Auszeichnung werden die ITU und ihre Partnerorganisationen das Projekt „Easy Reading“ daher bei der weiteren Entwicklung und bei der Verbreitung ideell unterstützen.
Weitere Informationen:
https://www.easyreading.eu/
Bildzeile: Dr. Susanne Dirks (unten rechts) präsentiert das „Easy Reading“-System und seine Einsatzmöglichkeiten auf der ICT4all-Konferenz der Internationalen Fernmeldeunion.
Foto: ITU

OB Thomas Westphal: Baustellenbesuch beim BaseCamp Dortmund
Seit 2019 wird an der Stelle des ehemaligen Karstadt-Technikhauses, das zuvor fast ein Jahrzehnt lang leer stand, fleißig gebaut. Nun nähern sich die Bauarbeiten ihrem Ende: Spätestens im Oktober 2021 soll das neue BaseCamp mit seinen 331 voll möblierten Studentenapartments und 118 Hotelzimmern eröffnen – pünktlich zum neuen Wintersemester. Auch die Nutzer der Gewerbeflächen im Erdgeschoss stehen bereits fest. Höhepunkt des von Gerber Architekten aus Dortmund entworfenen Sechsgeschossers ist die Dachterrasse mit Café, die künftig für Veranstaltungen, zum Co-Working oder für einen Drink geöffnet sein wird.
Die nahende Fertigstellung des BaseCamp Dortmund haben am 5. Mai Oberbürgermeister Thomas Westphal und Daniel Doherr, einer der beiden Geschäftsführer von BaseCamp Student, für einen Baustellenbesuch – natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen – genutzt. Oberbürgermeister Thomas Westphal: „Mit dem BaseCamp Dortmund zieht neues und urbanes Leben in die Innenstadt. Es ist ein Meilenstein für die City – aber vor allem auch für das Brückviertel. Dieses Projekt passt zu unserer Strategie der City-Entwicklung, bei der wir Innenstadtquartiere einzeln betrachten und entsprechend weiterentwickeln wollen. Das Basecamp wird die Besucherfrequenz erhöhen, das Quartier städtebaulich aufwerten und zu mehr Kaufkraft beitragen. Mit seinem gastronomischen Angebot wird es auch ein Publikumsmagnet für das Brückviertel – sobald Corona dies zulässt.“
Anfang Juni wird es bei einem Presserundgang durch das BaseCamp Dortmund weitere Informationen über die Planungen und einen Rundgang über die Baustelle geben. „Wir freuen uns schon sehr darauf, bei einem ersten Blick hinter die Kulissen unseren BaseCamps die ersten Zimmer und weitere Highlights unserer Planungen zu präsentieren“, freut sich Doherr.
BaseCamp ist erfahrener Betreiber und Entwickler von Campusanlagen für studentisches Leben und urbane Workspaces sowie für touristische Nutzungen an erstklassigen und dynamischen Wissenschaftsstandorten wie Kopenhagen, Lodz, Aachen, Göttingen, Potsdam, Leipzig, Berlin sowie in Kürze Dortmund. Innerhalb Europas hat BaseCamp seit 2014 rund 10.000 Betten entwickelt und geplant. Die Projekte von BaseCamp zeichnen sich durch eine hochwertige Architektur aus und wurden bereits mit internationalen Architekturpreisen ausgezeichnet. Die multinationalen Teams mit über 100 Mitarbeitern sind in Berlin, Kopenhagen, London, Luxemburg und Warschau ansässig. Schwerpunkt ist die Bildung von Campusanlagen mit modern gestalteten, öffentlichen Räumen, in denen urbanes und studentisches Leben stattfinden kann.
http://www.basecampstudent.com/
Bildzeile: Rundgang „Basecamp Dortmund“ mit OB Thomas Westphal (l.) und Daniel Doherr.
Foto: Roland Gorecki

Wasserpat*innen gesucht
Zur Betreuung der Wasserspielanlagen werden für die Sommermonate zuverlässige Helfer*innen gesucht.
Die städtischen Wasserspielanlagen laufen in der Zeit vom 1. Juni -15. September eines Jahres. Bei einigen Anlagen muss das Wasser morgens angestellt und abends abgestellt werden. Außerdem muss überprüft werden, ob die Becken sauber sind, so dass die Kinder ohne Verletzungsgefahr planschen können.
Nur mit ehrenamtlichem Einsatz ist der Betrieb möglich. Für die Übernahme der Tätigkeiten wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.
Aktuell werden für die Wasserspielanlage „Große Heimstraße“ Innenstadt West und für die Anlage an der „Düsterstraße“ Körne, Wasserpat*innen gesucht.
Auskunft erteilt das Jugendamt, Büro für Kinder- und Jugendinteressen, Kathrin Koch unter: 0231/ 5023742 oder kkoch@stadtdo.de
Bildzeile: Wasserspielanlage auf dem Kinderspielplatz Heroldwiese.
Foto: Stadt Dortmund

680 neue Wohnungen für das Dortmunder Kronprinzenviertel
DOKOM21 erschließt neues Stadtquartier mit hochmodernen Glasfaseranschlüssen
Insgesamt rund 680 neue Wohnungen sollen im Zentrum von Dortmund bei der Entwicklung des Kronprinzenviertels in den nächsten Jahren entstehen. Der regionale Telekommunikationsdienstleister DOKOM21 wird das neue Stadtquartier mit hochmodernen Glasfaseranschlüssen erschließen.
„DOKOM21 wird alle im Kronprinzenviertel entstehenden Häuser mit zukunftssicheren Glasfaseranschlüssen und den damit verbundenen Diensten versorgen. Damit profitieren die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Stadtquartiers von ultraschnellem und stabilem Internet, Kabel-TV, Multimedia-Diensten und Telefonie in bester Qualität“, erklärt Carsten Radziej, DOKOM21 Vertrieb.
Modernste Variante der Glasfaserversorgung
„Wir bieten in diesem Baugebiet mit der FTTH-Lösung (Fibre To The Home) die modernste Variante der Glasfaserversorgung an. Nach diesem Konzept werden einzelne Glasfasern bis in die Wohnungen verlegt“, so Radziej.
Die rund 680 neuen Wohneinheiten entstehen unter Regie des Bauträgers beta Eigenheim GmbH aus Bergkamen. „Dabei werden wir 118 Wohneinheiten aus dem frei finanzierten Mehrfamilienhaussegment und 124 Wohneinheiten aus dem öffentlich geförderten Mehrfamilienhaussegment schlüsselfertig errichten und an VIVAWEST übergeben“, informiert Dirk Salewski, Geschäftsführer beta Eigenheim.
„Aufgrund der fachlichen Kompetenz und der Erfahrung von DOKOM21 im Glasfaserausbau haben wir uns Rahmen des Bauprojektes Kronprinzenviertel für die Zusammenarbeit mit dem Telekommunikationsdienstleister aus Dortmund entschieden“, sagt der Geschäftsführer. „Wir haben bei DOKOM21 einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort für alle Belange. Diese direkten Kontakt- und Entscheidungswege erleichtern unsere Arbeit in diesem komplexen Bauprojekt.“
Neues Stadtquartier auf Areal des ehemaligen Güterbahnhofs
beta Eigenheim kaufte das rund 105.000 Quadratmeter große Grundstück des ehemaligen Güterbahnhofs Dortmund-Süd Ende 2014 vom Immobilienunternehmen Aurelis. Auf diesem Gelände entlang der Kronprinzenstraße wird in den nächsten Jahren ein neues Stadtquartier entstehen. „Das Kronprinzenviertel in direkter Nachbarschaft der Kaiserstraße soll ein neues Quartier für alle Generationen werden. Durch unterschiedliche Wohntypen und flexible Ausstattung bietet beta Eigenheim Raum für Individualität“, so Dirk Salewski.
Rund 150 Wohnungen sollen im Rahmen des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus entstehen. Eine transparente Lärmschutzwand wird die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Kronprinzenviertels vor Lärmemissionen des Großmarkts schützen.
Aktuellen stehen die Kanalbauarbeiten im Kronprinzenviertel im Mittelpunkt. Mit fast drei Meter Durchmesser hat der Stauraumkanal beeindruckende Maße. Der Kanal zieht sich über einer Länge von mehr als 180 Metern durch das neue Baugebiet. Im April 2021 haben die Hochbauarbeiten am sogenannten Lindenhof I begonnen. Alle sechs Wochen, so die ehrgeizige Bauzeitenplanung, sollen die Hochbauarbeiten an einem neuen, der insgesamt acht Gebäude starten. „Die acht Gebäudeteile werden auf insgesamt drei Tiefgaragen errichtet“, erläutert beta-Bauleiter Dirk Schnaube. Bis zur Fertigstellung des gesamten Quartiers rechnet beta Eigenheim mit einer Bauzeit von rund fünf Jahren.
www.kronprinzenviertel.de
Info Glasfaser: Datenübertragung in Lichtgeschwindigkeit
Glasfaser ist aktuell die technisch leistungsfähigste Telekommunikationsanbindung. Sie bietet im Gegensatz zu Kupfer unbegrenzte Bandbreiten bis zu n mal 10 Gbit/s und zeichnet sich durch hohe und stabile Übertragungsraten aus. Eine Anbindung an das DOKOM21 Glasfasernetz ermöglicht Datenübertragung in Lichtgeschwindigkeit. Zudem gilt Glasfaser als zukunftssicher.
www.dokom21.de/glasfaser
Bildzeile: Über die Erschließung des Kronprinzenviertels mit hochmodernen Glasfaseranschlüssen freuen sich Dirk Salewski (li.), Geschäftsführer beta Eigenheim, und Carsten Radziej, DOKOM21 Vertrieb. In dem neuen Stadtquartier entlang der Kronprinzenstraße sollen auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Dortmund-Süd in den nächsten Jahren insgesamt rund 680 neue Wohnungen entstehen.
Foto: Roland Kentrup

20 Jahre Treue! Eine starke Leistung! Wir sagen DANKE!
Im Mai feierte die Firma Bönninger GmbH & Co. KG das zweite 20 jährige Jubiläum in diesem Jahr. Herr Peter Anders steigt bereits seit 2001 für den Familienbetrieb in die Lüfte und montiert zuverlässig und sicher die Gerüste.
Herr Anders ist einer der am längsten Angestellten der Bönninger GmbH & Co. KG. Er hat den gesamten Wachstum des Betriebes miterlebt und durch seine Hingabe und Zuverlässigkeit einen großen Teil dazu beigetragen.
Dafür möchte sich der Betrieb herzlich bedanken!
Foto: Gerüstbau Bönninger GmbH & Co. KG
Leider kann der Anlass nicht gebührend gefeiert werden. Dennoch lassen es sich die Geschäftsführer nicht nehmen, Herrn Anders in sicherem Abstand ihren persönlichen Dank auszusprechen und eine Geste der Dankbarkeit zu überreichen.
Eine solche Betriebstreue ist etwas ganz außergewöhnliches. Die Bönninger GmbH & Co. KG fühlt sich geehrt, solch treue Mitarbeiter in Ihrem Team zu haben und sagt DANKE! an Herrn Peter Anders.

Glückwünsche zum 30. Dienstjubiläum
für Hauptgeschäftsführer Susewind
59-jähriger Jurist begann seine Karriere am 1. Mai 1991 / Kreishandwerksmeister und Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen und des Bildungskreises Handwerk e.V. gratulieren Corona-bedingt im kleinen Kreis
Das Jubiläum fiel auf einen Feiertag – gefeiert werden konnte allerdings Corona-bedingt nicht: Assessor Joachim Susewind, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen konnte am 1. Mai auf 30 Dienstjahre zurückblicken. Anlässlich des Jubiläums gratulierten am Montag Vorstand und Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und des Bildungskreises Handwerk e.V. sehr herzlich.
Kreishandwerksmeister Dipl.-Ing. Christian Sprenger dankte in einer kurzen persönlichen Ansprache dem Jubilar, der seit sechs Jahren die Verwaltung der Handwerksorganisation leitet, verbunden mit den besten Wünschen für die berufliche und private Zukunft.
Seit 1991 im Dienst des Handwerks
Joachim Susewind wurde 1961 im sauerländischen Eversberg, einem Stadtteil von Meschede, geboren, wo er auch heute noch mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern lebt. Nach dem Jurastudium in Münster und einem Rechtsreferendariat am Landgericht Arnsberg, zog es den 29-jährigen Volljuristen 1991 nach Dortmund. Hier trat er als Assessor seine erste Stelle in der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen an und übernahm zunächst die Leitung der Rechtsabteilung. Bereits vier Jahre später wurde er zusätzlich mit der Geschäftsführung mehrerer Innungen betraut: der Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen, der Maler- und Lackierer-Innung Dortmund und Lünen, der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen und der Tischler-Innung Dortmund und Lünen. Nachdem er 19 Jahre lang umfangreiche Erfahrungen als Innungsgeschäftsführer sammeln konnte, übernahm er zum 1. Januar 2014 die Position eines Geschäftsführers der Kreishandwerkerschaft. Mit der Wahl zum Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft stieg er dann am 1. Februar 2015 an die Spitze der Geschäftsführung auf.
Bildzeile:Glückwunsch zum Jubiläum (v.l.) Geschäftsführer Ludgerus Niklas, Kreishandwerksmeister Christian Sprenger, Jubilar und Hauptgeschäftsführer Joachim Susewind und Geschäftsführer Volker Walters.
Foto: Kreishandwerkerschaft

Intensivpfleger rettet auch privat Leben
„Der genetische Zwilling“: Mitarbeiter des Klinikums
Dortmund leistet Stammzellen-Spende
Als er sich vor vier Jahren registrierte, hatte er kaum mit einer Antwort gerechnet:
Matthäus Atzert, ausgebildeter Fachgesundheits- und Krankenpfleger
für Intensivpflege und Anästhesie, hat vor kurzem zum ersten Mal
Stammzellen für einen Leukämie-Patienten gespendet. Gemeldet hatte er
sich bei der DKMS (Deutschen Knochenmarksspenderdatei) bereits im Jahr
2017. „Es dauert teilweise sehr lange, bis die DKMS einen passenden
Spender findet“, sagt der 35-Jährige, der auf der neurologischen Intensivstation A12i im Klinikum Dortmund arbeitet. „Gerade in Pandemie-Zeiten
verschwinden solche Themen leider aus dem öffentlichen Fokus, obwohl natürlich nach wie vor viele Menschen an Blutkrebs erkranken. Umso wichtiger ist es, genau jetzt darauf aufmerksam zu machen“, so Atzert.
„Du rettest im Krankenhaus doch jeden Tag Leben“, habe ein Freund zu ihm gesagt,
als er diesem erzählte, dass er als passender Spender ausgewählt wurde.
Die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr hoch: Damit eine solche Spende erfolgreich abläuft, müssen Patient*in und Spender*in möglichst identische Gewebemerkmale
aufweisen, quasi „genetische Zwillinge“ sein. Andernfalls können so genannte „Abstoßungsreaktionen“ auftreten, bei denen die neu transplantierten
Stammzellen den Körper als fremd erkennen und bekämpfen. „Die Frage, ob ich das wirklich machen werde, hat sich daher für mich gar nicht erst gestellt“, so
Atzert. „Für mich bedeutet das einen kleinen Aufwand, für den Erkrankten hingegen
ist es eine riesige Chance.“
Stammzellen sind im Körper für den Blutbildungsprozess zuständig. Gesunde,
transplantierte Zellen übernehmen diese Funktion bereits nach wenigen Wochen. Fünf Tage vor dem Spendetermin hat Atzert zwei Mal täglich ein Medikament erhalten, das die Anzahl seiner Stammzellen im Blut steigert. „Da können natürlich Nebenwirkungen auftreten“, erklärt Atzert. „Bei mir waren es Müdigkeit und
Rückenschmerzen. Das war aber auf jeden Fall auszuhalten. Und ich würde es jederzeit nochmal machen.“ Dreieinhalb Stunden habe die Spende gedauert –
und danach habe er erstmal genauso lange geschlafen. Die Kosten für Hotel, Fahrt und Gehaltsausfälle hat die DKMS für ihn übernommen.
Zwei Jahre lang ist er nun als Spender für diese eine betroffene Person blockiert, für die er bereits gespendet hat. „Es sein kann, dass die- oder derjenige erneut
eine Stammzellen-Spende benötigt“, erklärt Atzert. Wenn beide Seiten zustimmen, wäre nach dieser Zeit sogar eine Kontaktaufnahme zwischen Spender*in
und Empfänger*in möglich. Eine anonyme Korrespondenz ist auf Wunsch bereits vorher machbar. Laut der DKMS erkrankt weltweit alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs. Nur
ein Drittel der Patient*innen hat innerhalb der Familie geeignete Spender*innen.
In Deutschland findet jede*r Zehnte keine*n passende*n Spender*in. Dabei ist die
Registrierung simpel: Jeder gesunde erwachsene Mensch bis 55 Jahren kann sich mit geringem Aufwand bei der DKMS oder einer anderen Datei zur potentiellen Spende melden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.dkms.de.
Foto: Intensivpfleger Matthäus Atzert hat Stammzellen für einen Leukämie-Patienten gespendet.
Foto: Klinikum Dortmund

Neue Trinkwasseranbindung für Mengede
DEW21, DONETZ und WWW stellen Versorgung zukunftsfähig auf
Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) hat gemeinsam mit der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) und der Wasserwerke Westfalen GmbH (WWW) eine neue Anbindungsleitung zur Trinkwasserversorgung von Mengede in Betrieb genommen.
Nach fünfmonatiger Bauphase gab der Technische Geschäftsführer von DEW21, Peter Flosbach, gemeinsam mit DONETZ-Geschäftsführer René Kattein und WWW-Geschäftsführer Bernd Heinz offiziell den Betrieb der neuen Trinkwasserverbindung frei. Damit erhält der Dortmunder Stadtteil Mengede nun das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Witten.
In den vergangenen drei Trockenjahren wurde deutlich: Der Klimawandel erhöht die Anforderungen in den Wasserwerken an der Ruhr durch einen teilweise höheren Spitzenbedarf in den Sommermonaten teils auch über längere Zeiträume hinweg. „Mit der Versorgung aus dem leistungsstärksten WWW-Werk in Witten und Zugang zum südlichen Talsperrensystem des Ruhrverbands (u.a. Biggesee) haben wir auf mehr Trinkwasserquellen Zugriff und zugleich eine höhere Flexibilität in der Versorgung des Dortmunder Netzes“, erläutert DEW21-Geschäftsführer Peter Flosbach.
„Auch ökologisch ist die Versorgung aus Witten sinnvoll, da künftig weniger Pumpstrom benötigt wird, um das Wasser in die Haushalte zu bringen,“ ergänzt Bernd Heinz. „Für die Mengeder entstehen dabei keine Veränderungen hinsichtlich der Wasserqualität, sie werden weiterhin zuverlässig mit einwandfreiem Trinkwasser versorgt. Und das unter dem Motto „Doppelt hält besser“. René Kattein erklärt die Wichtigkeit der neuen Verbindung und die so gegebene erhöhte Versorgungssicherheit: „Rund 1,8 Mio. m³ Wasser fließen jährlich durch die neue Trinkwasserleitung. Im Bedarfsfall kann kurzfristig zurück auf das Schwerter Werk umgeschaltet werden, von dem Mengede zuvor beliefert wurde.“
Die neue Anbindungsleitung mit einem Innendurchmesser von 300 mm wurde ressourcenschonend in eine stillgelegte Leitung vom ehemaligen Kraftwerk Knepper eingezogen. Dadurch waren im benachbarten Naturschutzgebiet nur minimale Baueingriffe erforderlich.
Bildzeile: Peter Flosbach (Technischer Geschäftsführer DEW21), Bernd Heinz (Geschäftsführer WWW) und René Kattein (Geschäftsführer DONETZ).
Foto: DEW21

NEU: E-Commerce-Abitur an der WIHOGA Dortmund
Das Thema „E-Commerce“ ist in aller Munde. Die derzeitige Covid-19-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal massiv beschleunigt. Experten gehen davon aus, dass sich das Konsumverhalten nachhaltig verändert und sich weiter hin zum Onlineshopping verlagert.
An den Wirtschaftsschulen für Hotellerie, Gastronomie, Handel und Dienstleistungen (WIHOGA) Dortmund hat man die Zeichen der Zeit erkannt und bietet – unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg – schon ab dem kommenden Schuljahr im Wirtschaftsgymnasium die neue Differenzierung „E-Commerce“ an.
Inzwischen sind Kenntnisse im E-Commerce nicht mehr nur im Einzelhandel (Mode, Lebensmittel, Drogeriebedarf, Medikamente) von Bedeutung. Immer mehr Start-ups bieten alle Spielarten von Dienstleistungen online an, u.a. Lieferdienste im Food- und Gastrobereich und bei Buchungen rund um Reisen sowie Flug-, Bahn- und Bustickets sowie Mietwagen Event-Tickets für Sport, Konzerte, Theater und Kino etc. Ursprünglich stationäre Geschäftsmodelle werden digitalisiert, indem ihr Business radikal von den Bedürfnissen der Kunden neu gedacht wird.
Diese datengetriebene Herangehensweise stellt traditionelle Handels- und Gastrounternehmen vielfach vor große Herausforderungen. Dabei sind mehr und mehr innovative Quereinsteiger erfolgreich unterwegs, die ihrerseits zur Umsetzung nicht nur IT-Profis, sondern auch kaufmännische Angestellte benötigen, die solide Grundlagen des E-Commerce beherrschen.
E-Commerce-Abitur schafft Perspektiven
Bei der Generation Z sieht der Schulleiter Harald Becker für das neue „E-Commerce-Abitur“ viel Potenzial. „Es wird für zukünftige kaufmännische Auszubildende sowie BWL- und Marketing-Studierende immer wichtiger zu wissen, wie digitale Geschäftsmodelle aussehen und wie E-Commerce erfolgreich funktioniert“, erläutert der Diplom-Kaufmann und Oberstudiendirektor. Dafür möchte die WIHOGA am Rombergpark in Dortmund ihren Schülerinnen und Schülern schon auf dem Weg zum Abitur hervorragende Grundlagen und Inspiration vermitteln.
Ethische, gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Aspekte wie z.B. Folgen der zunehmenden Verödung der Innenstädte sowie Nachhaltigkeitsaspekte, die intelligente Verknüpfung von stationären mit digitalen Geschäftsmodellen uvm. stehen ebenso auf dem Stundenplan wie der Aufbau eines eigenen Webshops.
Aufruf an heimische IT-Unternehmen
Attraktiv sind dabei nicht nur die Studien- und Berufsaussichten. „Auch die drei Jahre bis zum Abitur sind bereits hochspannend“, verspricht Harald Becker. So werden im Rahmen der Speziellen Betriebswirtschaftslehre zahlreiche Gastreferenten eingeladen, um Informationen zu vermitteln.
Eine wichtige Rolle spielt außerdem das zweiwöchige, betreute Betriebspraktikum in der Q1. Das Praktikum wurde bewusst vor den Herbstferien positioniert, sodass es zeitlich bis auf maximal vier Wochen ausgedehnt werden kann.
„Wir freuen uns dabei auf die Unterstützung und Kooperation der vielen heimischen Unternehmen, die auf dem Gebiet des E-Commerce tätig und erfolgreich sind“, schiebt der Schulleiter nach, bei dem sich interessierte Unternehmensvertreter jederzeit melden können.
Mit eigenem Webshop zum Abitur
Die Schülerinnen und Schüler, deren Leistungskurse Betriebswirtschaftslehre und Englisch festgelegt sind, sollen während der gymnasialen Oberstufe jeweils ihren eigenen Webshop planen, erstellen, betreiben und auswerten.
Zusätzlich attraktiv: Ebenso wie bei den Varianten des Wirtschaftsgymnasiums für „Hospitality Business“ und für „Mode- und Luxusmanagement“ wird auch der Unterricht der neuen Differenzierung „E-Commerce“ durch moderne digitale Strukturen geprägt sein. Die Schülerinnen und Schüler erhalten bereits ab dem Schuljahr 2018/19 jeweils die jüngste Version des iPad mit Pencil und Tastatur-Cover, das sie in der Schule und zu Hause nutzen können. Die WIHOGA Dortmund und deren Lehrkräfte kommen durch den kompetenten Einsatz von TEAMS und OneNote sowie weiterer digitaler Tools hervorragend durch den Pandemie bedingten Wechsel zwischen Präsenz-, Hybrid- und Distanzunterricht.
„Eine sehr vielfältige Schulausbildung, die die Eingangstür für eine berufliche Zukunft in allen Branchen weit öffnet“, ist Harald Becker fest überzeugt.
Ab sofort werden Anmeldungen angenommen unter
www.wihoga.de/wirtschaftsgymnasium
Bildzeile: Auf dem modernen Campus der WIHOGA erstellen die Oberstufenschüler und -schülerinnen in der neuen Differenzierung „E-Commerce“ ihren eigenen Webshop.
Foto: Wihoga Dortmund

Nahwärmekonzept für den Zoo nimmt erste Förderhürde
DEW21-Konzept. Klimaneutral bis 2030
Der Dortmunder Zoo hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt – das Erreichen der Klimaneutralität bis 2030. Dazu hat er sich über das Ökozentrum Hamm mit der Frage an die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) gewandt, wie die verschiedenen Gebäude nachhaltig mit Wärme versorgt werden können. Die Energie-Expert*innen von DEW21 haben hierfür schnell ein innovatives Konzept entwickelt. Die Idee: ein kaltes Nahwärmenetz, das niedrige Ausgangstemperaturen nutzt, wodurch die Wärmeverluste über das Netz minimiert werden können. Hierdurch können, sogar im Umfeld des Zoos, regenerative Energiequellen erschlossen werden, die zusätzlich auch das angrenzende Berufsförderungswerk, die Pflanzenschauhäuser des Rombergparks und möglicherweise auch ein sich derzeit in Planung befindliches Rehazentrum der Johannis-Stiftung versorgen können.
Die gemeinsam mit dem Arnsberger Ingenieurbüro Schmidt und Willmes durchgeführten eingehenden Prüfungen ergaben, dass mithilfe geothermischer Bohrungen und Solarkollektoren genügend thermische Energie bereitgestellt werden kann. Dezentrale Wärmepumpen in den einzelnen Gebäuden sollen dann in diesem Konzept die Aufgabe übernehmen, die unterschiedlichen Wärmebedarfe der Gebäude von der Verwaltung bis zum Tropenhaus zu gewährleisten.
Das Wärmekonzept umfasst die nachhaltige Wärmeerzeugung direkt auf dem Gelände und die Weiterverteilung über ein Netz an die Wärmepumpen in den einzelnen Gebäuden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen des Förderprogramms „Wärmenetzsysteme 4.0“ solche innovativen Netze. „Mit der Zusage der finanziellen Unterstützung hat jetzt unser Konzept erfolgreich die erste Hürde genommen,“ freut sich Heike Heim, Vorsitzende der DEW21-Geschäftsführung, „damit haben die Geldgeber*innen bestätigt, dass die Umsetzung grundsätzlich förderungsfähig ist. Als nachhaltiger Lebensversorger freuen wir uns, die Stadt Dortmund bei den Klimazielen mit modernen Lösungen zu unterstützen.“
„Klima, Artenschutz und die Vielfalt der Natur zu wahren, das ist moderner Zoobetrieb in unserer Zeit“, ergänzt Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal. „Ich freue mich, dass unser Zoo alle diese Themen mit großem Engagement vorantreibt. Nun rückt die Klimaneutralität auch noch ein Stück näher. So kann es weitergehen.“
Jetzt stehen die Projektpartner vor der Herausforderung, auf Basis der Erkenntnisse der Prüfungen ein Realisierungskonzept aufzustellen. Eine Arbeit, die sich lohnt, denn für den Bau des Wärmenetzes stellt das BAFA eine Unterstützung von 38 Prozent in Aussicht.
Bildzeile: Die Vorsitzende der DEW21-Geschäftsführung Heike Heim und Dortmunds OB Thomas Westphal bei der Vorstellung des Konzepts im Dortmunder Zoo.
Foto: DEW21

Neuauflage des Corona-Malbuchs der FH Dortmund
Kinderbuch zur Pandemie-Aufklärung in südafrikanischer Stammessprache stark gefragt
Die ersten knapp 1000 Exemplare des Corona-Malbuchs waren schneller vergriffen als gedacht. Mit dem Entwicklungshilfeverein „Don Bosco“ des FH-Sozialwissenschaftlers Michael Boecker wird nun der Nachdruck finanziert. Das Ziel: Kindern in südafrikanischen Armenvierteln spielerisch und in Stammessprache Hygieneregeln für den Kampf gegen Corona und andere Krankheiten näher zu bringen.
„Es ist das erste Buch über COVID-19 für Kinder in der Stammessprache isiZulu und das öffentliche Interesse ist groß“, berichtet Dr. Maud Mthembu von der University of Kwa Zulu-Natal. Mehr als 17 nationale Zeitungen von Johannesburg bis Kapstadt haben über das Kooperationsprojekt der FH Dortmund mit der University of Kwa Zulu-Natal und Nichtregierungsorganisationen (NGO) vor Ort berichtet. „Mit der großen Nachfrage haben wir so gar nicht gerechnet”, berichtet Prof. Dr. Michael Boecker, Sozialwissenschaftler an der FH Dortmund. Mit seinem Entwicklungshilfeverein „Don Bosco“ stellt er 2.500 Euro für die nächste Auflage zur Verfügung. Auch die University of Kwa Zulu-Natal beteiligt sich an der Finanzierung.
Die Idee zu dem Bilder- bzw. Ausmalbuch für Sechs- bis Zwölfjährige ist in der Beratungspraxis entstanden, denn durch die Pandemie sei es zunehmend schwieriger geworden, die Kinder in den Vororten zu erreichen, berichtet Michael Boecker von den Erfahrungen der Kooperationspartner. Der FH-Professor forscht seit 2019 gemeinsam mit südafrikanischen Hochschulen an Fragestellungen im Kontext von Globalisierungsfolgen. „Das Malbuch orientiert sich an der Lebensrealität der Betroffenen“, sagt er. „Die realen Erlebnisse von Kindern in der Pandemie und auch mit dem Leid durch die Pandemie bilden die Grundlage für die Geschichten in dem Buch“, ergänzt Maud Mthembu. Dass es zu dem Malbuch auch ein paar passende Stifte gibt, komme bei den Kindern besonders gut an. Die zweite Auflage wird jetzt, wo das Buch sich herumgesprochen hat, sicher ebenso schnell vergriffen sein. Die Malbücher werden kostenfrei verteilt.
Bildzeile: Kooperationspartner in Südafrika haben das Corona-Malbuch auch zu den Familien auf die Dörfer gebracht.
Foto: FH Dortmund

REVITALIS und DERECO verkaufen 365 behome-Mikroapartments im Dortmunder Kreuzviertel an Catella
Der Hamburger Investor und Projektentwickler REVITALIS REAL ESTATE AG hat zusammen mit seinem Joint-Venture Partner, dem Kölner Multi Family Office DERECO, 365 Mikroapartments der REVITALIS-Eigenmarke behome an den von Catella Residential Investment Management GmbH gemanagten Immobilienspezialfonds Catella Wohnen Europa (CWE) veräußert. Der Fonds investiert in ein europäisches Wohnimmobilienportfolio der Risikokategorie Core.
Direkt neben der BVB-Zentrale an der Wittekindstraße/ Rheinlanddamm hat die REVITALIS auf dem zuvor als Parkfläche genutzten und rund 4.000 m² großen Grundstück 365 voll möblierte Mikroapartments mit rund 10.400 m² Wohnfläche sowie 73 Tiefgaragenstellplätze realisiert. Die Fertigstellung erfolgte im Juli 2020. Die behome-Apartments mit Wohnflächen von 22 bis 49 m² liegen im bekannten Dortmunder Kreuzviertel in direkter Nachbarschaft zur Fachhochschule Dortmund, dem Messegelände, dem Westfalenstadion und unweit des Westfalenparks.
Andreas Lipp, Vorstand der REVITALIS REAL ESTATE AG: „Unsere Mikro-Living-Marke behome steht für modernes und flexibles Wohnen auf kompaktem Raum. Diese Asset-Klasse wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen und von Investoren noch stärker nachgefragt werden. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unserem Partner Catella, dessen Portfolios hinsichtlich geografischer Verbreitung und Vielfalt marktführend in Europa sind. Der Ankauf der Dortmunder behome-Apartments durch Catella bestätigt uns, eine passgenaue und attraktive Immobilie realisiert zu haben.“
„Der Fonds Catella Wohnen Europa investiert sowohl in bestehende als auch in aufstrebende Segmente des Wohnungsmarktes, darunter die neue Wohnform Mikro-Living. Das von der REVITALIS entwickelte behome-Konzept mit voll möblierten Mikroapartments ergänzt unser Portfolio und unsere Anlagestrategie ideal. Die Apartments sind hochwertig ausgestattet und liegen sehr zentral im Dortmunder Kreuzviertel. Auch die Verkehrsanbindung ist optimal“, so Michael Keune, Managing Director der Catella Residential Investment Management.
Seitens der REVITALIS REAL ESTATE AG wurde die Transaktion von der Kanzlei Hogan Lovells International LLP Düsseldorf begleitet. Catella Residential Investment Management GmbH wurde von REIUS Rechtsanwälte Hamburg juristisch vertreten.
Neben den 365 Apartments hat die REVITALIS 222 Wohnungen an der Berswordtstraße/ Lindemannstraße realisiert, die bereits im April 2018 an einen regionalen Bestandshalter veräußert und Ende 2020 fertiggestellt wurden. Mit 587 Wohneinheiten gehört das urbane Quartier zu den größten Einzelprojekten im Neubau in Dortmund.
Foto: Revitalis Real Estate AG

DOGEWO21: Dogibär besuchte Spielplätze in den Quartieren
Die aktuelle Situation ist vor allem für Kinder oft nicht einfach. Um einigen von Ihnen eine kleine Freude nach dem Homeschooling zu machen, hat der Dogibär im April Spielplätze in DOGEWO21-Quartieren besucht und die dort spielenden Kinder überrascht. Im Gepäck hatte er Gummibärchen, Seifenblasen, Ballons, Pixi- und Malbücher.
Die Kinder haben sich sehr über diese Überraschung gefreut und den Besuch genossen.
Es wurden Spielplätze in Löttringhausen, Hörde, Scharnhorst und Mengede besucht.
Bildzeile: Der Dogibär besucht Spielplätze in DOGEWO21-Quartieren.
Foto: Dogewo21

Nur keine Hemmungen: Wer auf der Plauderbank sitzt, will sich unterhalten
Wochenlang standen sie zusammengeklappt in den Begegnungsstätten, jetzt darf auf ihnen Platz genommen werden: Die blau gestrichenen Plauderbänke sollen es den Dortmunder*innen leicht machen, nach den kontaktarmen Monaten wieder ins Gespräch zu kommen. Das verbandsübergreifende Projekt Begegnung VorOrt lädt ab dem 1.06.2021 in vielen Stadtteilen zu ersten Plauderstündchen ein – selbstverständlich unter freiem Himmel.
Wer auf einer Plauderbank Platz nimmt, signalisiert damit: „Ich will mich unterhalten“, und macht es damit anderen leicht, sich dazu zu setzen. In einigen Städten im In- und Ausland wurde diese Idee schon vor Jahren umgesetzt und kam gut an. Für das von der Stadt Dortmund geförderte Projekt Begegnung VorOrt, hatte Silke Freudenau von der Diakonie den Gedanken nach Dortmund gebracht. Ihre Kolleg*innen von der AWO und der Caritas, vom DRK und dem Paritätischen – alle fünf Verbände stehen für Begegnung VorOrt – waren gleich begeistert davon und bekamen prompt Unterstützung von ihren jeweiligen Verbänden.
Bierzelt-Garnituren – jeweils zwei Bänke und ein Tisch – wurden bestellt, die Farben bestimmt und in Eigenarbeit oder in eigener Werkstatt wie bei der AWO bzw. der dobeq lackiert und beschriftet. Damit die Möbel im Grünen gleich auffallen, sind sie in einem besonderen Blau gestrichen, der Schriftzug „Plauderbank“ in Orange lässt keinen Zweifel daran, welchen Zweck sie haben.
Jetzt, da die Kontaktbeschränkungen für Begegnungen im Freien gelockert sind, kommen die Bänke zum Einsatz. Der Vorteil dieser Sitzgelegenheiten: Sie lassen sich in der Handhabung leicht an die verschiedenen Beschränkungen oder Lockerungen anpassen und ermöglichen bei den verschiedenen Inzidenzen immer einen Corona konformen Einsatz. Sie sind tragbar, können somit überall da aufgestellt werden – und das mit dem nötigen Abstand -, wo sich Menschen begegnen und ins Gespräch kommen möchten. Um bei den Passant*innen erst gar keine Scheu vor dem Platz nehmen aufkommen zu lassen, sitzen bei den ersten Terminen die Frauen und Männer des Projekts Begegnung VorOrt bereits auf den Bänken und freuen sich über jede*n, der sich zu ihnen gesellt. In allen zwölf Dortmunder Stadtbezirken werden die blauen Bänke in der nächsten Zeit immer häufiger zu sehen sein – auch abhängig davon, wieviel Kontakt erlaubt ist.
Die Mitarbeiter*innen der Verbände haben schon jede Menge Ideen, wie sie die Plauderbänke und ihren Nutzen bekannt machen wollen. Sie möchten zu Beginn Menschen aus der Nachbarschaft zum Gespräch einladen, Sprechstunden im Grünen mit Bezirksbürgermeister*innen und Vereinsvorsitzenden organisieren, Initiativen und alle zu Wort kommen lassen, die etwas zu sagen haben. Die klappbaren Bänke dürfen auch gerne von Kirchengemeinden und Sportvereinen, Bürgertreffs und Ortsvereinen ausliehen werden: Da sie mobil sind, können Bänke und Tische an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden.
Und klappt dieses alles so, wie gewünscht, ist das nächste Ziel, feststehende Bänke in den Stadtteilen zu Plauderbänken zu küren. So sollen Menschen aller Generationen unverbindlich in Kontakt kommen können, ohne sich zu sorgen, ob die Banknachbar*in denn nun reden möchte oder nicht. Denn wer auf einer Plauderbank Platz nimmt, tut kund: Ich will mich nett unterhalten.
Ansprechpartnerinnen in Sachen Plauderbank sind Birgit de Boer für Innenstadt West, Telefon 0160 557 43 41; Evelin Büdel für Hombruch, Telefon 0160 527 64 76; Katarina Larrá für Eving, Telefon 0160 580 25 35 und Susanne Schulte für Scharnhorst, Telefon 0160 557 37 02, Regina Böckelmann für Hörde, Telefon 0231 567728-22, Benedikt Gillich für Huckarde, Telefon 0152 5340 5428, Viola Dressler für Aplerbeck, Telefon 0173-1857911, Hendryk von Busse für Innenstadt-Ost, Telefon 0172 8300 477, Silke Freudenau für Mengede, Telefon 0173 69 75 378, Carina Duchale für Brackel, Telefon 0231 567728-22, Hildegard Schönig für Lütgendortmund, Telefon 0152 54590865, Zehra Turgut für Innenstadt-Nord
Foto: Klaus Hartmann

Außergewöhnliches Doppel-Jubiläum
für Familienbetrieb im SHK-Handwerk
Vater und Sohn des Sanitär- und Heizungsunternehmens Holger-Boveland aus Dortmund-Rahm können sich über Goldenen und Silbernen Meisterbrief freuen / Obermeister und Geschäftsführer der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen gratulieren zum Doppel-Jubiläum
Goldenen und silbernen Boden zugleich hat das Handwerk für die Firma Bad & Heizung Holger Boveland e.K. in Dortmund-Rahm. Der Grund: Heute erhielten Senior Holger Boveland und Sohn Dirk Boveland gleichzeitig ihren Goldenen und Silbernen Meisterbrief für 50 bzw. 25 erfolgreiche Meister-Jahre im Handwerk. Zwar konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht groß gefeiert werden, aber Obermeister Ralf Marx und Geschäftsführer Joachim Susewind von der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen ließen es sich nicht nehmen, zu diesem ungewöhnlichen Doppel-Jubiläum persönlich zu gratulieren. „Sie sind der beste Beweis dafür, dass unser Handwerk über Generationen hinweg erfolgreich sein kann“, freute sich Obermeister Ralf Marx und übergab die Ehrenurkunden des Handwerks an die beiden Jubilare.
Vier Generationen im Handwerk
1954 hatte Großvater Werner Boveland die Firma „Klempnerei und Installation Boveland“ in Dortmund-Westerfilde gegründet. Später wechselte der Betrieb nach Dortmund-Rahm in die Selbachstraße 5, wo er bis heute seinen Firmensitz hat. Werner Boveland führte die Klempnerei mit seiner Frau Carla bis zu seinem Tod im Jahr 1970. Sein Sohn Holger Boveland, der zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Gesellenbrief hatte, übernahm den Handwerksbetrieb und machte 1971 seinen Meister. Rund vier Jahrzehnte führte er das Sanitär- und Heizungsunternehmen zusammen mit seiner Frau Ingrid erfolgreich weiter und baute es aus. 2010, nach dem Tod seiner Frau, übergab Holger Boveland den Betrieb in die dritte Generation an seinen Sohn Dirk Boveland. Der hatte bereits 1996 seine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Dortmund abgelegt und leitet das Unternehmen „Holger Boveland e.K. Sanitär- und Heizungstechnik“ bis heute. Als echter Familienbetrieb sind derzeit alle Bovelands im Unternehmen aktiv: Frau Nicole Boveland leitet das Büro, Senior Holger Boveland hilft aus und in vierter Generation ist auch Sohn Jan Luca schon mit dabei, der sich gerade in der Gesellenprüfung befindet. Sobald es wieder möglich ist, soll das besondere Meister-Ereignis übrigens gemeinsam mit allen12 Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern, darunter neben der Familie vier Gesellen, zwei Auszubildende und zwei Bürokräfte, gefeiert werden.
Bildzeile: Drei Generation freuen sich gemeinsam über den Goldenen und Silbernen Meisterbrief: (v.l.) Innungsgeschäftsführer Joachim Susewind, Dirk Boveland mit Frau Nicole Boveland und Sohn Jan Luca, Senior Holger Boveland und Obermeister Ralf Marx von der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen.
Foto: Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen

Katholische Beratungsstellen helfen in der Pandemie
Jahresbericht 2020: Belastungen der Menschen zeigen sich in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)
Für Menschen, die Rat suchen, ist die Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 22 Beratungsstellen des Erzbistums Paderborn da. Daran ändern auch die Lockdown-Zeiten in 2020 nichts. Mit insgesamt 3479 Klientinnen und Klienten liegt die Statistik des vergangenen Jahres nur etwas unter denen der Vorjahre. Einige Probleme aber haben sich durch die Pandemie verschärft, wie der jetzt veröffentlichte Jahresbericht 2020 zeigt.
„In der Beratungsarbeit sehen wir den Anstieg von Stress-Symptomen wie Ermüdung und Schlaflosigkeit, von Zukunftssorgen, Angststörungen, Affektstörungen und anderem mehr“, erläutert Christiane Beel, Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum Paderborn. Familien seien belastet durch Homeoffice, Homeschooling, unterbrochene Kinderbetreuung und durch einen Mangel an Ausgleichsmöglichkeiten.
„Überlebensmodus“
Ähnlich erleben dies Niels Christensen und Dr. Petra von der Osten von der EFL-Beratungsstelle in Dortmund. „Viele sind durch die Bedingungen der Pandemie einfach sehr müde und völlig erschöpft“, berichtet Niels Christensen. Häufig gelte die „Parole des Durchhaltens“ und die Klientinnen und Klienten würden sich in einer Art „Überlebensmodus“ befinden, was den Beratungsprozess erschwere. Als Berater sei er in seinen Möglichkeiten ebenfalls eingeschränkt. „Ich kann einem Paar ja nicht vorschlagen, mal wieder öfter zusammen essen zu gehen, wenn die Restaurants geschlossen sind“, erklärt er. Das werde sich hoffentlich bald wieder ändern.
Hygienekonzept
Rückblickend hat Dr. Petra von der Osten nur in den Wochen des ersten Lockdowns einen leichten Rückgang der Anfragen registriert. Danach gab es wieder viele telefonische Kontakte, einige Videoberatungen, überwiegend aber direkte Gespräche in der Beratungsstelle im Katholischen Centrum. Möglich wurden diese durch ein Hygienekonzept mit verkürzten Beratungszeiten, Abstand, einer Plexiglaswand im Beratungsraum und aktuell regelmäßigen Selbsttests der Beraterinnen und Berater sowie einem Testangebot für die Klienten. Die Vernetzung der Beraterinnen und Berater untereinander sowie die Fortbildungen fanden 2020 allerdings überwiegend digital statt.
Nicht nur „Eheberatung“
Fragen der Beziehungsklärung bei Paaren sind traditionell der häufigste Anlass für Menschen, sich an die Ehe-, Familien- und Lebensberatung zu wenden. Bedingt durch die Pandemie haben aber andere Anlässe, besonders bei den Einzelberatungen, an Bedeutung gewonnen. „Ängste beispielsweise spielen eine sehr große Rolle“, sagt Dr. Petra von der Osten. Darüber hinaus wandten sich in Dortmund auch Menschen an die Beratungsstelle, die sich nicht von ihren im Krankenhaus verstorbenen Angehörigen verabschieden konnten. Niels Christensen verweist hier darauf, dass es sich bei dem Beratungsangebot nicht nur um eine „Eheberatung“ handle, sondern die Familien- und Lebensberatung ebenso eine große Bedeutung habe.
Der Jahresbericht 2020 der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) im Erzbistum Paderborn ist kein nüchternes Zahlenwerk, sondern eine Broschüre, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Beratungsstellen einen persönlichen Rückblick auf das Jahr 2020 werfen. Enthalten sind außerdem alle Kontaktinformationen der Beratungsstellen sowie am Schluss eine auf das Wesentliche beschränkte Statistik. Erhältlich ist der Jahresbericht in allen Beratungsstellen und als Download auf der Homepage der EFL-Beratungsstellen im Erzbistum Paderborn: https://paderborn.efl-beratung.de/aktuelles/jahresbericht-2020/
Bildzeile: In Dortmund präsentierten Niels Christensen und Dr. Petra von der Osten von der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) im Katholischen Centrum den Jahresbericht 2020 der EFL-Beratungsstellen im Erzbistum Paderborn.
Foto: Michael Bodin / Erzbistum Paderborn